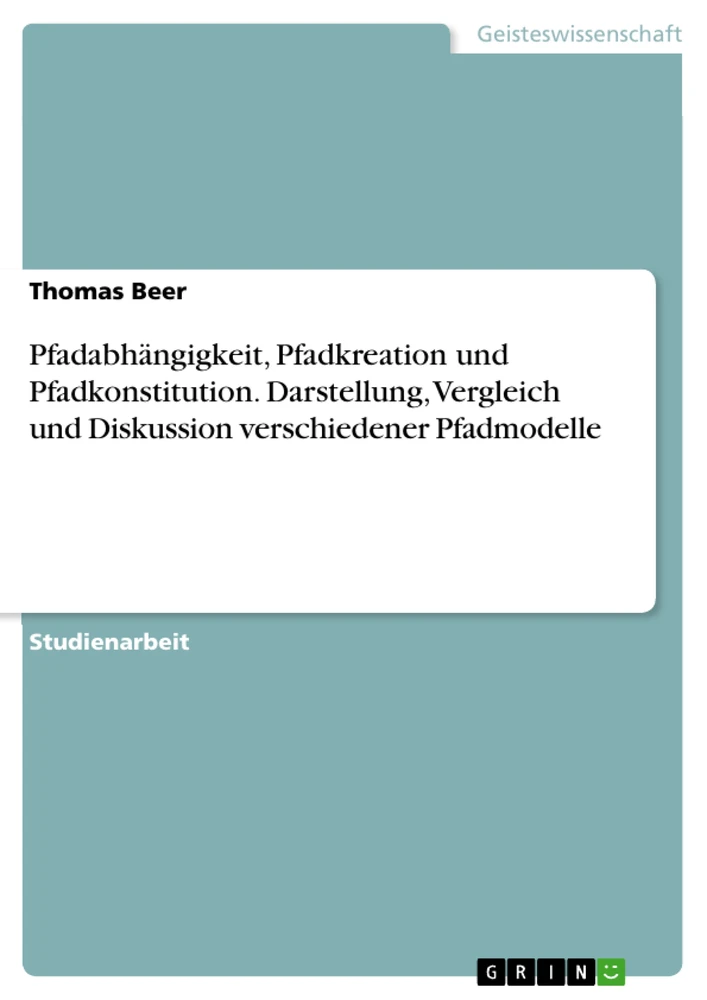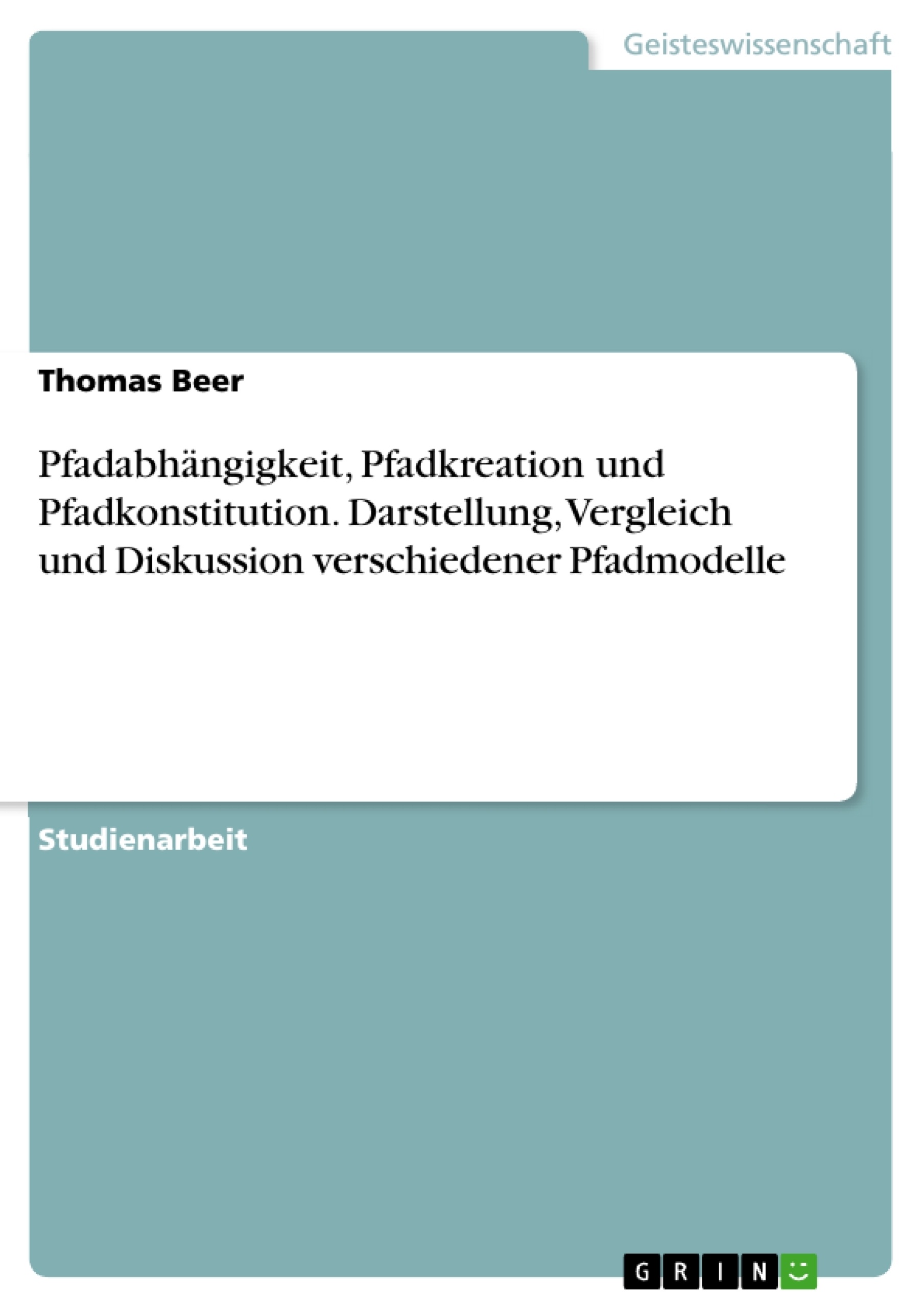Technik ist in unserer heutigen Welt allgegenwärtig, von der Waschmaschine und dem Kühlschrank über das Auto bis hin zum Computer. Es gibt kaum einen Lebensbereich, der in unserem Alltag nicht von Technik durchsetzt ist. Besonders zu betonen ist hierbei sicherlich das Smartphone, der universelle Helfer in allen Lebenslagen, auf dem sich zusätzlich für viele, vor allem jüngere Personen mittlerweile auch ein Großteil sozialer Kommunikation abspielt.
Warum sich eine Gesellschaftswissenschaft mit Bereichen der Technik auseinandersetzen sollte, bringt Weyer gut auf den Punkt: "Die zunehmende Technisierung und Informatisierung aller Bereiche der Gesellschaft wirft Fragen nach den sozialen Ursachen und Folgen dieser Prozesse, aber auch nach der Gestaltbarkeit und Steuerbarkeit von Technikentwicklung auf." Grund genug also für die Soziologie, gegenseitige Abhängigkeiten und Einflüsse zwischen Technik und Gesellschaft genauer zu betrachten. Unter dem Begriff Technik wird in der Soziologie größtenteils eine Technik im engeren Sinn verstanden, d.h. sogenannte Realtechniken. Sie grenzen sich von Techniken im weiteren Sinn, die eher im psychisch oder mentalen Bereich anzusiedeln sind (wie z.B. Rede- oder Verführungstechniken) ab. Eine der Grundfragen der Techniksoziologe ist, ob technische Entwicklungen die Gesellschaft prägen (Technikdeterminismus) oder eher Technik durch gesellschaftliche Faktoren geprägt wird (Sozialkonstruktivismus). Zu unterscheiden ist des Weiteren, ob der Verwendungs- oder der Herstellungskontext von Techniksoziologie im Fokus der Betrachtung steht. Bezüglich letzterem werden im Kontext der Innovationsforschung gegenwärtig besonders Pfadkonzepte kontrovers diskutiert. Diese charakterisieren sich dadurch, dass davon ausgegangen wird, dass technische Entwicklungen ab einem gewissen Punkt einen selbstverstärkenden Prozess in Gang setzten. Dieses sog. Momentum kann Innovationen zu einem generellen Standard werden lassen bzw. eingeschlagene technische Pfade verschließen. Die Pfadkonzepte gelten daher als einer technikdeterministischen Perspektive nahestehend.
Aufgrund der nach wie vor gegebenen Kontroverse und damit verbundenen Relevanz sollen in der vorliegenden Arbeit die verschiedenen Pfadkonzepte dargestellt, miteinander verglichen und diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Verortung der Pfadkonzepte in einer Soziologie der Technik
- Pfadabhängigkeit nach David (1985) und Arthur (1990)
- Pfadkreation nach Garud und Karnøe (2001)
- Pfadkonstitution nach Meyer und Schubert (2005)
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Darstellung, dem Vergleich und der Diskussion verschiedener Pfadmodelle innerhalb der Soziologie der Technik. Im Fokus steht die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen technischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Faktoren, wobei die Frage der Pfadabhängigkeit, Pfadkreation und Pfadkonstitution im Vordergrund steht.
- Die Einordnung von Pfadkonzepten in die Soziologie der Technik
- Die Darstellung des ursprünglichen Konzepts der Pfadabhängigkeit nach David und Arthur
- Die Erläuterung des Konzeptes der Pfadkreation nach Garud und Karnøe
- Die Präsentation des Konzeptes der Pfadkonstitution nach Meyer und Schubert
- Der Vergleich und die Diskussion der verschiedenen Pfadmodelle
Zusammenfassung der Kapitel
-
Verortung der Pfadkonzepte in einer Soziologie der Technik
Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung von Technik in der modernen Gesellschaft und die Frage, inwiefern technische Entwicklungen von gesellschaftlichen Faktoren geprägt werden oder umgekehrt. Es werden verschiedene Perspektiven auf den Zusammenhang zwischen Technik und Gesellschaft beleuchtet, darunter Technikdeterminismus und Sozialkonstruktivismus. Das Kapitel führt in das Konzept der Pfadabhängigkeit ein, das als eine technikdeterministische Perspektive betrachtet wird und das zentrale Thema der Arbeit bildet.
-
Pfadabhängigkeit nach David (1985) und Arthur (1990)
Dieses Kapitel stellt das ursprüngliche Konzept der Pfadabhängigkeit vor, wie es von David und Arthur entwickelt wurde. Es erläutert die Kernaussagen des Konzepts, die auf der Idee beruhen, dass ökonomische Veränderungen einen pfadabhängigen Verlauf annehmen können, der durch frühere Ereignisse beeinflusst wird. Das Beispiel der QWERTY-Tastatur wird verwendet, um die Funktionsweise der Pfadabhängigkeit zu veranschaulichen. Der Kapitel behandelt die Faktoren, die zur Dominanz des QWERTY-Standards führten, darunter technische Zusammenhänge, Skaleneffekte und die Quasi-Irreversibilität von Investitionen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Begriffe und Konzepte der Pfadabhängigkeit, Pfadkreation und Pfadkonstitution in der Soziologie der Technik. Weitere wichtige Schlüsselwörter sind Technikdeterminismus, Sozialkonstruktivismus, Innovation, Innovationsprozesse, technische Entwicklungen, gesellschaftliche Faktoren, QWERTY-Tastatur, Skaleneffekte, technische Interdependenzen und Quasi-Irreversibilität von Investitionen.
- Quote paper
- Thomas Beer (Author), 2017, Pfadabhängigkeit, Pfadkreation und Pfadkonstitution. Darstellung, Vergleich und Diskussion verschiedener Pfadmodelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379235