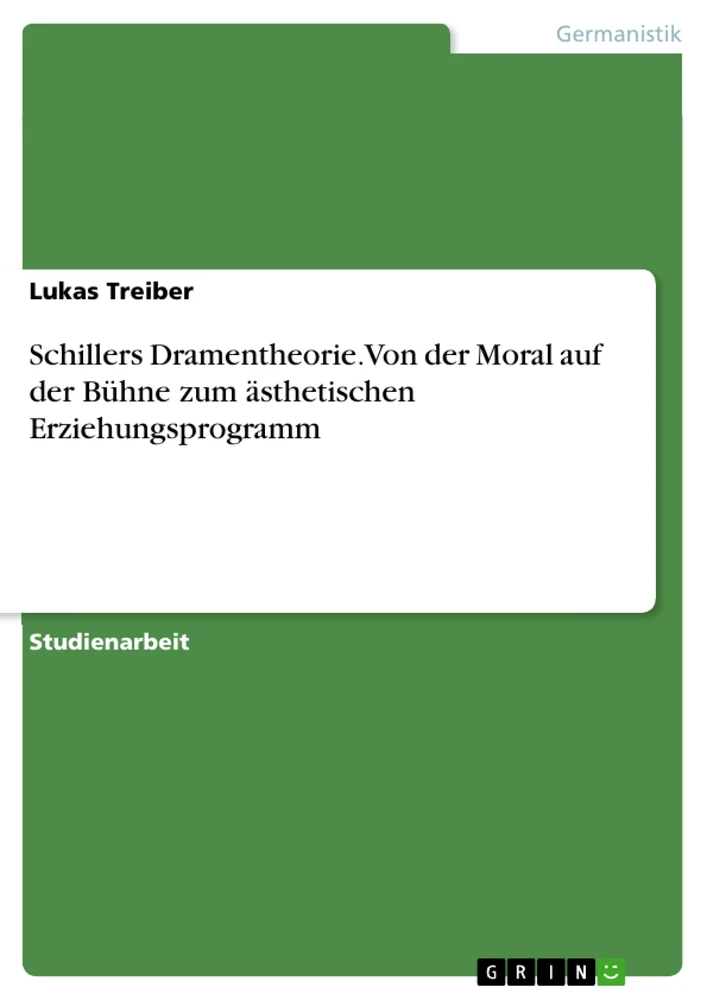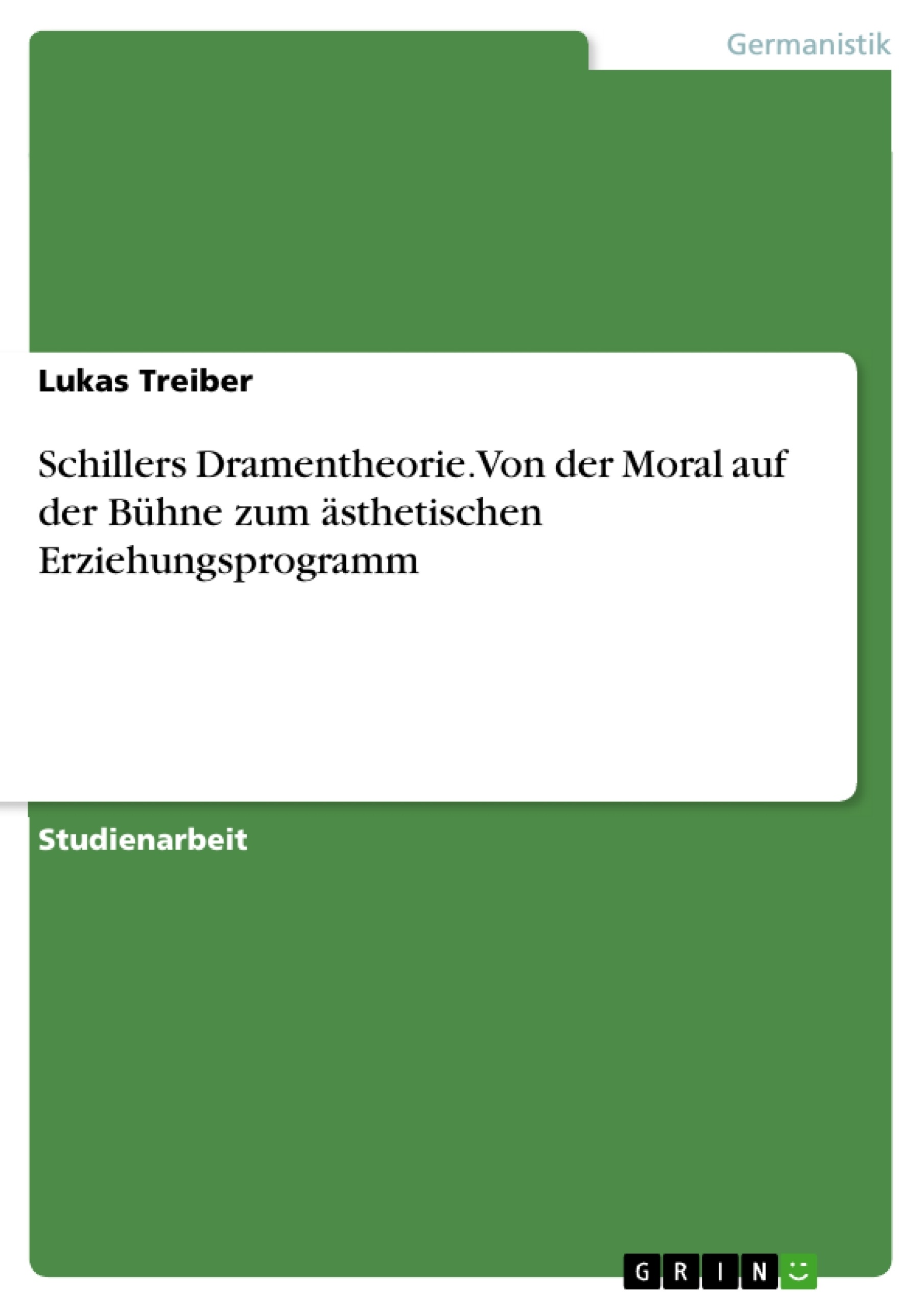In seinem literarischen Werk ist Friedrich Schiller nicht auf eine Gattung zu beschränken. Ebenso falsch wäre es, ihn nur einer Literaturepoche zuzuordnen. Wahrend sein Erstlingswerk "Die Räuber" noch eindeutig der Epoche des Sturm und Drang mit seiner bedeutenden Wichtigkeit zu subsumieren ist, so zählen spätere Werke wie "Wilhelm Tell" oder auch die Wallensteintrilogie zu den hochkaratigsten und namenhaftesten Vertretern der Weimarer Klassik.
Im Schaffen Schillers ist eine gravierende Entwicklung erkennbar. Die Reifung seiner Person ist durch seine theoretische Schaffensphase begünstigt. Währenddessen beschäftigt er sich mit der Philosophie der griechischen Antike, mit den Traktaten Kants und jüngst den Werken von Moritz. In Auseinandersetzung mit diesen Theorien entwickelt Schiller eigene philosophische Gedanken, die er in zahlreichen Schriften über die Dramentheorie und in Anlehnung an Moritz und Kant über die Ästhetik zum Ausdruck bringt. In zahlreichen philosophischen Briefen setzt er sich mit der ästhetischen Erziehung des Menschen auseinander.
Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf das theoretischen Schaffen Schillers. Es soll analysiert werden, welchen Einfluss seine Vorbilder auf Schiller nehmen konnten und inwiefern seine Entwicklung seine dramentheoretischen Ansichten revolutioniert hat. Zum Schluss wird die gegenwärtige Relevanz von Schillers Theorien in einem Ausblick zusammengetragen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Moraldidaktik Schillers
- Von der Autonomie der Kunst
- Von der schönen Seele
- Von den Anforderungen an das Drama
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die dramentheoretischen Ansichten Friedrich Schillers und untersucht, wie seine Auseinandersetzung mit der Philosophie der griechischen Antike, Kants Schriften und den Werken von Moritz seine Entwicklung und seine dramentheoretischen Ansichten beeinflusst haben. Außerdem wird die gegenwärtige Relevanz von Schillers Theorien in einem Ausblick betrachtet.
- Die Entwicklung von Schillers dramentheoretischen Ansichten
- Der Einfluss von philosophischen Vorbildern auf Schillers Werk
- Die Autonomie der Kunst in Schillers Ästhetik
- Die Rolle des Dramas als Erziehungsmittel
- Die Relevanz von Schillers Theorien in der Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort
Das Vorwort stellt Friedrich Schiller als vielseitigen Autor vor, dessen Schaffen sich nicht auf eine Gattung oder Epoche beschränken lässt. Es wird die Entwicklung seines Werkes von der Epoche des Sturm und Drang zur Weimarer Klassik hervorgehoben und die Bedeutung seiner philosophischen Beschäftigung mit der Antike, Kant und Moritz betont.
Die Moraldidaktik Schillers
Dieses Kapitel beleuchtet Schillers Konzeption der ästhetischen Erziehung des Menschen, die sich an den Idealen der griechischen Antike orientiert und zugleich von rationalistischer und idealistischer Philosophie beeinflusst ist. Es werden die Themen Autonomie der Kunst, Schillers Weiterentwicklung der Konzeption der schönen Seele und die daraus resultierenden Anforderungen an das Drama als Erziehungsmittel behandelt.
Von der Autonomie der Kunst
Schiller untersucht die Veränderung des Hauptzwecks der Kunst vom antiken Mimesiskonzept zum Vergnügen. Er bezieht sich dabei auf Platons Dialog Politieia und die Schriften von Moritz, der dem Kunstwerk erstmals ein eigenes Recht zugesteht und es von der Forderung nach einem Zweck befreit. Das Schöne ist nicht nur objektiv am und im Gegenstand, sondern hat auch die Kraft, den Betrachter in seinen Bann zu ziehen und in den Bereich der Schönheit selbst zu versetzen.
Von der schönen Seele
Dieses Kapitel behandelt Schillers Konzeption der schönen Seele und ihre Bedeutung für die ästhetische Erziehung des Menschen. Es wird untersucht, wie die schöne Seele als Idealbild des Menschen in Schillers Drama zum Ausdruck kommt und welche Anforderungen er an das Drama als Erziehungsmittel stellt.
Von den Anforderungen an das Drama
In diesem Kapitel werden die Anforderungen, die Schiller an das Drama als Erziehungsmittel stellt, beleuchtet. Es wird untersucht, wie das Drama zur moralischen Bildung des Menschen beitragen kann und welche Rolle die ästhetische Erfahrung dabei spielt. Die Bedeutung der Katharsis als moralische Reinigung wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Dramentheorie, Ästhetik, Klassizismus, Autonomie der Kunst, schöne Seele, ästhetische Erziehung, Mimesis, Vergnügen, Moral, Didaktik, Katharsis.
- Quote paper
- Lukas Treiber (Author), 2017, Schillers Dramentheorie. Von der Moral auf der Bühne zum ästhetischen Erziehungsprogramm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379225