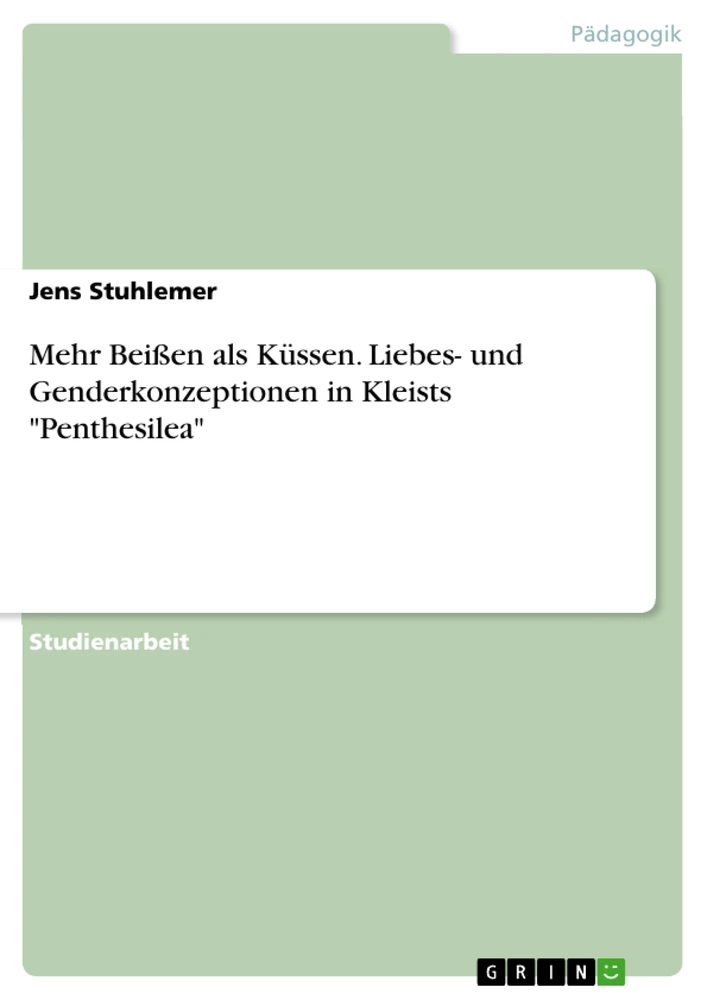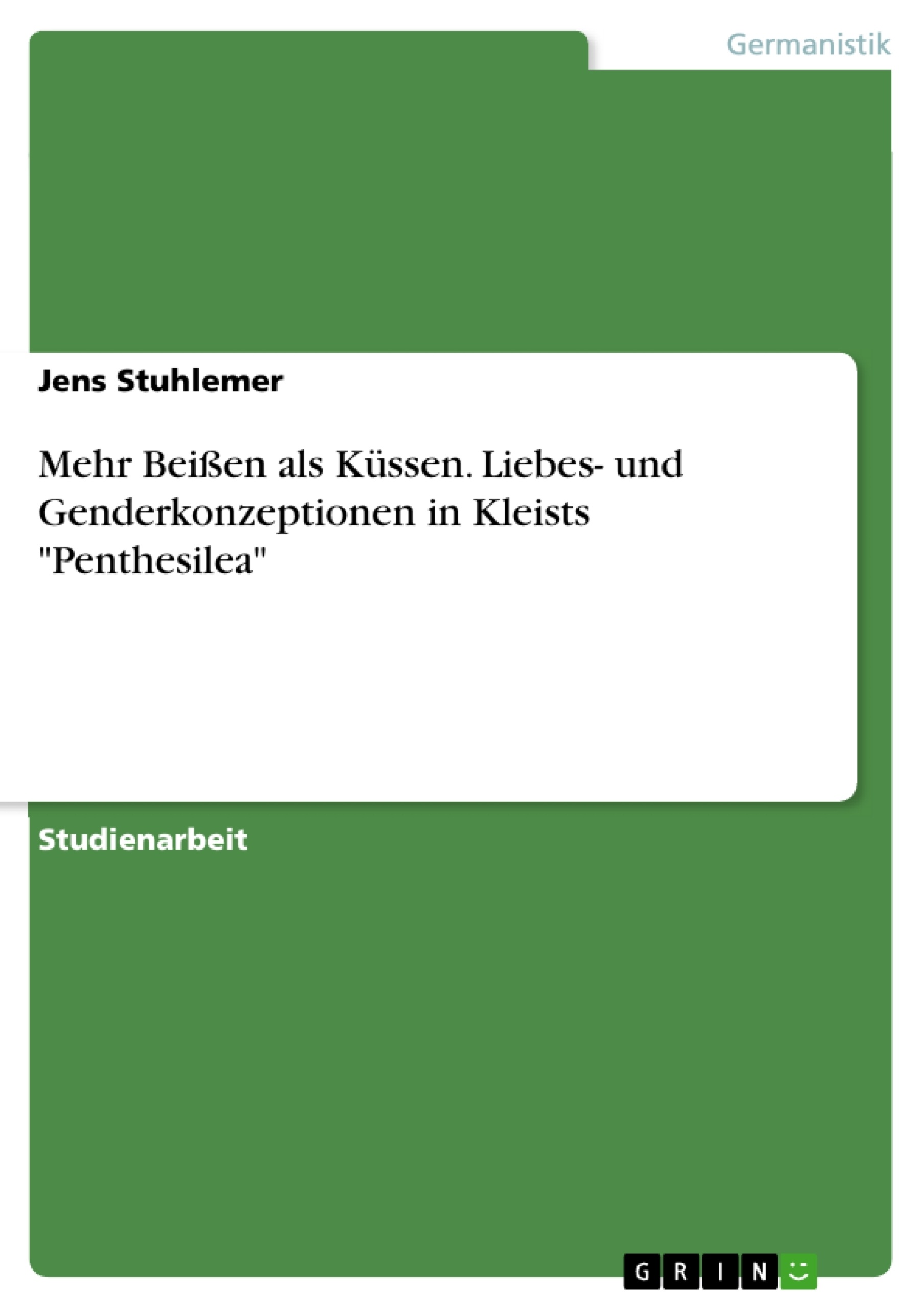Die hier vorliegende Arbeit hat zum Ziel die in Kleists Penthesilea enthaltenen Liebes- und Genderkonzeptionen aufzudecken und aufzuschlüsseln. Da dies in Gänze aufgrund der Kürze der Arbeit sowie der gleichzeitigen Komplexität des Dramas kaum möglich ist, wird sich wesentlichen auf entscheidende Charakterzüge Penthesielas und Achills konzentriert, um diese einerseits in Zusammenhang mit den um 1800 vorherrschenden Gelschlechter- und Liebeskonzeptionen zu setzen. Andererseits um die den teils undurchsichtigen Motivationen der beiden Hauptcharaktere näher zu kommen.
Konzeptionel steht der Analyse der beiden Charaktere eine grobe Erläuterung des Gesellschafts- und Frauenbildes um 1800, sowie einer ausführlicheren Darstellung der Liebeskonzeptionen um 1800 voran, welche in Teilen bereits genutzt werden um klare Textbezüge herzustellen. Hinsichtlich der Penthesilea werden anschließend ihre narzisstisch-hysterischen Wesenzüge und ihre innere Konflikthaftigkeit erkennbar gemacht, wobei der Fokus bei Letzterem auf ihrem Konflikt zwischen Amazonenordnung und freier Liebe liegen soll. Achill, wie sich zeigen wird, teilt Penthesileas narzisstische Eigenschaft, die er als Vertreter der rationalen Männerwelt frei ausleben kann.
Die Arbeit fährt fort mit einer finalen Auswertung der in den beiden Figuren sowie in ihrem Verhältnis zueinander enthalten Geschlechter- und Liebeskonzeption, bevor sie mit einer Diskussion der Ergebnisse und einigen (möglichen) Ergänzungen schließt. Zusammenfassend soll herausgestellt werden, dass es sich bei dem vordergründigen Liebesverhältnis der beiden im Wesentlichen um den Versuch einer Besitzergreifung und Objektivierung des Gegenübers im Sinne der Geschlechtersystematik nach Fichte handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- Um 1800
- Gesellschaft um 1800
- Das Frauenbild um 1800
- Liebeskonzeptionen um 1800
- Penthesilea
- Die narzisstisch Hysterikerin
- Penthesileas Konflikt
- Achill
- Der Konventionelle
- Der Achilles-Komplex
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Ergänzung der Diskussion sowie offene Fragen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Liebes- und Genderkonzeptionen in Heinrich von Kleists Drama "Penthesilea". Der Fokus liegt auf den zentralen Charakteren Penthesilea und Achill, deren Eigenschaften im Kontext der gesellschaftlichen und liebesbezogenen Vorstellungen um 1800 analysiert werden. Die Arbeit beleuchtet die Motivationen der Hauptfiguren und untersucht deren komplexes Verhältnis zueinander.
- Das Frauenbild und die gesellschaftlichen Verhältnisse um 1800
- Die Liebeskonzeptionen um 1800 und ihre Darstellung im Drama
- Die narzisstischen Züge Penthesileas und ihr innerer Konflikt
- Achills Rolle und seine Beziehung zu Penthesilea
- Die Geschlechter- und Liebeskonzeptionen in der Beziehung zwischen Penthesilea und Achill
Zusammenfassung der Kapitel
Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit: Die Arbeit analysiert die Liebes- und Genderkonzeptionen in Kleists "Penthesilea", konzentriert sich dabei auf Penthesilea und Achill und deren Handlungen im Kontext der gesellschaftlichen Normen um 1800. Sie untersucht die Motivationen der Figuren und setzt diese in Beziehung zu den vorherrschenden Liebes- und Geschlechtervorstellungen der Zeit. Die Analyse soll aufzeigen, wie sich die komplexen Beziehungen der Figuren im Drama widerspiegeln.
Um 1800: Dieses Kapitel skizziert die gesellschaftlichen Strukturen und das Frauenbild um 1800 in Deutschland. Es beschreibt den Übergang von der feudalen Produktionsehe hin zu einer segmentierten Gesellschaft, in der das Individuum mit einer stärkeren Wahrnehmung von Differenzen zwischen sich und seiner Umwelt konfrontiert ist. Das aufkommende Ich-Bewusstsein und die damit verbundene "Umwelt-Differenz" werden im Zusammenhang mit Penthesileas Charakter beschrieben. Weiterhin wird das eingeschränkte gesellschaftliche und berufliche Dasein der Frauen um 1800 dargestellt und mit Fichtes philosophischen Ansichten zu Frauen und der Rolle der Frau in der Ehe kontrastiert.
Penthesilea: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Analyse von Penthesilea. Es werden ihre narzisstisch-hysterischen Wesenszüge und ihre innere Zerrissenheit zwischen der Amazonenordnung und ihrer Sehnsucht nach freier Liebe beleuchtet. Ihr Konflikt wird als Spiegelbild des gesellschaftlichen Wandels und des aufkommenden Individualitätsverständnisses interpretiert.
Achill: Das Kapitel analysiert die Figur des Achill, wobei seine konventionelle Rolle und sein vermeintlicher „Achilles-Komplex“ im Mittelpunkt stehen. Die Analyse beleuchtet, wie Achill als Repräsentant der rationalen Männerwelt die narzisstischen Eigenschaften, die er mit Penthesilea teilt, auslebt. Sein Verhältnis zu Penthesilea wird im Lichte der Geschlechter- und Liebeskonzeptionen des Dramas analysiert.
Schlüsselwörter
Penthesilea, Achill, Heinrich von Kleist, Liebeskonzeptionen, Genderkonzeptionen, Frauenbild, Gesellschaft um 1800, Narzissmus, Hysterie, Amazonen, Individualismus, Fichte, Geschlechterrollen, Machtkampf, Objektivierung, Besitzergreifung.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Liebes- und Genderkonzeptionen in Heinrich von Kleists "Penthesilea"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Liebes- und Genderkonzeptionen in Heinrich von Kleists Drama "Penthesilea". Der Fokus liegt auf den Hauptfiguren Penthesilea und Achill und deren Beziehung im Kontext der gesellschaftlichen Normen um 1800.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht das Frauenbild und die gesellschaftlichen Verhältnisse um 1800, die Liebeskonzeptionen dieser Zeit und ihre Darstellung im Drama, die narzisstischen Züge Penthesileas und ihren inneren Konflikt, Achills Rolle und seine Beziehung zu Penthesilea sowie die Geschlechter- und Liebeskonzeptionen in der Beziehung zwischen Penthesilea und Achill.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Gegenstand und Zielsetzung, einer Darstellung der Gesellschaft um 1800 (inkl. Frauenbild und Liebeskonzeptionen), einer Analyse der Figuren Penthesilea und Achill, einer Zusammenfassung der Ergebnisse und einer Diskussion offener Fragen. Ein Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht.
Wie wird die Figur der Penthesilea dargestellt?
Penthesilea wird als narzisstisch-hysterische Figur beschrieben, die innerlich zwischen der Amazonenordnung und ihrer Sehnsucht nach freier Liebe zerrissen ist. Ihr Konflikt wird als Spiegelbild des gesellschaftlichen Wandels und des aufkommenden Individualitätsverständnisses interpretiert.
Welche Rolle spielt Achill?
Achill wird als Repräsentant der rationalen Männerwelt dargestellt, der konventionelle Rollen einnimmt, aber gleichzeitig narzisstische Eigenschaften teilt, die er ähnlich wie Penthesilea auslebt. Seine Beziehung zu Penthesilea wird im Lichte der Geschlechter- und Liebeskonzeptionen des Dramas analysiert. Der Begriff des "Achilles-Komplexes" wird in diesem Zusammenhang diskutiert.
Wie wird die Gesellschaft um 1800 dargestellt?
Das Kapitel "Um 1800" skizziert die gesellschaftlichen Strukturen und das Frauenbild dieser Zeit in Deutschland. Es beschreibt den Übergang von der feudalen Produktionsehe hin zu einer segmentierten Gesellschaft mit einem stärker ausgeprägten Ich-Bewusstsein. Das eingeschränkte gesellschaftliche und berufliche Dasein von Frauen wird dargestellt und mit Fichtes Philosophie kontrastiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Penthesilea, Achill, Heinrich von Kleist, Liebeskonzeptionen, Genderkonzeptionen, Frauenbild, Gesellschaft um 1800, Narzissmus, Hysterie, Amazonen, Individualismus, Fichte, Geschlechterrollen, Machtkampf, Objektivierung, Besitzergreifung.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht, wie sich die komplexen Beziehungen der Figuren im Drama im Kontext der vorherrschenden Liebes- und Geschlechtervorstellungen der Zeit widerspiegeln. Eine detaillierte Zusammenfassung der Ergebnisse und eine Diskussion offener Fragen sind ebenfalls enthalten.
- Quote paper
- Jens Stuhlemer (Author), 2015, Mehr Beißen als Küssen. Liebes- und Genderkonzeptionen in Kleists "Penthesilea", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/379191