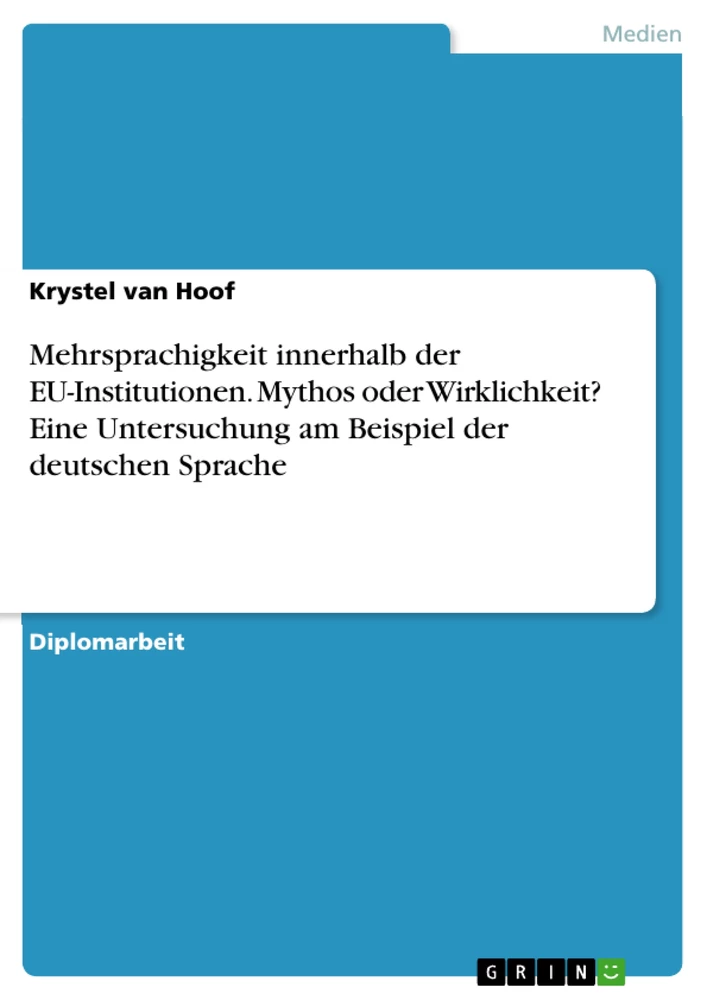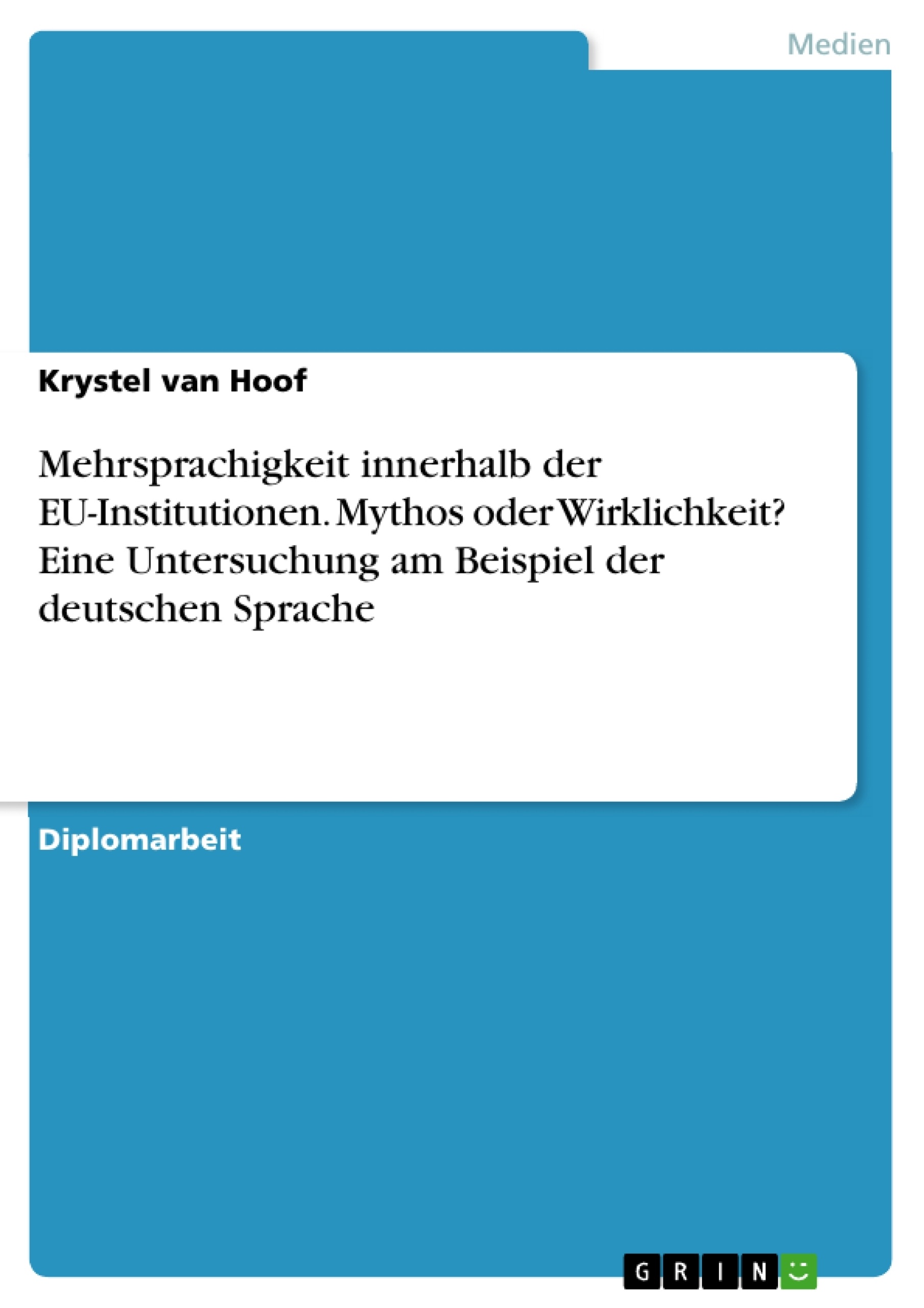„In varietate concordia“ lautet das Motto der Europäischen Union (EU) und bedeutet „In Vielfalt geeint“. In der Tat zeichnet sich die EU durch ein breites Spektrum an Kulturen, Traditionen, Religionen – und Sprachen aus. Diese Vielfalt versteht die EU als ein Nebeneinanderbestehen mannigfaltiger Unterschiede, in denen die sprachliche Heterogenität als Reichtum begriffen wird und zu mehr Solidarität führen soll. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die EU keinerlei Sprache eine Sonderstellung einräumt, sondern vielmehr auf die Gleichberechtigung aller Sprachen Wert legt, weswegen sich die EU-Bürger in ihrer Landessprache an die EU-Institutionen richten können. Wurden 1958 vier Sprachen als offizielle Amtssprachen anerkannt, so sind es heute mittlerweile 23. Als Arbeitssprachen jedoch gelten drei unter ihnen: Englisch, Französisch und Deutsch, wobei Letztere in den EU-Institutionen kaum Anwendung findet. Außerdem setzt sich das Englische immer stärker als lingua franca durch. Anhand von Gesprächen mit einzelnen EU-Mitarbeitern aus dem Parlament und der Kommission wird in dieser Arbeit die Sprachsituation innerhalb der genannten Institutionen erforscht. Es wird untersucht, wie – und ob – die EU-Konzeption der Mehrsprachigkeit in die Praxis umgesetzt wird, und das mit besonderem Fokus auf die deutsche Sprache.
Inhaltsverzeichnis
- Kurzfassung
- Danksagung
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Europäische Union
- 2.1. Geschichtlicher Hintergrund
- 2.2. Ziele der Europäischen Union
- 2.3. Die EU-Institutionen
- 2.3.1. Europäische Kommission (Art. 17 – EUV)
- 2.3.1.1. Befugnisse
- 2.3.1.2. Struktur
- 2.3.2. Europäisches Parlament (Art. 14 – EUV)
- 2.3.2.1. Befugnisse
- 2.3.2.2. Struktur
- 2.3.1. Europäische Kommission (Art. 17 – EUV)
- 2.4. Das sprachliche Spektrum Europas und der EU
- 2.4.1. Sprachfamilien in der EU
- 2.4.2. Regional- und Minderheitensprachen
- 2.4.3. Amts- und Arbeitssprachen
- 2.4.4. Fremdsprachenkenntnisse in der EU
- 3. Die Sprachenpolitik der EU
- 3.1. Begriffsbestimmung: Sprachpolitik vs. Sprachenpolitik
- 3.2. Eine egalitäre Sprachenpolitik
- 3.2.1. Verordnung Nummer 1
- 3.2.2. Charta der Grundrechte
- 3.3. Eine Mehrsprachigkeitspolitik
- 3.3.1. Mehrsprachigkeit als identitätsstiftendes Merkmal der EU
- 3.3.2. Mehrsprachigkeit als sprachpolitisches Ziel der EU
- 3.4. Förderung einer persönlichen Adoptivsprache
- 3.5. Interne Sprachenpolitik: Sprachenregelung in den EU-Institutionen
- 3.5.1. EU-Kommission
- 3.5.2. EU-Parlament
- 3.5.3. Übersetzungs- und Dolmetschdienste
- 3.5.3.1. EU-Kommission
- 3.5.3.2. EU-Parlament
- 4. Alltägliche Sprachverwendung in den EU-Institutionen
- 4.1. EU-Kommission
- 4.1.1. Sprachverwendung in Redebeiträgen der EU-Kommissare vor dem EU-Parlament
- 4.1.2. Sprachverwendung bei Pressekonferenzen der EU-Kommissare
- 4.1.3. Sprachverwendung für Internetseiten
- 4.2. EU-Parlament
- 4.2.1. Sprachverwendung in Sitzungen des EU-Parlaments
- 4.2.2. Sprachverwendung für Dokumente der interparlamentarischen Delegationen
- 4.2.3. Sprachverwendung für Internetseiten
- 4.1. EU-Kommission
- 5. Der spezifische Fall des Deutschen in der EU
- 5.1. Deutsch als Muttersprache
- 5.2. Deutsch als Fremdsprache
- 5.3. Deutsch als Amts- und Nationalsprache
- 5.4. Deutsch als Regional- und Minderheitensprache
- 5.5. Deutsch als Geschäfts- bzw. Handelssprache
- 5.6. Deutsch als Wissenschaftssprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Mehrsprachigkeitspolitik der EU und deren Umsetzung in den EU-Institutionen, insbesondere im Hinblick auf die deutsche Sprache. Die Studie zielt darauf ab, den Mythos der sprachlichen Gleichberechtigung innerhalb der EU mit der Realität abzugleichen.
- Die sprachliche Vielfalt innerhalb der EU und ihre Herausforderungen
- Die Sprachenpolitik der EU: Ziele und Umsetzung
- Die Rolle der deutschen Sprache in den EU-Institutionen
- Der Gebrauch von Arbeitssprachen und die Dominanz des Englischen
- Die Diskrepanz zwischen der deklaratorischen und der tatsächlichen Mehrsprachigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Mehrsprachigkeit innerhalb der EU-Institutionen ein und skizziert die Forschungsfrage der Arbeit. Sie erläutert die Bedeutung der sprachlichen Vielfalt in der EU und den Fokus auf die deutsche Sprache.
2. Die Europäische Union: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte, die Ziele und die Institutionen der Europäischen Union. Es beschreibt die Struktur der Kommission und des Parlaments und beleuchtet das komplexe sprachliche Spektrum innerhalb der EU, einschließlich der verschiedenen Sprachfamilien, Regionalsprachen, Amts- und Arbeitssprachen sowie der Fremdsprachenkenntnisse der EU-Bürger. Der Abschnitt liefert das notwendige Hintergrundwissen um die spätere Analyse der Sprachenpolitik zu verstehen.
3. Die Sprachenpolitik der EU: Dieses Kapitel analysiert die Sprachenpolitik der EU, differenziert zwischen Sprachpolitik und Sprachenpolitik und erklärt das Konzept der egalitären Sprachenpolitik der EU. Es untersucht die Mehrsprachigkeitspolitik als identitätsstiftendes Merkmal und sprachpolitisches Ziel der Union. Die Förderung einer persönlichen Adoptivsprache und die interne Sprachenpolitik in den EU-Institutionen werden ebenfalls behandelt, um die theoretischen Grundlagen für die empirischen Kapitel zu legen.
4. Alltägliche Sprachverwendung in den EU-Institutionen: Dieses Kapitel untersucht die tatsächliche Sprachverwendung in der Kommission und im Parlament. Es analysiert die Praxis der Sprachnutzung in verschiedenen Kontexten, wie beispielsweise in Redebeiträgen, Pressekonferenzen und auf Internetseiten. Hier wird der Unterschied zwischen der idealisierten und der praktischen Mehrsprachigkeit sichtbar.
5. Der spezifische Fall des Deutschen in der EU: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Rolle der deutschen Sprache in der EU, unter Berücksichtigung ihrer Funktion als Muttersprache, Fremdsprache, Amts- und Nationalsprache, Regional- und Minderheitensprache, sowie Geschäfts- und Wissenschaftssprache. Es untersucht die Stellung des Deutschen im Kontext der Mehrsprachigkeit innerhalb der EU-Institutionen und seine faktische Verwendung.
Schlüsselwörter
Sprachenpolitik, Mehrsprachigkeit, Mehrsprachigkeitspolitik, Sprachenvielfalt, Europäische Union, Europäische Institutionen, Europäische Kommission, Europäisches Parlament, Amtssprachen, Arbeitssprachen, Verfahrenssprachen, Regionalsprachen, Minderheitensprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, lingua franca.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Analyse der Mehrsprachigkeitspolitik der EU
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Mehrsprachigkeitspolitik der Europäischen Union (EU) und deren praktische Umsetzung in den EU-Institutionen, insbesondere im Hinblick auf die deutsche Sprache. Sie untersucht die Diskrepanz zwischen der deklarierten sprachlichen Gleichberechtigung und der Realität.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die sprachliche Vielfalt in der EU, die Sprachenpolitik der EU (inkl. Ziele und Umsetzung), die Rolle der deutschen Sprache in den EU-Institutionen, die Verwendung von Arbeitssprachen (mit Fokus auf die Dominanz des Englischen) und die Diskrepanz zwischen der angestrebten und der tatsächlichen Mehrsprachigkeit.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Europäischen Union (Geschichte, Ziele, Institutionen, sprachliche Situation), ein Kapitel zur Sprachenpolitik der EU, ein Kapitel zur tatsächlichen Sprachverwendung in den EU-Institutionen (Kommission und Parlament) und ein Kapitel zum spezifischen Fall der deutschen Sprache in der EU.
Welche Aspekte der Europäischen Union werden betrachtet?
Das Dokument beleuchtet die Geschichte der EU, ihre Ziele, die Struktur der wichtigsten Institutionen (Europäische Kommission und Europäisches Parlament), die verschiedenen Sprachfamilien und Regionalsprachen innerhalb der EU, die Amts- und Arbeitssprachen sowie die Fremdsprachenkenntnisse der EU-Bürger.
Wie wird die Sprachenpolitik der EU analysiert?
Die Analyse der EU-Sprachenpolitik umfasst die Begriffsbestimmung (Sprachpolitik vs. Sprachenpolitik), die egalitäre Sprachenpolitik (inkl. Verordnung Nummer 1 und Charta der Grundrechte) und die Mehrsprachigkeitspolitik als identitätsstiftendes Merkmal und politisches Ziel. Die interne Sprachenpolitik der EU-Institutionen und die Förderung einer persönlichen Adoptivsprache werden ebenfalls betrachtet.
Wie wird die Sprachverwendung in den EU-Institutionen untersucht?
Die Untersuchung der Sprachverwendung fokussiert auf die Praxis in der Kommission und im Parlament, analysiert die Sprachwahl in Reden, Pressekonferenzen und auf Internetseiten und vergleicht die idealisierte Mehrsprachigkeit mit der tatsächlichen.
Welche Rolle spielt die deutsche Sprache in der EU?
Das Dokument untersucht die Rolle des Deutschen als Muttersprache, Fremdsprache, Amts- und Nationalsprache, Regional- und Minderheitensprache sowie als Geschäfts- und Wissenschaftssprache in der EU und dessen faktische Verwendung innerhalb der EU-Institutionen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Sprachenpolitik, Mehrsprachigkeit, Mehrsprachigkeitspolitik, Sprachenvielfalt, Europäische Union, Europäische Institutionen, Europäische Kommission, Europäisches Parlament, Amtssprachen, Arbeitssprachen, Verfahrenssprachen, Regionalsprachen, Minderheitensprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, lingua franca.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Eine Zusammenfassung jedes Kapitels ist im Dokument enthalten, welche die zentralen Inhalte und Fragestellungen jedes Kapitels kurz beschreibt.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist für akademische Zwecke bestimmt, insbesondere für die Analyse von Themen der Mehrsprachigkeit in der EU.
- Quote paper
- Krystel van Hoof (Author), 2012, Mehrsprachigkeit innerhalb der EU-Institutionen. Mythos oder Wirklichkeit? Eine Untersuchung am Beispiel der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378626