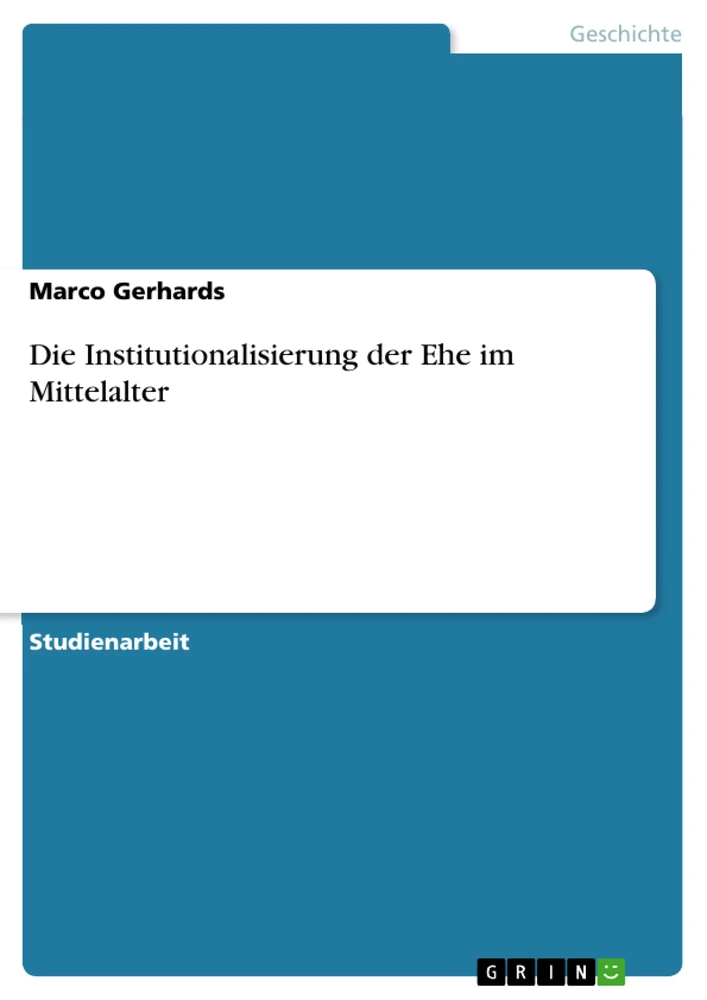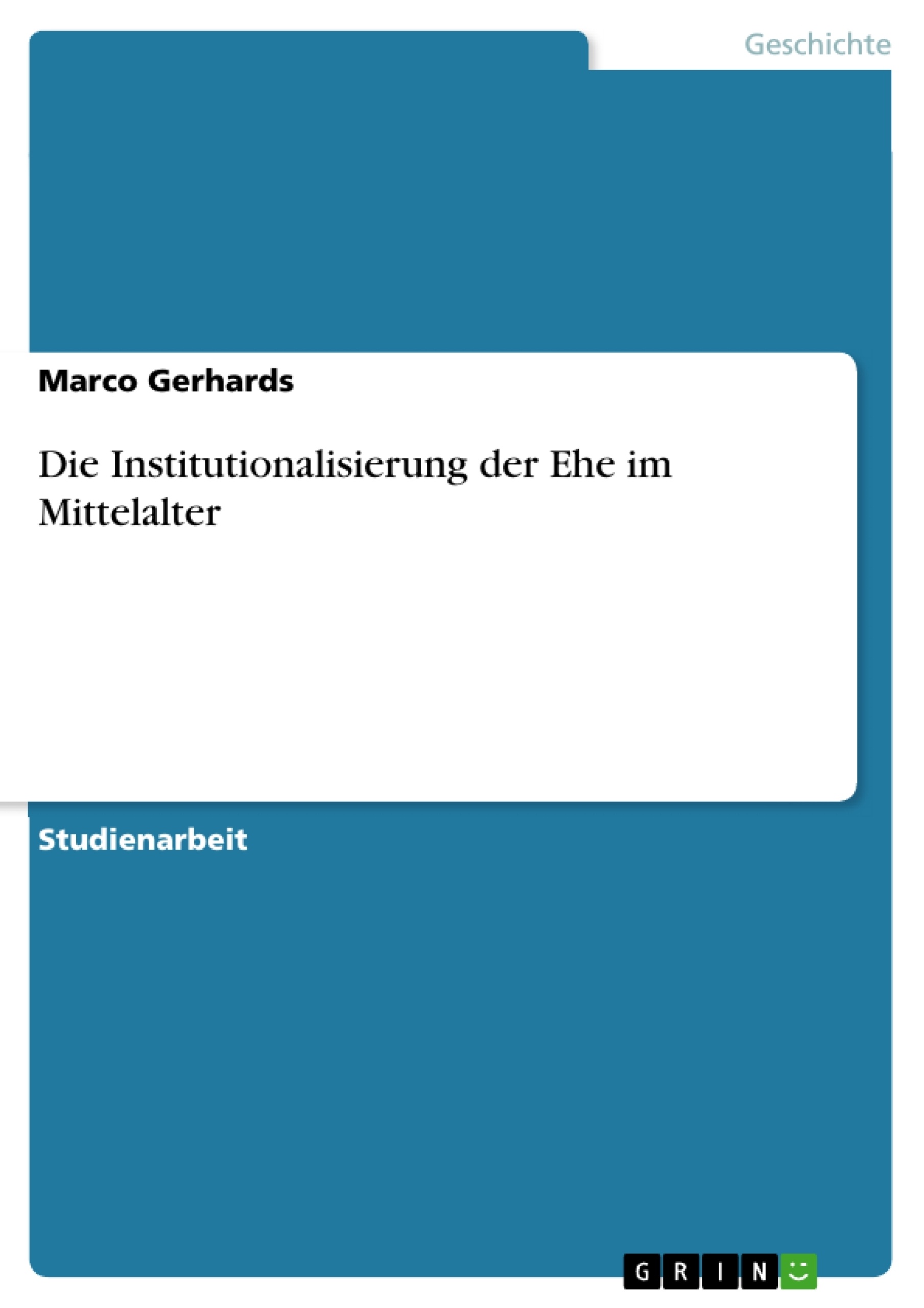Die Frage nach der Institutionalisierung der Ehe im Mittelalter stößt auf eine äußerst komplexe politisch, sozial, anthropologisch und psychologisch verwobene Melange. Die gregorianischen Reformen sowie die Umbrüche des 11. und 12. Jahrhunderts lassen sich als erste Annäherung konstatieren, in der sich eine gewichtige Prägung christlicher Vorstellungen im kollektiven europäischen Bewusstsein durchsetzte. An jenen Rahmendaten will sich diese Arbeit orientieren, darüber hinaus aber auch den anthropologischen Fragen der Ehe näher kommen. Welche Bedeutung nämlich die Ehe für das menschliche Miteinander hatte, und wer und wie Interesse an einer Kontrolle der Ehe hatte. All jene Fragen lassen sich nur annähernd beantworten, gibt es doch weder ein einheitliches Mittelalter oder gar "den" Menschen des Mittelalters.
Der Versuch, das 11. Jahrhundert oder die gregorianischen Kirchenreformen als isoliertes Phänomen zu untersuchen, scheitert bereits beim groben Durchblättern der Literatur. Es fallen zahlreiche Vorstellungen und Gegenvorstellungen in einen Zeitrahmen von mehreren Jahrhunderten. Gewisse im 11. Jahrhundert geforderte Wesensmerkmale der christlichen Ehe lassen sich bereits dreihundert Jahre vorher finden, genau so wie sich dreihundert Jahre später immer noch nicht finden lassen. Dementsprechend soll in dieser Arbeit eher eine deduktive Untersuchungsmethode stattfinden: Ein grober allgemeiner Überblick wird angestrebt, um das besondere Ereignis der Reformen des 11. Jahrhunderts einordnen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Fragestellung
- 1.2 Methode
- 1.3 Quellen
- 1.4 Aufbau
- 2 Hauptteil
- 2.1 Definitionen
- 2.1.1 Ehe
- 2.2 Urkirche und Kirchenväter bis zum Hochmittelalter
- 2.2.1 Urkirche
- 2.2.2 Spätantike
- 2.2.3 Frühmittelalter
- 2.3 Nichtchristliche Sitten
- 2.4 Institutionalisierung im Hochmittelalter
- 2.4.1 Gregorianische Reformen
- 2.4.2 Burchard von Worms
- 2.4.3 Ivo von Chartres
- 2.4.4 Hugo von Sankt Viktor
- 2.4.5 Gratian
- 2.5 Tatsächliche Praxis
- 2.5.1 Die weltlichen Herrscher
- 2.5.2 Die Kleriker
- 2.5.3 Das einfache Volk
- 2.6 Spätmittelalter und frühe Neuzeit
- 2.1 Definitionen
- 3 Evaluationen
- 3.1 Mann/Frau
- 3.2 Anthropologie
- 4 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit widmet sich der Frage, wie die Ehe im Mittelalter institutionalisiert wurde. Sie beleuchtet die Entwicklung des christlichen Eheverständnisses von der Urkirche bis ins Hochmittelalter, mit besonderem Fokus auf die Gregorianischen Reformen und die Umbrüche des 11. und 12. Jahrhunderts. Die Arbeit geht zudem der Frage nach, welche Bedeutung die Ehe für das menschliche Miteinander hatte und wer und wie Interesse an einer Kontrolle der Ehe hatte.
- Entwicklung des christlichen Eheverständnisses
- Die Rolle der Gregorianischen Reformen und des 11. und 12. Jahrhunderts
- Anthropologische Aspekte der Ehe im Mittelalter
- Kontrolle und Einfluss auf die Ehe im Mittelalter
- Rekonstruktion der tatsächlichen Praxis der Ehe im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung, die Methode, die verwendeten Quellen und den Aufbau der Arbeit vor. Der erste Abschnitt des Hauptteils widmet sich einer grundsätzlichen Annäherung an das christliche Verständnis der Ehe, beginnend mit den ältesten christlichen Quellen und deren Rezeptionen und Überarbeitungen über die Spätantike bis ins Hochmittelalter. Dabei werden die Vorstellungen und Traktate der Kirchenväter bis zum 11. Jahrhundert beleuchtet. Der Abschnitt umfasst ebenfalls die nichtchristlichen Eheauffassungen der Römer, Germanen, Gallier und Westgoten. Der zweite Abschnitt befasst sich mit den Reformen und Institutionalisierungen im 11. und 12. Jahrhundert, die eine weltlich-geistliche Vermischung hervorriefen. Es werden die entscheidenden Schriften der Theologen vorgestellt und ein Versuch unternommen, die tatsächliche Umsetzung in die Praxis zu rekonstruieren. Ein kurzer Überblick über den weiteren Verlauf des Eheverständnisses im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit beendet den Hauptteil. Der Abschnitt "Evaluationen" analysiert das Verhältnis von Mann und Frau sowie das anthropologische Verständnis der Ehe, insbesondere der Sexualität. Die Schlussbemerkung fasst die Ergebnisse zusammen und stellt etwaige Fragen für die zukünftige Forschung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themengebiete dieser Arbeit sind: Ehe im Mittelalter, christliches Eheverständnis, Gregorianische Reformen, Anthropologie der Ehe, Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau, Institutionalisierung der Ehe, Quellen des Mittelalters, Historiographie der Ehe.
- Quote paper
- Marco Gerhards (Author), 2009, Die Institutionalisierung der Ehe im Mittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/378497