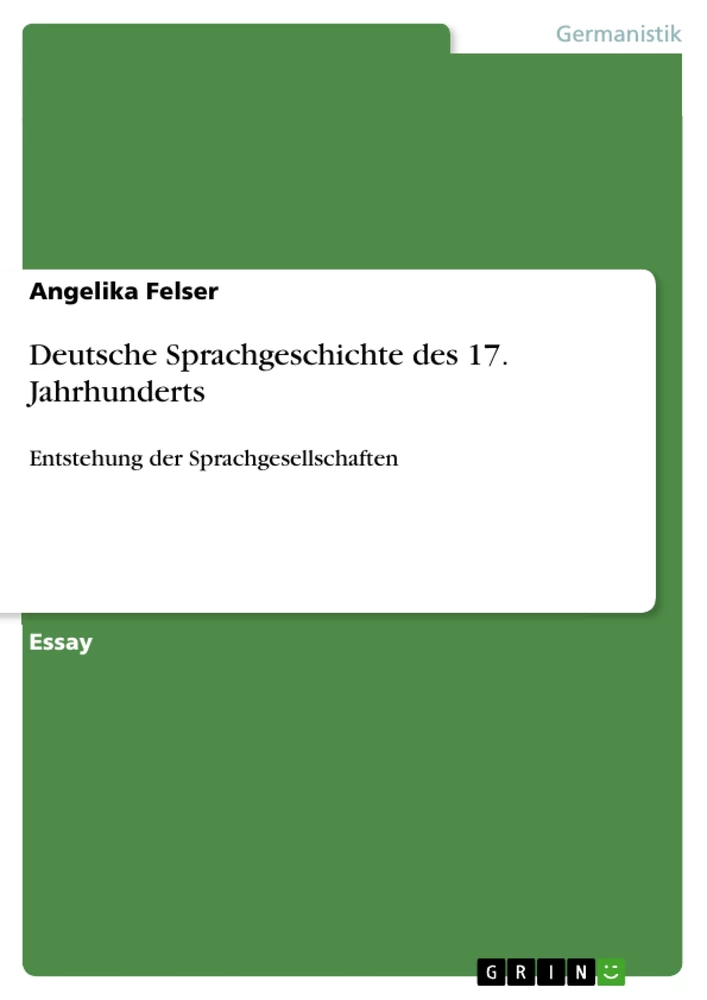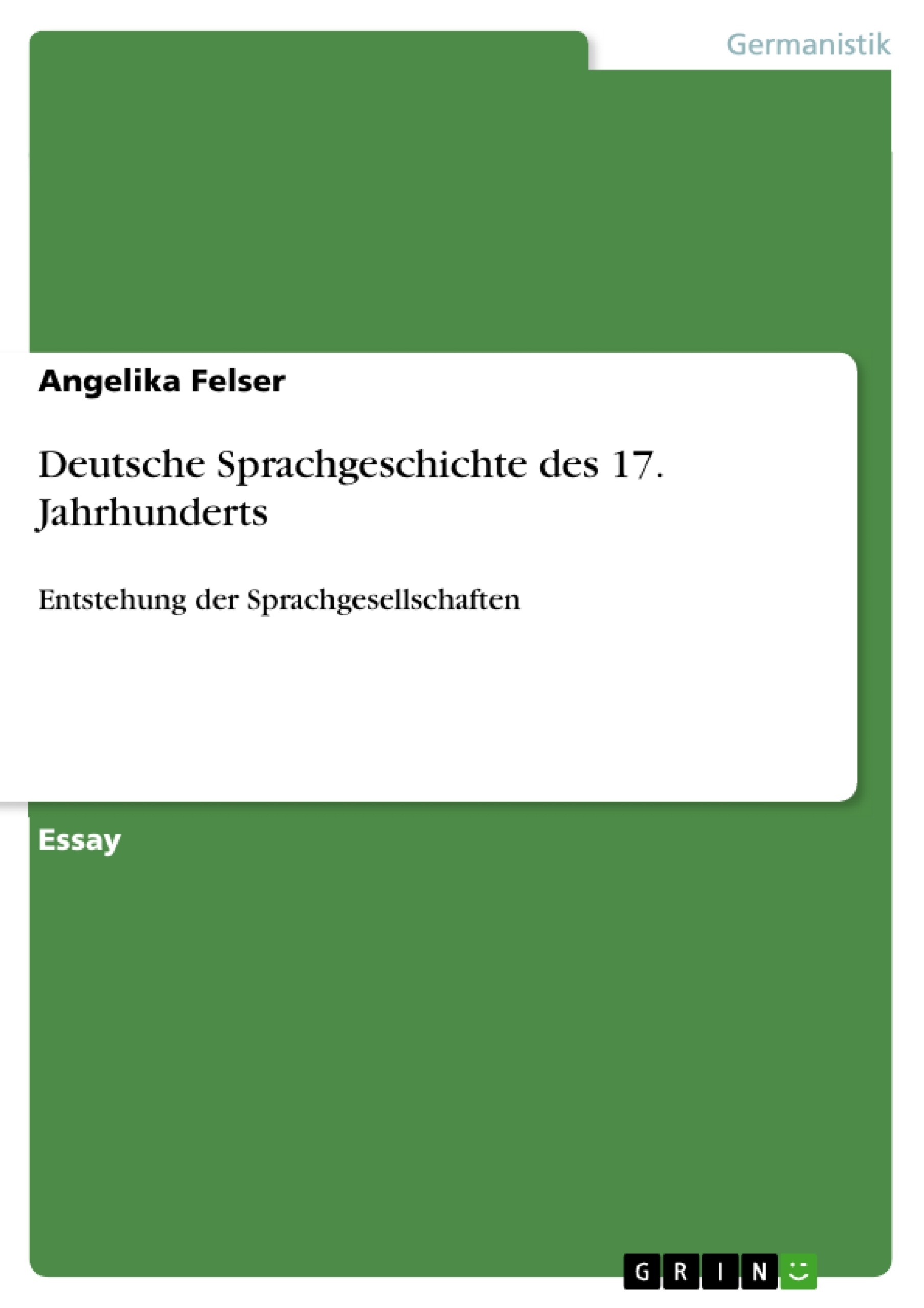Das Essay bietet einen kurzen Überblick über die deutsche Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts. Es erklärt, wie es zu "Sprachgesellschaften" kam. Auf die Sprachgesellschaften selbst wird hier nicht näher eingegangen. Die Quellen sind angegeben.
„Sprachpurismus“ ist eine linguistische Universalie, die nicht ein bloßes deutsches Phänomen ist, sondern in allen europäischen Sprachgemeinschaften zu finden ist. Ursache(n) ist, beziehungsweise sind zumeist lexikalische und ausdrucksseitig erkennbare Einflüsse auf eine Sprache infolge eines Sprachkontaktes. Unter „Sprachpurismus“ oder „Sprachreinigung“ versteht man den Versuch, Fremd- und Lehnwörter aus einer Sprache zu entfernen, indem man aus dem Material der eigenen Sprache neue Wörter bildet. Ein Fremdwort ist ein Wort, das aus einer anderen Sprache übernommen wurde und das in Betonung, Lautung und Schreibung der Zielsprache (noch) nicht angepasst wurde, so dass es als fremd empfunden wird. Im Unterschied dazu ist das Lehnwort ein Wort, das so weit in Flexion, Lautung und Schriftbild in den Sprachgebrauch eingegangen ist, dass es nicht mehr als fremd wahrgenommen wird. Bei den Mitgliedern der deutschen Sprachgemeinschaften haben besonders ausdrucksseitig erkennbare Eigenheiten eines als „fremd“ empfundenen Wortes (Aussprache, Betonung, sichtbar „Fremdes“) zu verschiedenen Zeiten sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen, die von bedenkenloser Übernahme und Gleichgültigkeit bis zu scharfer Ablehnung reichten. Aus einer ablehnenden Haltung hat sich im Laufe der Sprachgeschichte verschiedentlich eine aktive (Abwehr-)Handlung in Form eines Kampfes gegen einzelne Fremdwörter bis hin gegen das Fremdwort schlechthin entwickelt: Die Begriffe „Fremdwortjagd“, „Purismus“, „Sprachreinigung“ charakterisieren die puristischen Bestrebungen der Sprachpflege im 19. und 20. Jahrhundert. Diese Art von Purismus trifft für das 17. und 18. Jahrhundert nur bedingt zu: „Rein“ entspreche nicht unbedingt dem Wort „fremdwortfrei“, sondern -auf die Leitvarietät bzw. Standardsprache bezogeneher dem Wort „richtig“ im Sinne von „gesetzmäßig“ und „normgerecht“.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Deutsche Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts
- 2.1 Sprachliche Situation zu Beginn der neuhochdeutschen Zeit
- 2.2 Einfluss des Lateinischen
- 2.3 Einfluss des Italienischen
- 2.4 Einfluss des Französischen
- 2.5 Sprachmengerey und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsche Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts, insbesondere den Einfluss von Fremdsprachen auf die Entwicklung der deutschen Sprache in dieser Epoche. Die Arbeit beleuchtet die sprachliche Situation zu Beginn der neuhochdeutschen Zeit und analysiert die verschiedenen Einflüsse von Latein, Italienisch und Französisch. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Phänomen der "Sprachmengerey" und der damit verbundenen Kritik an der Vermischung der deutschen Sprache mit Fremdwörtern.
- Sprachliche Situation in Deutschland zu Beginn der Neuhochdeutschen Zeit
- Einfluss des Lateinischen, Italienischen und Französischen auf die deutsche Sprache im 17. Jahrhundert
- Analyse der Lehnwortbildungen und -übernahmen aus verschiedenen Sprachen
- Das Phänomen der "Sprachmengerey" und die damit verbundene Kritik
- Der Wandel des Sprachprestiges im 17. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Sprachpurismus ein und differenziert zwischen Fremd- und Lehnwörtern. Sie beschreibt die unterschiedlichen Reaktionen auf Fremdwörter in der deutschen Sprachgeschichte, von der bedenkenlosen Übernahme bis zur scharfen Ablehnung. Die Einleitung betont, dass der Purismus des 17. und 18. Jahrhunderts anders zu verstehen ist als derjenige des 19. und 20. Jahrhunderts.
2 Deutsche Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beschreibt die sprachliche Situation zu Beginn der neuhochdeutschen Zeit, die durch eine große Vielfalt an Dialekten und das Fehlen eines kulturellen oder politischen Zentrums geprägt war. Es wird der Einfluss des Ostmitteldeutschen, insbesondere aufgrund Luthers, sowie der anhaltenden Verwendung von Latein und Französisch in Bildung und Oberschicht erläutert. Der Text beleuchtet die umfangreiche Übernahme von Fachwörtern aus dem Lateinischen in verschiedene Bereiche wie die Wissenschaft, die Druckersprache und die Verwaltung. Darüber hinaus werden die Einflüsse des Italienischen, besonders in den Bereichen Handel und Musik, und eine zweite, massive Welle französischer Lehnwörter im Kontext des kulturellen und politischen Einflusses Frankreichs unter Ludwig XIV. detailliert dargestellt. Der Text analysiert die "Alamodezeit" und die damit einhergehende Vorherrschaft des Französischen als Prestige-Sprache, die sowohl die Alltagssprache als auch die Hochsprache beeinflusste. Die Übernahme von Fremdwörtern wird nicht als reiner mechanischer Prozess verstanden, sondern als bedürfnis- und interessengesteuert, mit dem Fokus auf Bedeutungsverengungen im Entlehnungsprozess. Schließlich wird die „Sprachmengerey“ und die damit verbundene Kritik an der Vermischung verschiedener Sprachen in der deutschen Sprache des 17. Jahrhunderts thematisiert. Die satirische und parodistische Kritik an diesem Sprachgebrauch durch Literaten und Sprachgesellschaften wird beispielhaft durch ein Zitat aus einem Gedicht verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Sprachpurismus, Neuhochdeutsch, Sprachgeschichte 17. Jahrhundert, Fremdwörter, Lehnwörter, Latein, Italienisch, Französisch, Sprachmengerey, Alamodezeit, Sprachpflege, normative Kraft, Prestige, Dialekte, Literatursprache.
Häufig gestellte Fragen zur deutschen Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der deutschen Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts und untersucht insbesondere den Einfluss von Fremdsprachen (Latein, Italienisch, Französisch) auf die Entwicklung der deutschen Sprache in dieser Epoche. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Phänomen der „Sprachmengerey“ und der damit verbundenen Kritik an der Vermischung der deutschen Sprache mit Fremdwörtern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die sprachliche Situation zu Beginn der neuhochdeutschen Zeit, die Einflüsse des Lateinischen, Italienischen und Französischen, die Analyse von Lehnwortbildungen und -übernahmen, das Phänomen der „Sprachmengerey“ und die damit verbundene Kritik, sowie den Wandel des Sprachprestiges im 17. Jahrhundert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst mindestens zwei Kapitel: eine Einleitung und ein Kapitel zur deutschen Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts. Die Einleitung führt in das Thema Sprachpurismus ein und differenziert zwischen Fremd- und Lehnwörtern. Das Hauptkapitel beschreibt detailliert die sprachliche Situation zu Beginn der neuhochdeutschen Zeit, die Einflüsse verschiedener Sprachen (Latein, Italienisch, Französisch), die „Alamodezeit“ und die Kritik an der „Sprachmengerey“.
Wie wird der Einfluss von Fremdsprachen beschrieben?
Der Einfluss des Lateinischen wird im Kontext von Wissenschaft, Druckersprache und Verwaltung dargestellt. Der Einfluss des Italienischen wird im Zusammenhang mit Handel und Musik beschrieben. Der Einfluss des Französischen wird vor allem im Kontext des kulturellen und politischen Einflusses Frankreichs unter Ludwig XIV. und der „Alamodezeit“ erläutert, wo Französisch als Prestige-Sprache die Alltagssprache und Hochsprache beeinflusste. Die Übernahme von Fremdwörtern wird als bedürfnis- und interessengesteuert beschrieben, mit Fokus auf Bedeutungsverengungen im Entlehnungsprozess.
Was ist „Sprachmengerey“?
„Sprachmengerey“ bezeichnet die Vermischung der deutschen Sprache mit Fremdwörtern im 17. Jahrhundert. Die Arbeit analysiert dieses Phänomen und die damit verbundene Kritik, die sich in satirischen und parodistischen Werken von Literaten und Sprachgesellschaften ausdrückte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachpurismus, Neuhochdeutsch, Sprachgeschichte 17. Jahrhundert, Fremdwörter, Lehnwörter, Latein, Italienisch, Französisch, Sprachmengerey, Alamodezeit, Sprachpflege, normative Kraft, Prestige, Dialekte, Literatursprache.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die deutsche Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts, insbesondere den Einfluss von Fremdsprachen auf die Entwicklung der deutschen Sprache. Sie beleuchtet die sprachliche Situation zu Beginn der neuhochdeutschen Zeit und analysiert die verschiedenen Einflüsse von Latein, Italienisch und Französisch. Ein besonderer Fokus liegt auf der „Sprachmengerey“ und der damit verbundenen Kritik.
- Quote paper
- Angelika Felser (Author), 2017, Deutsche Sprachgeschichte des 17. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377987