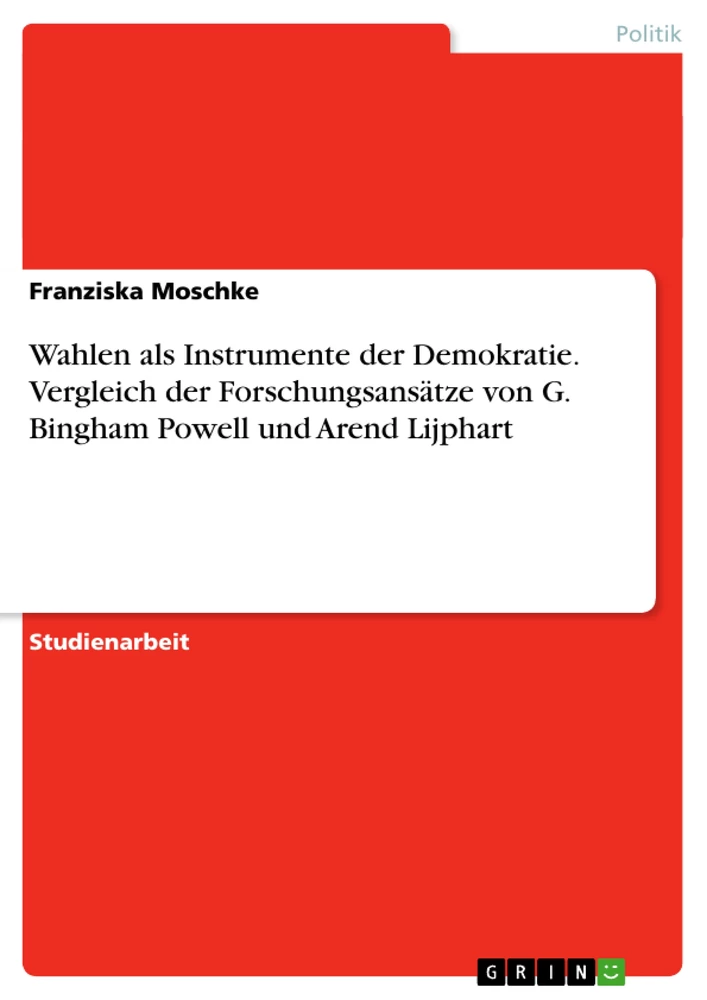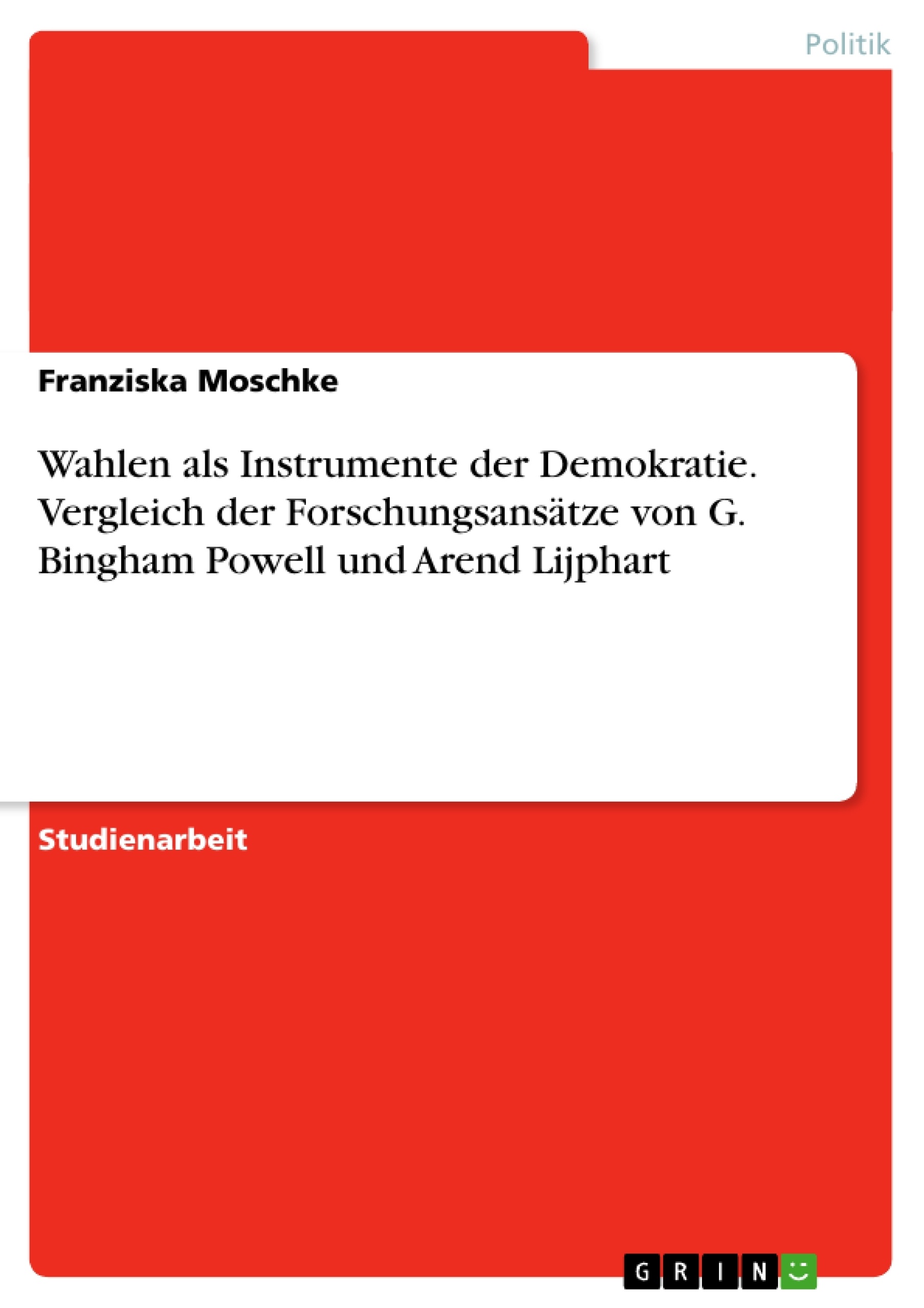Wahlen gelten in westlichen Demokratien zwar nicht als einzige, jedoch als entscheidende Möglichkeit für Bürger, Einfluss auf die Politik in ihrem Land zu nehmen. Sie garantieren einen „offenen Wettbewerb gesellschaftlicher Kräfte und politischer Gruppen.“1 Als bloße Technik gesehen können sie auch in nicht demokratischen Staaten abgehalten werden. Demokratische Wahlen unterscheiden sich jedoch durch zugrunde liegende normative Konzepte, die an die Wahlverfahren besondere Bedingungen knüpfen. Eine hauptsächliche Norm ist die, dass den Gewählten durch das formale Wahlverfahren eine für jeden ersichtliche Legitimation zukommt, politische Entscheidungen herbeizuführen. Diese Formalitäten oder auch die Modi des Wahlvorgangs können sehr unterschiedlich ausfallen, da die historisch, gesellschaftlich und ökonomisch unterschiedlich geprägten Demokratien jeweils andere Anforderungen an die Leistung ihrer Wahlsysteme stellen. Der Politikwissenschaft stellt sich dabei gerade im Hinblick auf neu entstehende Demokratien, die sich ein eigenes Wahlsystem schaffen, die Herausforderung, gewisse Gesetzmäßigkeiten für das Funktionieren von Wahlsystemen ausfindig zu machen und die Erkenntnisse bei der Konstituierung und Konsolidierung demokratischer Systeme zu nutzen. G. Bingham Powell und Arend Lijphart nutzen die Daten und Erfahrungen der seit längerem bestehenden westlichen Demokratien, um Wahlsysteme und ihre Auswirkungen auf bestimmte Faktoren zu untersuchen. In dieser Arbeit soll die unterschiedliche Herangehensweise der beiden Wissenschaftler an das Thema untersucht werden. Über die eher allgemeine Betrachtung von Wahlen und Wahlsystemen soll die Argumentation zur jeweils speziellen Zielsetzung und Vorgehensweise führen, um dann in der Synthese einen Vergleich der beiden Ansätze zu machen und die Besonderheiten bei den jeweiligen Untersuchungen herauszustellen. Da eine Gegenüberstellung der Gewichtung und Behandlung von detaillierten inhaltlichen Aspekten den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, beschränke ich mich auf die Prämissen, auf die Art und Weise, wie die Autoren die Untersuchung von Wahlsystemen vornehmen. 1 NOHLEN (2000), S. 25.
Inhaltsverzeichnis
- I EINLEITUNG
- II WAHLEN
- II.1 Demokratiekonzept und Konzept von Wahlen bei Powell
- II.2 Lijpharts Konzept von demokratischen Wahlen
- III WAHLSYSTEME
- III.1 Majorzprinzip
- III.2 Proporzprinzip
- III.3 Die Grundtypen von Wahlsystemen bei Powell
- III.3.1 Konzentration politischer Machtbefugnisse
- III.3.2 Verteilung politischer Machtbefugnisse
- III.4 Die Wahlsysteme bei Lijphart
- IV ZIELSETZUNG UND METHODE DER UNTERSUCHUNGEN
- IV.1 Powells Zielsetzung und Untersuchungsgegenstand
- IV.2 Powells Vorgehensweise
- IV.2.1 Die Dimension der Wahlregeln
- IV.2.2 Die Dimension der Arbeitsprinzipien in den Ausschüssen
- IV.2.3 Zusammenführung beider Dimensionen
- IV.4 Ziel der Analyse und Untersuchungsgegenstand bei Lijphart
- IV.5 Lijpharts Methode
- V. BESONDERHEITEN BEI POWELLS ANSATZ
- V.1 Das Kriterium der Verbindung zwischen Wähler und Politiker
- V.2 Der Blickwinkel des Wählers und der zeitliche Aspekt
- V.3 Bezug auf verschiedene theoretische Ansätze
- VI. BESONDERHEITEN BEI LIJPHARTS ANSATZ
- VII. VERGLEICH DER ANSÄTZE
- VII.1 Gegenstand der Analysen
- VII.2 Dimensionen oder Variablen
- VII.3 Ziel der Analysen
- VIII. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Forschungsansätzen von G. Bingham Powell und Arend Lijphart zur Rolle von Wahlen in demokratischen Systemen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Wissenschaftler, insbesondere hinsichtlich ihrer jeweiligen Zielsetzung, Vorgehensweise und Schwerpunkte in der Analyse von Wahlsystemen.
- Demokratiekonzepte und die Rolle von Wahlen
- Unterschiede in den Herangehensweisen von Powell und Lijphart
- Vergleich der Zielsetzung und Methoden der Untersuchungen
- Besonderheiten der Ansätze von Powell und Lijphart
- Zusammenfassende Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Zusammenfassung der Kapitel
- I Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wahlen als Instrumente der Demokratie ein und beleuchtet die Bedeutung von Wahlsystemen im Kontext demokratischer Prozesse. Sie stellt die beiden Forscher, Powell und Lijphart, vor und gibt einen Überblick über die Arbeit.
- II Wahlen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle von Wahlen in modernen Demokratien und erläutert das Demokratie- und Wahlkonzept von Powell und Lijphart.
- III Wahlsysteme: Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen Wahlsystemen und ihren Auswirkungen, insbesondere auf die Konzentration und Verteilung politischer Macht. Es werden die beiden Haupttypen (Majorz- und Proporzprinzip) sowie die Unterscheidung in Wahlsysteme bei Powell und Lijphart betrachtet.
- IV Zielsetzung und Methode der Untersuchungen: Dieses Kapitel untersucht die jeweilige Zielsetzung und Vorgehensweise der beiden Forscher bei der Analyse von Wahlsystemen. Es werden sowohl die Dimensionen der Untersuchung von Powell als auch die Methode von Lijphart erläutert.
- V Besonderheiten bei Powells Ansatz: Dieses Kapitel beleuchtet die besonderen Merkmale des Ansatzes von Powell, insbesondere die Verbindung zwischen Wähler und Politiker, den Blickwinkel des Wählers und den Bezug auf verschiedene theoretische Ansätze.
- VI Besonderheiten bei Lijpharts Ansatz: Dieses Kapitel beleuchtet die Besonderheiten des Ansatzes von Lijphart im Vergleich zu Powell.
- VII Vergleich der Ansätze: Dieses Kapitel bietet einen Vergleich der beiden Ansätze von Powell und Lijphart, insbesondere hinsichtlich Gegenstand, Dimensionen und Ziel der Analysen.
Schlüsselwörter
Demokratie, Wahlen, Wahlsysteme, Majorzprinzip, Proporzprinzip, G. Bingham Powell, Arend Lijphart, Zielsetzung, Methode, Vergleich, Forschungsansätze, Politikwissenschaft.
- Quote paper
- Franziska Moschke (Author), 2003, Wahlen als Instrumente der Demokratie. Vergleich der Forschungsansätze von G. Bingham Powell und Arend Lijphart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37794