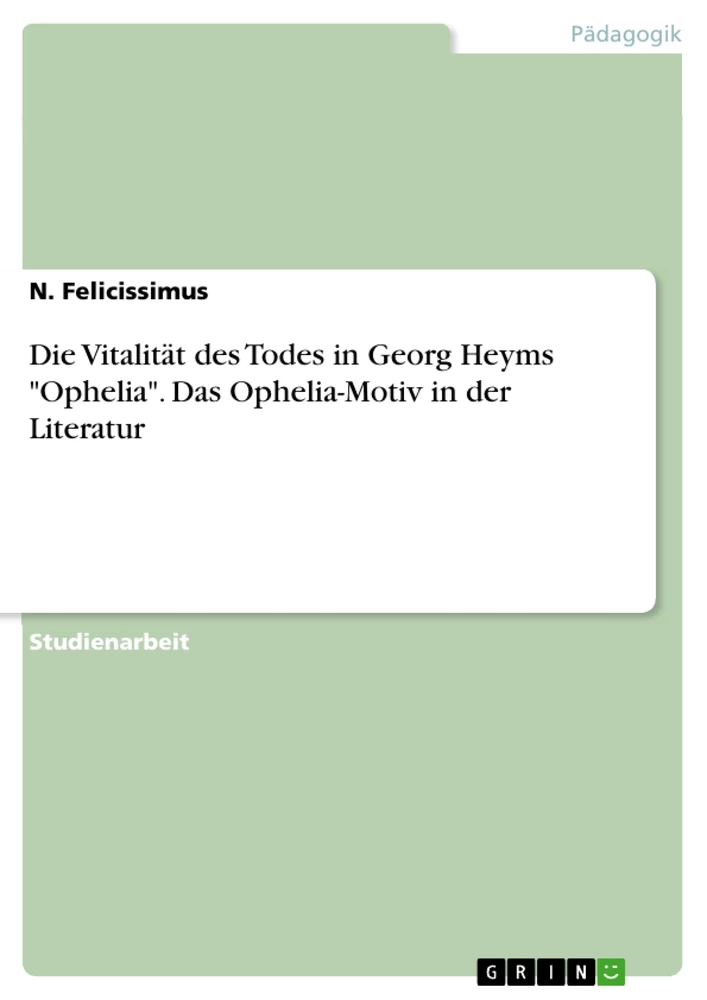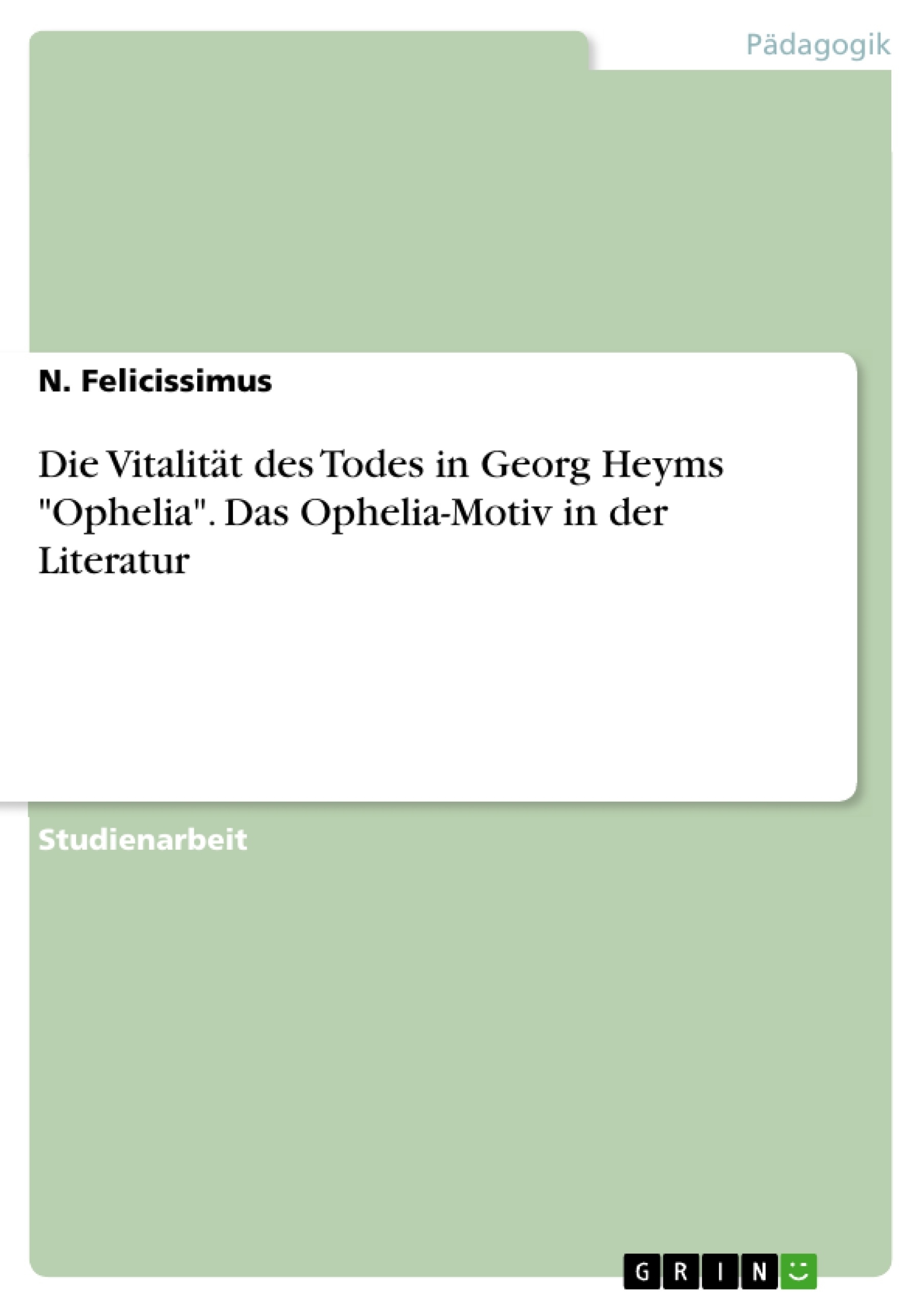„Heym liebte das Leben. Mit großer Alb-Angst zitterte er vor dem Aufhören. Aber er beneidete gleichwohl diejenigen, die aufgehört hatten.“ (Schneider, Heym, 2000)
Eine solche Einstellung gegenüber dem Leben gleichwie dem Tod ist typisch für Georg Heyms gesamtes Werk, das immer wieder die Gratwanderung zwischen diesen beiden Gegensätzen thematisiert. Auch sein Gedicht Ophelia 2 reflektiert diese Tendenz.
Ziel dieser Hausarbeit ist es, den Zustand des Todes unter dem Aspekt der Vitalität zu betrachten. Wird der Tod wirklich als etwas Abgeschlossenes und Trostloses dargestellt? Inwiefern schafft es Heym, die Tote Ophelia in eine Wechselwirkung mit der Natur treten zu lassen? Wird am Ende der Tod sogar als Wunschvorstellung angesehen, als ein Zustand, der im Gegensatz zum Leben als erstrebenswert gilt?
Zu diesem Zweck erscheint es sinnvoll, die Ophelia-Figur in ihrem literarischen Kontext zu sehen und Heyms Adaption mit Shakespearesches Ursprungstext zu vergleichen. Die Parallelen zu Rimbaud, welchen Heym überaus bewunderte, erscheinen auch inhaltlich von signifikanter Bedeutung, weswegen darauf im Folgen näher eingegangen wird.
Neben diesem literaturhistorischen Überblick liegt das Hauptaugenmerk natürlich auf Heyms Werk selbst und seiner Darstellung des Todes. Dafür ist die Gegenüberstellung von Natur und Stadt elementare Grundlage sowie die symbiotischen Verhältnisse, welche Ophelia mit der Natur eingeht. Dadurch soll die Lebhaftigkeit des Todes in den Vordergrund geschoben werden und die anfängliche These von einer morbiden Vitalität grundlegend stützen. Dass der Tod eine Wunschvorstellung ist, wird zuletzt mithilfe der Freudschen Triebtheorie sowie Tagebucheinträgen von Heym selbst beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2. Das Ophelia-Motiv in der Literatur
- 2.1 Die Ursprünge bei Shakespeare
- 2.2 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Rimbauds Adaption
- 2.3 Die Vitalität des Todes bei Heym
- 2.3.1 Gegenüberstellung von Natur und Stadt
- 2.3.2 Der Tod in Symbiose mit der Natur
- 2.3.3 Der Tod als Wunschvorstellung
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Georg Heyms Gedicht "Ophelia" unter dem Aspekt der Vitalität des Todes. Es wird analysiert, inwieweit Heym den Tod nicht als etwas Abgeschlossenes und Trostloses, sondern als dynamischen Zustand darstellt, der in Wechselwirkung mit der Natur steht und möglicherweise sogar als erstrebenswert angesehen wird. Die Arbeit vergleicht Heyms Adaption des Ophelia-Motivs mit Shakespeares Original und Rimbauds Interpretation.
- Der Vergleich des Ophelia-Motivs bei Shakespeare, Rimbaud und Heym.
- Die Darstellung des Todes als vitaler Zustand in Heyms Gedicht.
- Die Symbiose zwischen Ophelia und der Natur.
- Die Gegenüberstellung von Natur und Stadt in Heyms Werk.
- Der Tod als mögliche Wunschvorstellung.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung nach der Vitalität des Todes in Heyms Gedicht "Ophelia" vor. Sie erläutert das Ziel der Arbeit, das darin besteht, den Tod als dynamischen Zustand zu betrachten, der in Wechselwirkung mit der Natur steht und möglicherweise sogar als erstrebenswert angesehen wird. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz, der den Vergleich mit Shakespeares Original und Rimbauds Interpretation einschließt, und kündigt die Analyse der Gegenüberstellung von Natur und Stadt sowie die Betrachtung des Todes als Wunschvorstellung an. Die zentrale These der Arbeit wird eingeführt: Heym porträtiert den Tod nicht als statisch und negativ, sondern als einen Zustand mit einer besonderen, morbiden Vitalität.
2. Das Ophelia-Motiv in der Literatur: Dieses Kapitel analysiert das Ophelia-Motiv in seinem literarischen Kontext. Es beginnt mit einer Diskussion der Ursprünge bei Shakespeare, wobei Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Heyms Adaption herausgearbeitet werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung der Beziehung zwischen Ophelia und der Natur. Der Vergleich mit Rimbauds Interpretation des Motivs beleuchtet weitere Aspekte der Darstellung des Todes und der Natur. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse von Heyms Gedicht, indem es den literarischen Kontext und die Entwicklung des Motivs aufzeigt und die unterschiedlichen Perspektiven auf den Tod verdeutlicht. Die verschiedenen literarischen Ansätze zur Darstellung Ophelias werden verglichen und kontrastiert, um ein umfassendes Bild des Motivs zu liefern, das die Grundlage für die Analyse von Heyms Gedicht bildet.
Schlüsselwörter
Georg Heym, Ophelia, Tod, Vitalität, Natur, Stadt, Shakespeare, Rimbaud, Expressionismus, Symbolismus, Wunschvorstellung, Literaturvergleich.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Ophelia-Motivs bei Heym, Shakespeare und Rimbaud
Was ist das Thema dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert Georg Heyms Gedicht "Ophelia" und untersucht die Darstellung des Todes als vitalen und dynamischen Zustand, der in Wechselwirkung mit der Natur steht und möglicherweise sogar als erstrebenswert angesehen wird. Der Fokus liegt auf dem Vergleich mit Shakespeares Original und Rimbauds Interpretation.
Welche Aspekte werden in der Analyse von Heyms "Ophelia" betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf die Vitalität des Todes, die Symbiose zwischen Ophelia und der Natur, die Gegenüberstellung von Natur und Stadt, und die Möglichkeit des Todes als Wunschvorstellung. Die Arbeit vergleicht Heyms Interpretation des Ophelia-Motivs mit denen Shakespeares und Rimbauds.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel ("Das Ophelia-Motiv in der Literatur"), welches den Vergleich zwischen Shakespeare, Rimbaud und Heym beinhaltet, und ein Fazit. Das Hauptkapitel unterteilt sich weiter in Unterkapitel, die die Ursprünge bei Shakespeare, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Rimbauds Adaption und die Analyse der Vitalität des Todes bei Heym behandeln, einschließlich der Gegenüberstellung von Natur und Stadt sowie der Betrachtung des Todes als Wunschvorstellung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Georg Heym, Ophelia, Tod, Vitalität, Natur, Stadt, Shakespeare, Rimbaud, Expressionismus, Symbolismus, Wunschvorstellung, Literaturvergleich.
Welche Methode wird in dieser Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, indem sie Heyms "Ophelia" mit den Interpretationen des Motivs bei Shakespeare und Rimbaud vergleicht. Dies dient dazu, die Besonderheiten von Heyms Darstellung des Todes und dessen Beziehung zur Natur herauszuarbeiten.
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Die zentrale These ist, dass Heym den Tod nicht als statisch und negativ darstellt, sondern als einen Zustand mit einer besonderen, morbiden Vitalität, die eng mit der Natur verbunden ist.
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den drei Interpretationen des Ophelia-Motivs werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung Ophelias und des Todes in den Werken von Shakespeare, Rimbaud und Heym, mit besonderem Fokus auf die Beziehung zwischen Ophelia und der Natur und der Interpretation des Todes als vitaler oder statischer Zustand.
- Quote paper
- N. Felicissimus (Author), 2015, Die Vitalität des Todes in Georg Heyms "Ophelia". Das Ophelia-Motiv in der Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377800