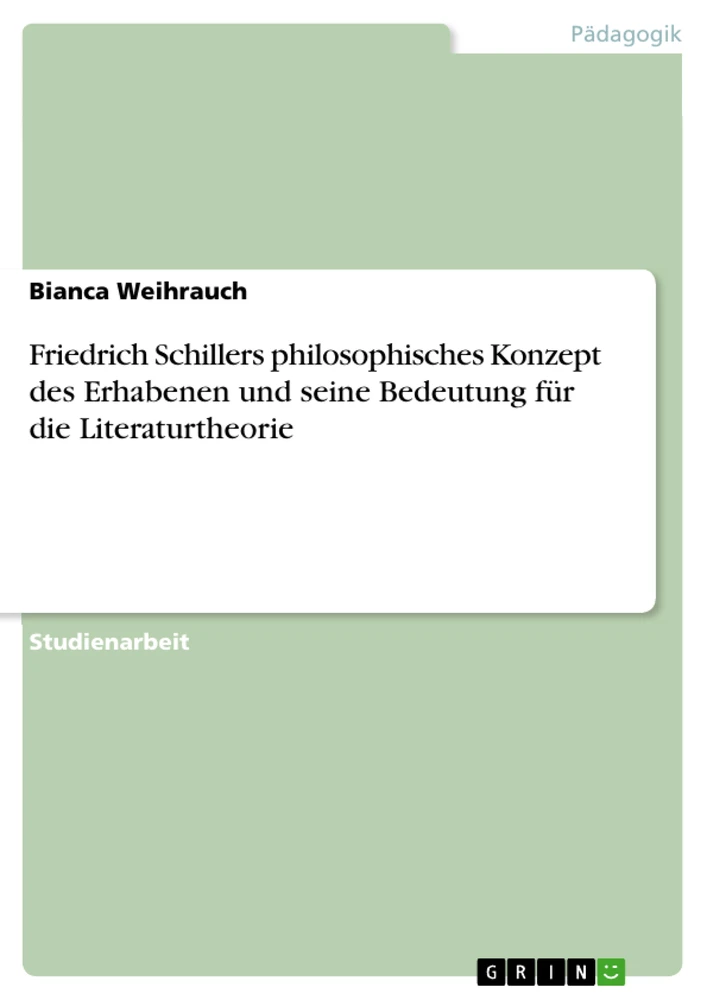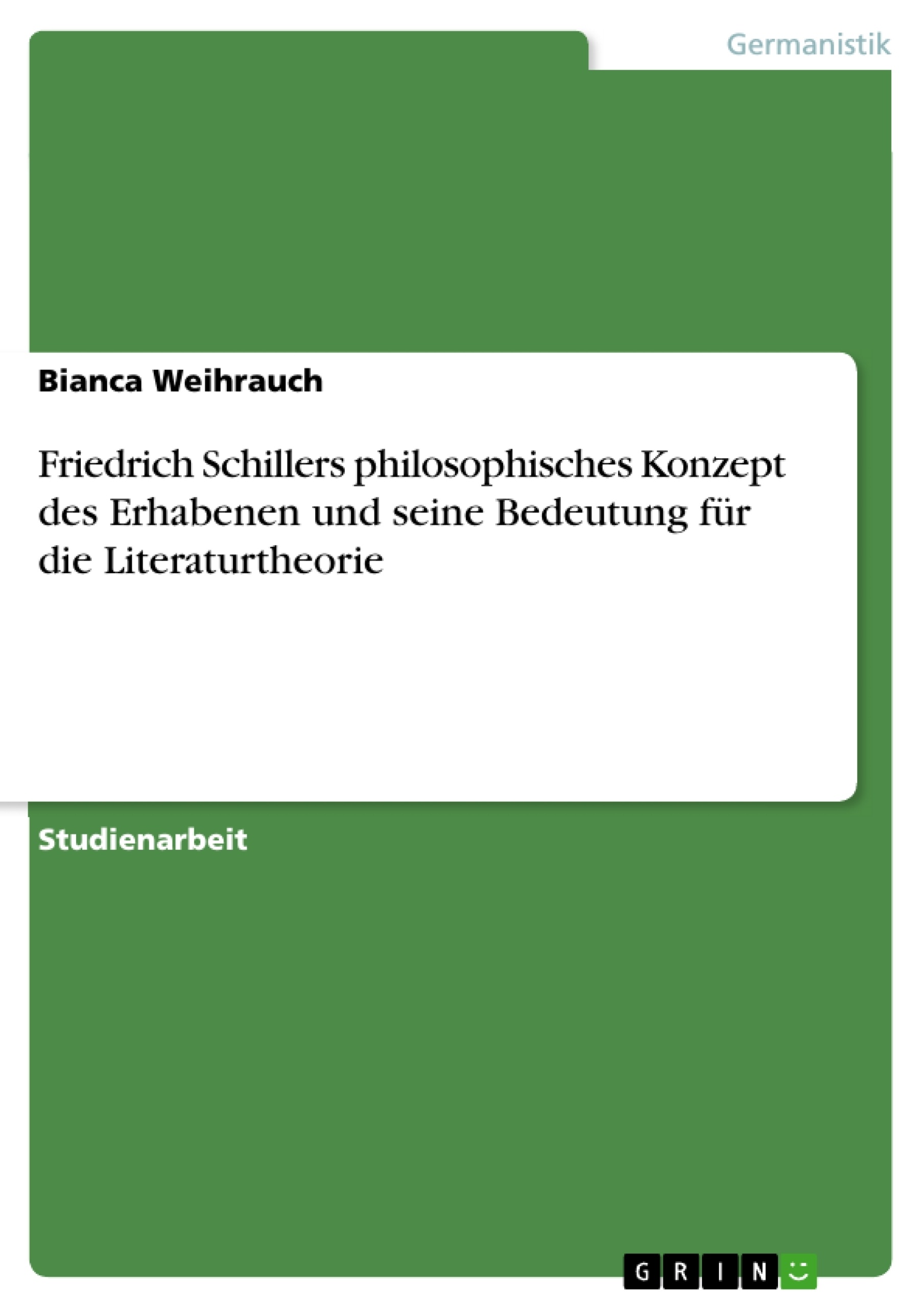Die Bedeutungsimplikationen, die mit dem Begriff des Erhabenen einhergehen, weisen im Kontext der Philosophie- und Literaturgeschichte eine Reihe von unterschiedlichen, sich oft auch widersprechenden Konnotationen auf, die seit der Antike immer wieder einen Funktions- und Bedeutungswandel unterlagen, beispielsweise hinsichtlich ihrer Rolle als rhetorischer oder ästhetischer Kategorie.
Ausgehend von dieser Vielschichtigkeit des Definitionsspektrums, wird zunächst eine kurze, dem Umfang der Arbeit entsprechende, etymologische Begriffsbestimmung von der Antike bis in die Gegenwart vorgenommen.
Im Anschluss soll durch die Analysen von Friedrich Schillers theoretischen Abhandlungen „Vom Erhabenen – Zur weitern Ausführung einiger kantischen Ideen“ , „Über das Pathetische“ und „Über das Erhabene“ erläutert werden, wodurch sich der Begriff des Erhabenen bei Schiller ausdrückt, welche Bedeutungsdivergenzen in den jeweiligen Texten vorzufinden sind und was dies für die Entwicklung seines dramaturgischen und tragödientheoretischen Konzeptes bedeutet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Erhabene und seine Bedeutung für die Literaturtheorie
- Die Definition des Erhabenen in Friedrich Schillers theoretischen Schriften
- Friedrich Schillers philosophisches Konzept des Erhabenen
- Das „Pathetische Erhabene“ und seine Rolle für Schillers Konzept der Dramentheorie - Die Schriften „Über das Pathetische“ und „Über das Erhabene“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung des Erhabenen in Friedrich Schillers theoretischen Werken. Die Arbeit analysiert Schillers Begriff des Erhabenen, seine Entwicklung und seinen Einfluss auf seine Dramentheorie. Sie beleuchtet die verschiedenen Facetten des Begriffs, seine Divergenzen und seine Bedeutung für die Tragödientheorie.
- Etymologische Entwicklung des Begriffs „Erhabenes“
- Schillers Rezeption und Interpretation des Erhabenen im Kontext der Kantischen Ästhetik
- Das „Pathetische Erhabene“ in Schillers Dramentheorie
- Bedeutungsdivergenzen des Begriffs in Schillers Schriften
- Einfluss des Erhabenen auf Schillers dramaturgisches und tragödientheoretisches Konzept
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die vielschichtigen und oft widersprüchlichen Konnotationen des Begriffs „Erhabenes“ in der Philosophie- und Literaturgeschichte. Sie skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit: eine kurze etymologische Begriffsbestimmung, gefolgt von einer Analyse von Schillers Schriften „Vom Erhabenen“, „Über das Pathetische“ und „Über das Erhabene“, um Schillers Verständnis des Erhabenen und dessen Einfluss auf seine Dramentheorie zu beleuchten. Der Schlussteil der Einleitung kündigt die Zusammenfassung der Ergebnisse im Fazit an.
Das Erhabene und seine Bedeutung für die Literaturtheorie: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung des Begriffs „Erhabenes“, beginnend bei Pseudo-Longinus, der den Begriff im Kontext der Rhetorik verwendete. Es zeigt die Transformation des Begriffs von einer rein rhetorischen Kategorie zu einer ästhetischen Kategorie, wie sie bei Burke und Kant zu finden ist. Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Perspektiven auf das Erhabene, von der rhetorischen Erhabenheit bis zu Kants Unterscheidung zwischen dynamischem und mathematischem Erhabenen, und erwähnt Lyotards gegensätzliche Interpretation.
Die Definition des Erhabenen in Friedrich Schillers theoretischen Schriften: Dieses Kapitel beschreibt Schillers Beschäftigung mit der Moral-Sense-Philosophie und den Schriften der Aufklärer, insbesondere Rousseau, Fichte und Kant, und deren Einfluss auf seine ästhetischen Konzepte. Es betont die zentrale Rolle von Kants „Kritik der Urteilskraft“ für Schillers Denken und die Bedeutung von Schillers eigenen theoretischen Schriften, besonders „Vom Erhabenen“, für das Verständnis seines Begriffs des Erhabenen.
Friedrich Schillers philosophisches Konzept des Erhabenen: Dieses Kapitel analysiert Schillers Schrift „Vom Erhabenen – Zur weiteren Ausführung einiger kantischen Ideen“ und die darin enthaltene Dichotomie zwischen Physis und Moralität. Es untersucht, wie Schiller das Erhabene in seinen Schriften definiert, welche Bedeutungsnuancen er verwendet und wie dies seine Dramentheorie beeinflusst. Der Fokus liegt auf der Synthese der verschiedenen Aspekte des Erhabenen in Schillers Werk, und nicht auf der einzelnen Analyse von Unterkapiteln.
Schlüsselwörter
Erhabenes, Sublimes, Friedrich Schiller, Dramentheorie, Tragödie, Ästhetik, Kant, Pathetisches, Moral-Sense-Philosophie, Rhetorik, Literaturtheorie.
Häufig gestellte Fragen zu: Seminararbeit über das Erhabene bei Friedrich Schiller
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Bedeutung des Erhabenen in Friedrich Schillers theoretischen Werken. Sie analysiert Schillers Begriff des Erhabenen, seine Entwicklung und seinen Einfluss auf seine Dramentheorie, beleuchtet verschiedene Facetten des Begriffs und seine Bedeutung für die Tragödientheorie.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die etymologische Entwicklung des Begriffs „Erhabenes“, Schillers Rezeption und Interpretation im Kontext der Kantischen Ästhetik, das „Pathetische Erhabene“ in Schillers Dramentheorie, Bedeutungsdivergenzen des Begriffs in Schillers Schriften und den Einfluss des Erhabenen auf Schillers dramaturgisches und tragödientheoretisches Konzept.
Welche Schriften Schillers werden analysiert?
Die Arbeit analysiert vor allem Schillers Schriften „Vom Erhabenen“, „Über das Pathetische“ und „Über das Erhabene“, um Schillers Verständnis des Erhabenen und dessen Einfluss auf seine Dramentheorie zu beleuchten.
Welche philosophischen Einflüsse werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt Schillers Beschäftigung mit der Moral-Sense-Philosophie und den Schriften der Aufklärer, insbesondere Rousseau, Fichte und Kant, und deren Einfluss auf seine ästhetischen Konzepte. Besonders Kants „Kritik der Urteilskraft“ spielt eine zentrale Rolle.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die die Thematik und den methodischen Ansatz beschreibt. Weitere Kapitel befassen sich mit der Bedeutung des Erhabenen in der Literaturtheorie, Schillers Definition des Erhabenen, seinem philosophischen Konzept des Erhabenen und einem Fazit. Die Kapitel enthalten Zusammenfassungen der Kernaussagen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Erhabenes, Sublimes, Friedrich Schiller, Dramentheorie, Tragödie, Ästhetik, Kant, Pathetisches, Moral-Sense-Philosophie, Rhetorik, Literaturtheorie.
Wie wird das „Pathetische Erhabene“ behandelt?
Das „Pathetische Erhabene“ spielt eine wichtige Rolle in der Analyse von Schillers Dramentheorie. Die Arbeit untersucht dessen Bedeutung in Schillers Schriften „Über das Pathetische“ und „Über das Erhabene“ im Kontext seiner Gesamtkonzeption des Erhabenen.
Welche methodische Vorgehensweise wird angewendet?
Die Arbeit beginnt mit einer kurzen etymologischen Begriffsbestimmung des "Erhabenen" und analysiert dann Schillers Schriften, um sein Verständnis und dessen Einfluss auf seine Dramentheorie zu beleuchten. Es wird eine Synthese der verschiedenen Aspekte des Erhabenen in Schillers Werk angestrebt.
Wie wird der Begriff „Erhabenes“ historisch eingeordnet?
Die Arbeit verfolgt die historische Entwicklung des Begriffs „Erhabenes“, ausgehend von Pseudo-Longinus bis hin zu Burke und Kant, und zeigt die Transformation des Begriffs von einer rein rhetorischen zu einer ästhetischen Kategorie. Sie berücksichtigt auch unterschiedliche Perspektiven auf das Erhabene.
- Citation du texte
- Bianca Weihrauch (Auteur), 2016, Friedrich Schillers philosophisches Konzept des Erhabenen und seine Bedeutung für die Literaturtheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377781