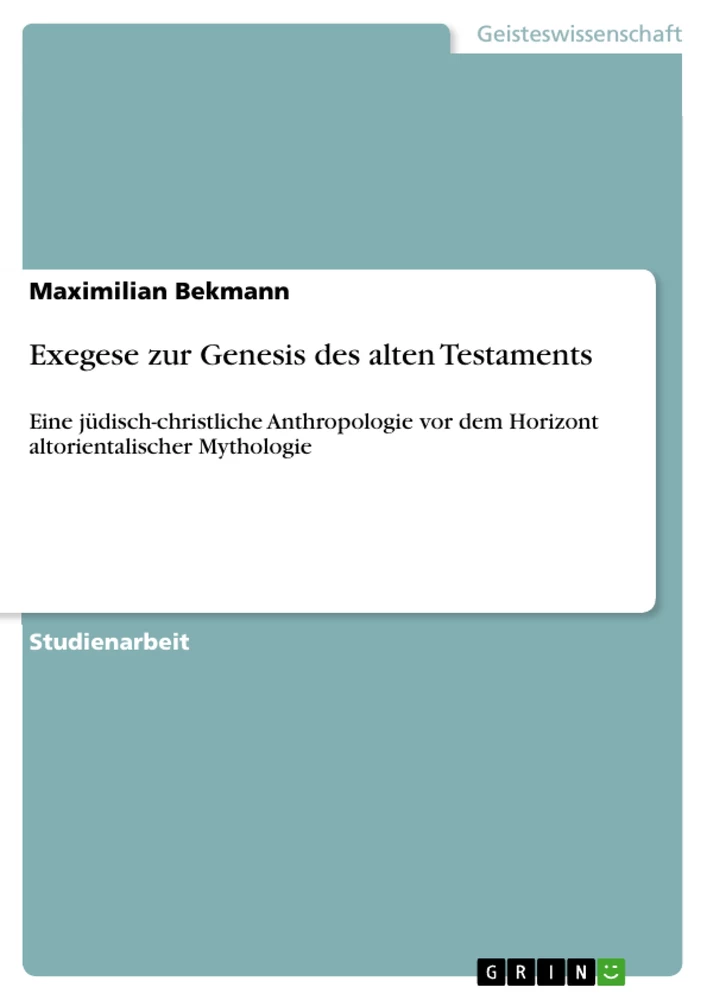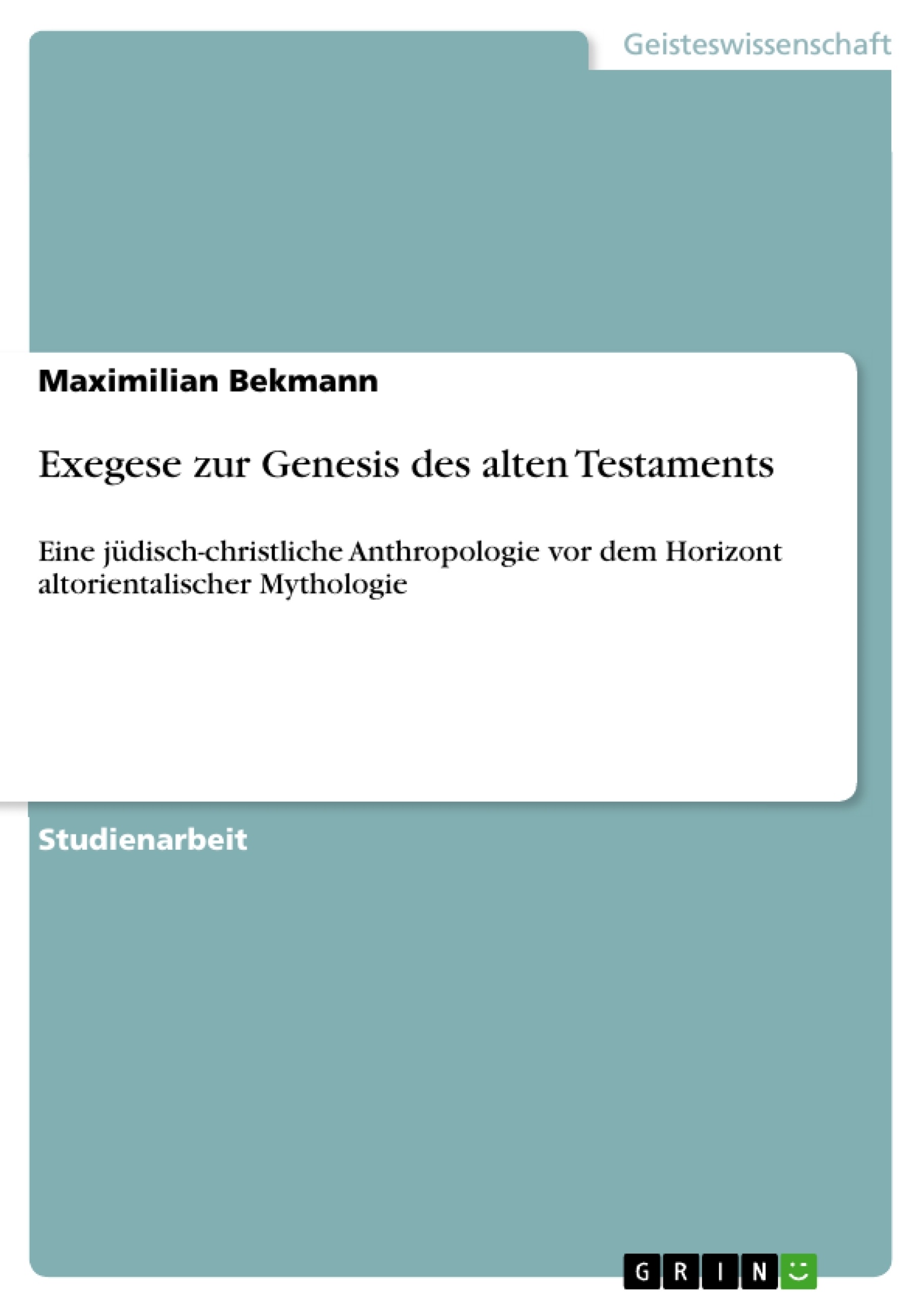Die Schöpfungs-Erzählungen der Genesis sind keine historischen Fakten, erheben aber dennoch Wahrheitsanspruch. Sie ist keine literarische Neuproduktion, sondern enthält Einflüsse der sie umgebenden Schöpfungsmythen des Alten Orient, zu denen sich einzelne Parallelen aufweisen lassen. Die Arbeit entfaltet eine jüdisch-christliche Anthropologie und geht dabei vergleichend auf die altorientalischen Schöpfungsmythen ein. Dabei wird versucht, die Genesis-Erzählung von der Erschaffung des Menschen in einen literarischen Kontext zu den Schöpfungsmythen zu bringen und dabei das Spezifikum einer jüdisch-christlichen Anthropologie hervorgehoben.
Sowohl der religiöse als auch der säkulare Mensch unserer Zeit hat eine Vorstellung vom Anfang allen Seins und der Welt, die er mit dem Begriff „Schöpfung“ umschreibt. Schöpfung – darin sind sich beide einig – bezeichnet die Totalität der Natur, insofern sie hervorgebracht und gestaltet wurde. Erst in einer weiteren Konkretisierung der Schöpfungsfrage in Form des „wie“, „wann“, „woraus“ und vor allem „durch wen“ weichen die Vorstellungen voneinander ab. Dabei wird oftmals die biblisch-theologische Deutung der Schöpfung der naturwissen-schaftlich-evolutiven Erklärung der Welt und des Kosmos gegenübergestellt und nicht selten gegeneinander ausgespielt. Dieser Gegensatz trifft weniger im europäischen als vielmehr im amerikanischen Raum zu, in dem sich einzelne evangelikale Freichristen wie etwa z.B. die Kreationisten durch ein wortwörtliches Rezipieren der biblischen Schöpfungsberichte von der durch Darvin entwickelten Evolutionslehre bewusst absetzen. Dabei handelt es sich jedoch um fundamentalistische Extrempositionen, die allein für sich stehen, jedoch einem rationalen Diskurs nicht standhalten und so der eigentlichen Aussageabsicht der biblischen Texte nicht gerecht werden können. Die naturwissenschaftlichen Erklärungen über die evolutive Entstehung der Arten ist nachgewiesen und daher unumstritten. Ihre Nachvollziehbarkeit ist für den heutigen Menschen der Moderne so selbstverständlich, dass sie die biblischen Schöpfungsberichte der Genesis als vorwissenschaftlich erscheinen lassen und nahezu in den Bereich der Märchen für Kinder oder der defizitären Vorstellungswelt naiver Menschen verorten.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Vorbemerkung: Vom Sinngehalt mythologischer Erzählungen
- 2.1 Die Schöpfungsberichte der Genesis und ihre Bezüge zur altorientalischen Mythologie
- 1.1 Der babylonische Schöpfungsepos „Enuma elisch“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Sinngehalt mythologischer Erzählungen, insbesondere die Schöpfungsberichte der Genesis, und deren Bezug zur altorientalischen Mythologie, speziell dem babylonischen Schöpfungsepos „Enuma elisch“. Ziel ist es, die unterschiedlichen Ebenen von „Wahrheit“ in mythischen und naturwissenschaftlichen Erklärungen der Weltentstehung aufzuzeigen und die Bedeutung mythologischer Erzählungen für das Verständnis des menschlichen Daseins herauszuarbeiten.
- Vergleich der Schöpfungsberichte der Genesis mit naturwissenschaftlichen Erklärungen
- Analyse der unterschiedlichen Gottesbilder in den Genesis-Berichten
- Untersuchung der literarischen und theologischen Aspekte der Genesis-Berichte
- Vergleich der Genesis-Berichte mit dem babylonischen Schöpfungsepos „Enuma elisch“
- Die Bedeutung mythologischer Erzählungen für das Verständnis des menschlichen Wesens
Zusammenfassung der Kapitel
0. Vorbemerkung: Vom Sinngehalt mythologischer Erzählungen: Diese Vorbemerkung stellt die Problematik des Vergleichs zwischen naturwissenschaftlichen und mythologischen Erklärungen der Weltentstehung dar. Sie argumentiert, dass naturwissenschaftliche Erklärungen zwar die Entstehung der Arten nachvollziehbar erklären, aber nicht alle Fragen des menschlichen Daseins beantworten können. Mythologische Erzählungen hingegen, wie die Schöpfungsberichte der Genesis, drücken Wahrheit auf einer metaphysisch-anthropologischen Ebene aus, indem sie Fragen nach Freiheit, Bösem und Schuld behandeln – Fragen, die die Naturwissenschaft nicht beantworten kann. Die Vorbemerkung betont die Bedeutung des "Warum" gegenüber dem "Wie" in mythischen Erzählungen und leitet zur Analyse der Genesis-Berichte und ihrer altorientalischen Parallelen über.
2.1 Die Schöpfungsberichte der Genesis und ihre Bezüge zur altorientalischen Mythologie: Dieses Kapitel analysiert die zwei Schöpfungsberichte in der Genesis. Der erste Bericht (Priesterschrift, Gen 1-2,4a) präsentiert ein souveränes, transzendentes Gottesbild, das die Welt durch sein Wort erschafft (creatio ex nihilo). Der zweite, ältere Bericht (Jahwist, Gen 2,4b-3,24) zeigt ein anthropomorphes Gottesbild, das aktiv in der Schöpfung tätig ist und mit seinen Geschöpfen interagiert. Der Fokus liegt auf der Schöpfung des ersten Menschenpaares und deren Lebenswelt (creatio continua). Die unterschiedlichen Gottesbilder und Erzählstrukturen der beiden Berichte werden detailliert beschrieben und verglichen. Das Kapitel legt den Grundstein für den anschließenden Vergleich mit dem babylonischen Schöpfungsepos.
1.1 Der babylonische Schöpfungsepos „Enuma elisch“: Dieser Abschnitt beschreibt den babylonischen Schöpfungsepos „Enuma elisch“, seine Entstehung und seinen kulturellen Kontext. Die sieben Tafeln des Epos werden kurz skizziert, wobei die zentralen Figuren Apsû und Tiâmat (Chaos-Prinzipien) sowie Marduk (Stadtgottheit Babylon) hervorgehoben werden. Der Epos beschreibt einen Götterkampf, der zur Ordnung der Welt führt und die Erschaffung der Erde und des Menschen nach sich zieht. Der Abschnitt betont die Bedeutung des Epos für das Verständnis der Genesis-Berichte und deren literarischen Parallelen. Die Ähnlichkeiten und Unterschiede zu den Genesis-Berichten werden angedeutet, um den folgenden Vergleich vorzubereiten.
Schlüsselwörter
Schöpfung, Genesis, altorientalische Mythologie, Enuma elisch, Gottesbild, creatio ex nihilo, creatio continua, Jahwist, Priesterschrift, Metaphysik, Anthropologie, Naturwissenschaft, Wahrheit, Freiheit, Böse, Schuld.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Vergleich der Schöpfungsberichte der Genesis mit dem babylonischen Schöpfungsepos "Enuma elisch"
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text analysiert die Schöpfungsberichte der Genesis und vergleicht sie mit dem babylonischen Schöpfungsepos "Enuma elisch". Er untersucht die unterschiedlichen Gottesbilder, Erzählstrukturen und die Bedeutung mythologischer Erzählungen im Vergleich zu naturwissenschaftlichen Erklärungen der Weltentstehung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind: Vergleich der Genesis-Berichte mit naturwissenschaftlichen Erklärungen, Analyse der unterschiedlichen Gottesbilder in der Genesis, Untersuchung der literarischen und theologischen Aspekte der Genesis-Berichte, Vergleich der Genesis-Berichte mit dem "Enuma elisch", und die Bedeutung mythologischer Erzählungen für das Verständnis des menschlichen Daseins.
Welche Schöpfungsberichte der Genesis werden untersucht?
Der Text analysiert die zwei Hauptberichte der Genesis: den ersten Bericht (Priesterschrift, Gen 1-2,4a) mit seinem transzendenten Gottesbild und die Schöpfung "ex nihilo", und den zweiten Bericht (Jahwist, Gen 2,4b-3,24) mit seinem anthropomorphen Gottesbild und der Schöpfung "creatio continua".
Wie wird das babylonische Schöpfungsepos "Enuma elisch" beschrieben?
Der Text beschreibt das "Enuma elisch", seine Entstehung und seinen kulturellen Kontext. Er skizziert die sieben Tafeln des Epos, hebt die zentralen Figuren Apsû und Tiâmat (Chaos-Prinzipien) sowie Marduk hervor und beschreibt den Götterkampf, der zur Ordnung der Welt führt.
Welchen Vergleich stellt der Text an?
Der Text vergleicht die Schöpfungsberichte der Genesis mit dem "Enuma elisch", um Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Gottesbildern, Erzählstrukturen und der Darstellung der Weltentstehung herauszuarbeiten. Er beleuchtet auch den Unterschied zwischen naturwissenschaftlichen und mythologischen Erklärungen der Weltentstehung.
Welche Bedeutung haben mythologische Erzählungen laut dem Text?
Der Text argumentiert, dass mythologische Erzählungen wie die Genesis-Berichte Wahrheit auf einer metaphysisch-anthropologischen Ebene ausdrücken, indem sie Fragen nach Freiheit, Bösem und Schuld behandeln – Fragen, die die Naturwissenschaft nicht beantworten kann. Sie liefern Antworten auf das "Warum", während die Naturwissenschaft das "Wie" erklärt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Schöpfung, Genesis, altorientalische Mythologie, Enuma elisch, Gottesbild, creatio ex nihilo, creatio continua, Jahwist, Priesterschrift, Metaphysik, Anthropologie, Naturwissenschaft, Wahrheit, Freiheit, Böse, Schuld.
Welche Kapitel sind im Text enthalten?
Der Text enthält eine Vorbemerkung zum Sinngehalt mythologischer Erzählungen, ein Kapitel über die Schöpfungsberichte der Genesis und ihre Bezüge zur altorientalischen Mythologie (inkl. einem Unterkapitel zum "Enuma elisch").
- Quote paper
- Maximilian Bekmann (Author), 2017, Exegese zur Genesis des alten Testaments, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377677