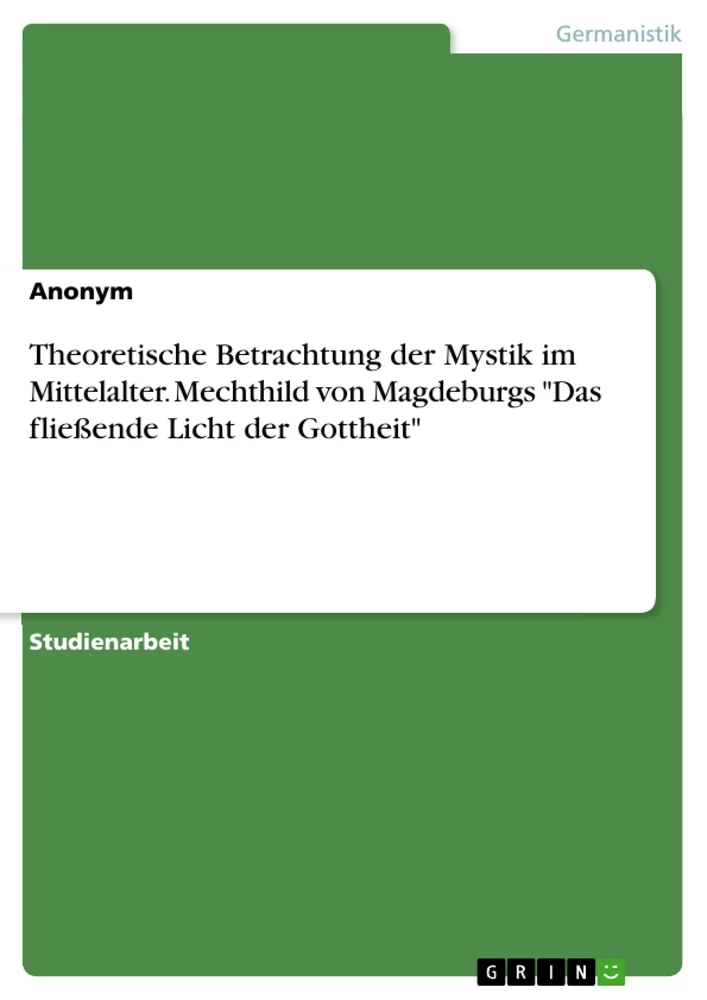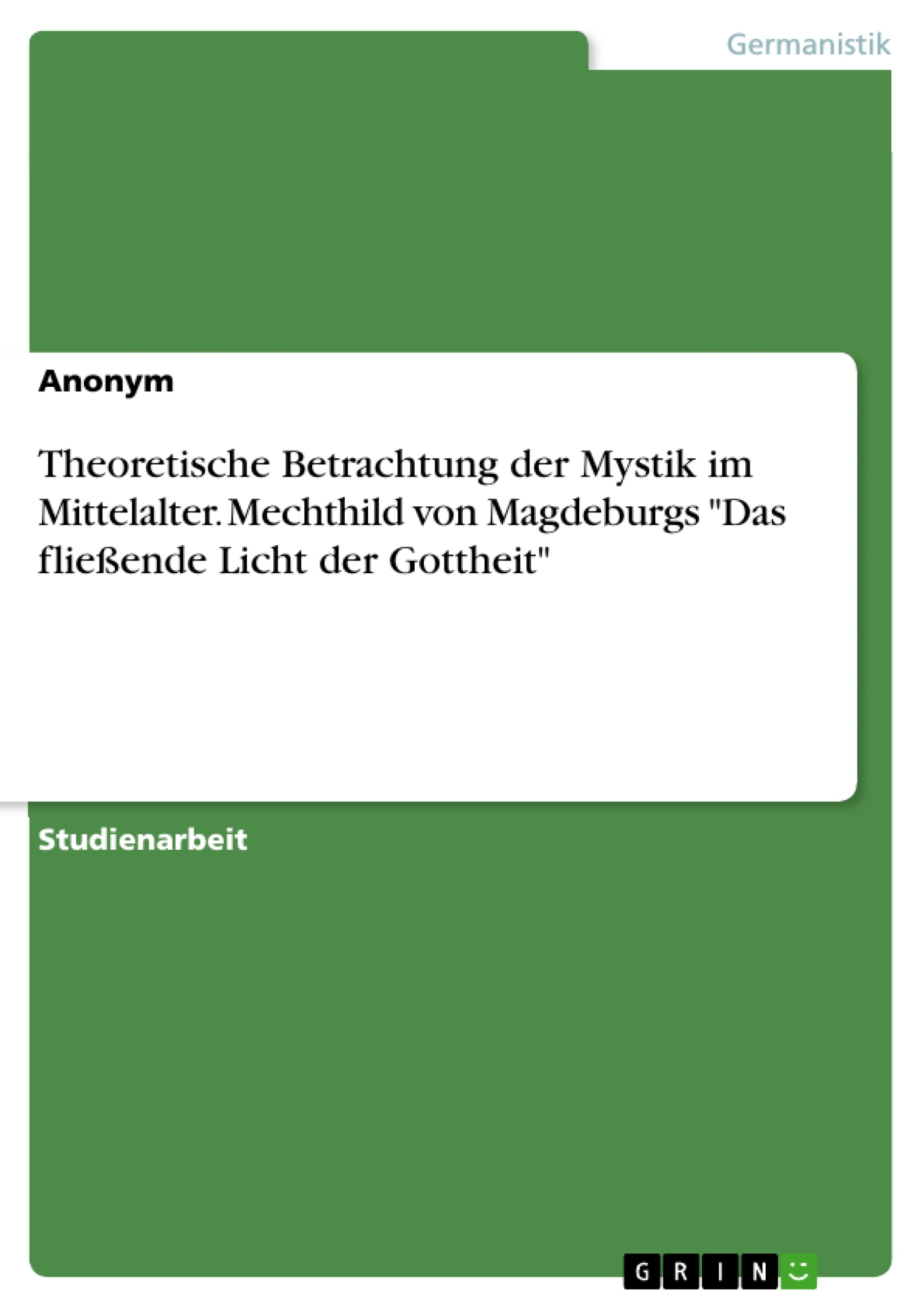Der Adel begann sich vom kulturellen Einfluss und der Dominanz des Klerus zu emanzipieren, denn nicht mehr nur die Heilsgeschichte und die Viten der Kirchenväter verdienten es, aufgezeichnet zu werden, sondern Heldensagen, Abenteuer der Ritter, der Artusrunde, Geschichten vom Untergang der Burgunden oder von Kämpfen gegen die Ungläubigen wurden für die Schrift entdeckt.
In dieser Zeit entwickelte sich die deutsche Sprache und mit ihr auch ihre Bestimmung, denn hatte sie bisher beim Adel nur der Erledigung von Verrichtungen gedient. Nun änderte sich ihre Bestimmung durch das wachsende Selbstbewusstsein in Haltung und Selbstverständnis des Adels. Die höfische Liebe, der Dienst an der Minnedame, und ihre Gesänge sollten an den adeligen Tafeln die Gäste erfreuen und die Taten ihresgleichen feiern.
Und dies sollte nicht mehr auf Latein, der Sprache der litterati, der Gelehrten, erfolgen, sondern in der Sprache, die die Laien, die illiterati, selbst sprachen und verstanden. Beide Schriftkulturen beeinflussen sich gegen-seitig in Form zweier unterschiedlicher sich überlagernder Kulturtypen. Bis 1200 entstand so eine Mischkultur, in der der volkssprachliche Part mehr und mehr die Schriftlichkeit annahm und mehr und mehr in Lebensbereiche vordrang, die bisher dem Lateinischen vorbehalten waren wie beispielsweise der Bereich des Rechts, der Bereich politisch-rechtlicher Vereinbarungen und der Bereich von Dichtung und Poesie.
Allerdings stellten deutsche Texte bis in das 16. Jahrhundert nur einen geringen Teil der gesamten Literaturproduktion dar, der gewichtigere Anteil wurde in Latein verfasst. Vor dem Hintergrund dieses Spannungsverhältnisses von Latein und Deutsch, von Schriftlichkeit und Mündlichkeit erscheint die mittelhochdeutsche Literatur von vornherein funktional bestimmt, denn jeder Text ist im Kontext seiner Überlieferungsgeschichte und seiner Vermittlungsrolle vom Autor an das Publikum zu verstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung: Literatur und Mystik im Mittelalter
- Ziel der Arbeit und Methodik
- Aspekte mittelalterlicher Mystik
- Mystik in christlicher Sicht
- Mystische Spiritualität und Fremdheitserfahrungen
- Das mittelalterliche Frauenbild und Frauenmystik
- Mechthild von Magdeburg und ihr Werk Das fließende Licht der Gottheit
- Entstehungsgeschichte und geschichtlicher Hintergrund
- Die Minnetexte Mechthilds
- Verständnishürden in der heutigen Zeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Werk „Das fließende Licht der Gottheit“ von Mechthild von Magdeburg, einem zentralen Vertreter der mittelalterlichen Mystik. Sie analysiert die Minnelyrik und das Frauenbild im Mittelalter im Kontext der mystischen Spiritualität. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung der deutschen Sprache und die Bedeutung von Literatur im Spannungsfeld von Latein und Volkssprache. Der Fokus liegt auf der Analyse der mystischen Erfahrungen, ihrer Ausdrucksformen und ihrer Bedeutung für die Zeit.
- Die Rolle der Mystik in der mittelalterlichen Gesellschaft
- Das Frauenbild im Mittelalter und die Rolle von Frauen in der Mystik
- Die Entwicklung der deutschen Sprache und die Bedeutung von Literatur
- Die Minnelyrik als Ausdruck mystischer Erfahrungen
- Die Interpretation von mystischen Texten im Kontext der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Problemstellung dar: die Entstehung der deutschen Sprache und die Bedeutung von Literatur im Mittelalter. Sie beschreibt die Situation des Adels und die Herausforderungen, die sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen lateinischer und deutscher Sprache ergeben. Die Arbeit stellt die These auf, dass die mittelhochdeutsche Literatur funktional bestimmt ist und im Kontext ihrer Überlieferungsgeschichte und ihrer Vermittlungsrolle vom Autor an das Publikum zu verstehen ist.
Aspekte mittelalterlicher Mystik
Dieses Kapitel beleuchtet die Mystik aus christlicher Sicht und untersucht die Rolle von mystischen Erfahrungen in der mittelalterlichen Gesellschaft. Es wird die Entstehung mystischer Spiritualität und die Besonderheiten der mittelalterlichen Frauenmystik betrachtet. Das Kapitel stellt die Bedeutung von Schlüsselerlebnissen für Mystiker dar und beleuchtet die Art und Weise, wie sie diese Erlebnisse verarbeiten und interpretieren.
Mechthild von Magdeburg und ihr Werk Das fließende Licht der Gottheit
Dieses Kapitel analysiert die Entstehungsgeschichte und den geschichtlichen Hintergrund des Werks „Das fließende Licht der Gottheit“. Es untersucht die Minnetexte Mechthilds und beleuchtet die Verständnishürden, die sich für heutige Leser ergeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der mittelalterlichen Mystik, der deutschen Sprachentwicklung, der Minnelyrik und dem Frauenbild im Mittelalter. Es werden die Werke von Mechthild von Magdeburg und andere mystische Texte analysiert, wobei die Begriffe wie mystische Erfahrungen, Spiritualität, Visionen, Minne, Sehnsucht und Gotteserfahrung im Vordergrund stehen. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Mystik im historischen Kontext und der Suche nach einer zeitgemäßen Rezeption dieser literarischen Tradition.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Theoretische Betrachtung der Mystik im Mittelalter. Mechthild von Magdeburgs "Das fließende Licht der Gottheit", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377539