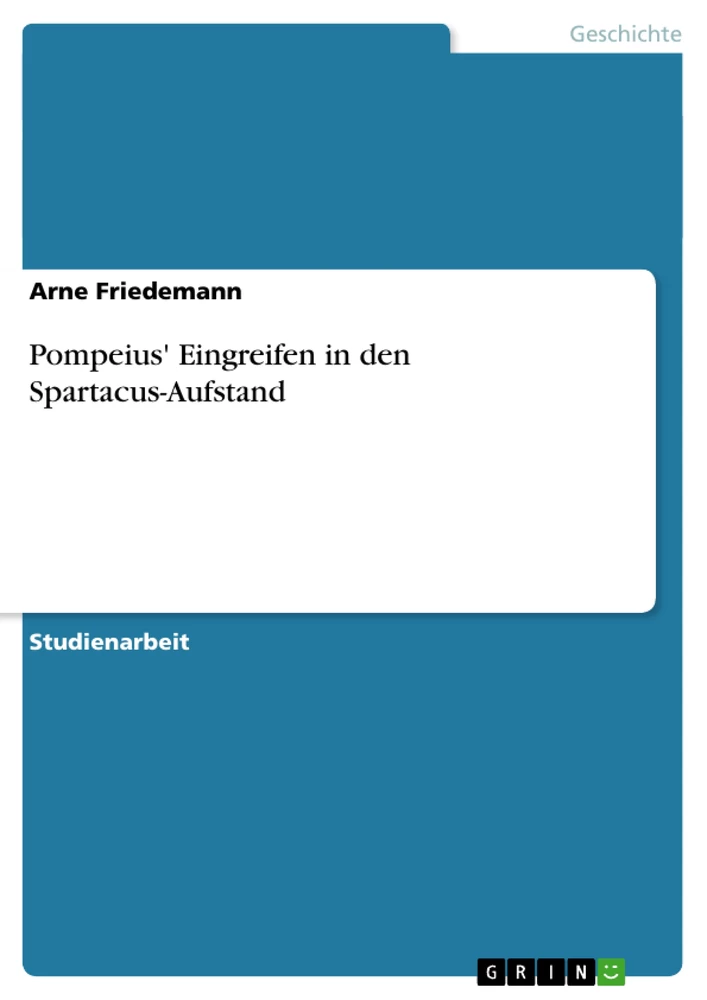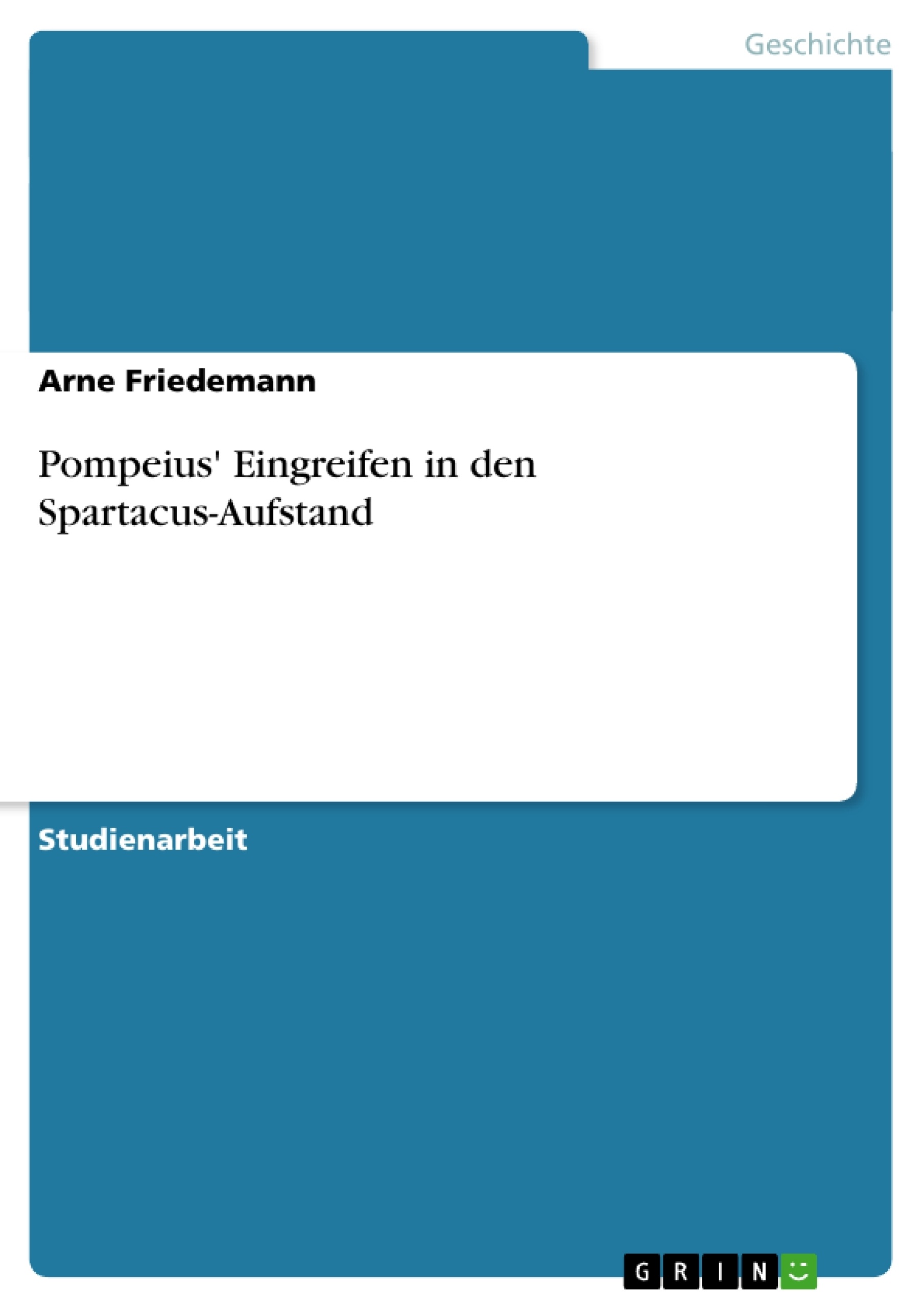In den 70er Jahren vor unserer Zeitrechnung wurde die römische Republik durch eine Reihe von Kriegen erschüttert. Zum einen hatte der frühere Proprätor Q. Sertorius in Spanien eine eigene Herrschaft errichtet, von der aus er seit 80 v. Chr. den römischen Staat bedrohte.1 Zum anderen waren auch die römischen Besitzungen in Kleinasien in Gefahr, wo im Herbst 74 ein neuer Krieg mit König Mithridates VI. von Pontus begonnen hatte.2 Diese beiden Konflikte banden bereits drei der angesehensten Feldherren der Republik – Q. Metellus Pius und Cn. Pompeius in Spanien, L. Licinius Lucullus in Kleinasien – als noch ein drittes Problem auftauchte. Denn zu allem Überfluss brach nun, im Jahre 73, in Süditalien ein Sklavenaufstand unter der Führung des thrakischen Gladiators Spartacus aus. Dieser Aufstand entwickelte sich mehr und mehr zum Flächenbrand und wurde schließlich zum gefährlichsten Sklavenkrieg in der römischen Geschichte.3 Nachdem bereits mehrere Proprätoren und dann die Konsuln des Jahres 72 anSpartacus' Sklavenheer gescheitert waren, trat im Herbst 72 ein neuer Mann auf den Plan: Marcus Licinius Crassus.4 Ausgestattet mit einem proconsularischen Imperium sowie acht Legionen gelang es Crassus, die Armee des Spartacus in die südöstliche Ecke Bruttiums zu drängen. Dort verfiel der neue Feldherr auf den Plan, die Sklaven mit Hilfe eines von Küste zu Küste reichenden Walles von jeglicher Versorgung abzuschneiden. Gleichzeitig machte eine verstärkte Bewachung der gegenüber liegenden Küste Siziliens ein Entweichen auf dem Seeweg unmöglich. Spartacus gelang es zwar noch, mit seinen Truppen den Wall zu durchbrechen (Januar 71). Doch Crassus' Armee nahm umgehend die Verfolgung auf und fügte den Sklaven schließlich im Norden Lucaniens die entscheidende Niederlage zu, in einer Schlacht, in der auch Spartacus ums Leben kam. [...] 1 RE IIa 2 (1923), 1747 ff., s.v. Q. Sertorius 3 (Schulten, Peter). 2 RE XV 2 (1932), 2181, s.v. Mithridates VI. Eupator Dionysos 12 (Münzer, Friedrich). 3 Onken, Björn, Spartacus, in: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, herausgegeben v. Hubert Cancik u. Helmuth Schneider (im Folgenden "DNP"), Bd. 11, Stuttgart und Weimar 2001, 795. 4 Die folgende Zusammenfassung des Aufstandes folgt der Darstellung M. Gelzers, in: RE XIII 1 (1926), 303 ff., s.v. M. Licinius Crassus Dives 68 (im Weiteren: "Gelzer, Crassus").
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Quellenwert
- 2. Quelleninhalt
- 3. Quellenkritik
- 4. Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, warum der römische Feldherr Gnaeus Pompeius im Jahr 71 v. Chr. in den Spartacus-Aufstand eingriff. Die Analyse konzentriert sich auf die Interpretation der Quelle "Bürgerkriege" von Appian, der den Sklavenaufstand in seinem Werk beschreibt.
- Analyse des Quellenwerts von Appians "Bürgerkriege"
- Rekonstruktion des Quelleninhalts bezüglich Pompeius' Eingreifen
- Kritik an Appians Darstellung und seiner Quellen
- Bewertung der Bedeutung von Pompeius' Eingreifen im Kontext des Spartacus-Aufstandes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den historischen Kontext des Spartacus-Aufstands dar, der die römische Republik in den 70er Jahren v. Chr. erschütterte. Der Aufstand unter der Führung des thrakischen Gladiators Spartacus stellte die römische Republik vor eine gewaltige Herausforderung und entwickelte sich zum gefährlichsten Sklavenkrieg der römischen Geschichte. Die Einleitung beschreibt auch die militärische Situation der Republik mit den gleichzeitigen Kriegen in Spanien und Kleinasien.
1. Quellenwert
Dieses Kapitel beleuchtet den Quellenwert von Appians Werk "Bürgerkriege" als Grundlage für die Analyse von Pompeius' Eingreifen im Spartacus-Aufstand. Appian, ein römischer Historiker, lebte im 2. Jahrhundert n. Chr. und stützte sich auf verschiedene Quellen für seine Darstellung des Spartacus-Aufstands. Die Arbeit diskutiert die Problematik der Sekundärquellen und die Bedeutung von Appians Werk als wichtige Informationsquelle für diese Epoche.
2. Quelleninhalt
Der Quelleninhalt konzentriert sich auf die Schilderung des Spartacus-Aufstands in Appians "Bürgerkriege". Insbesondere werden die Kapitel behandelt, die sich mit dem Kommando von Marcus Licinius Crassus befassen, dem Feldherrn, der zunächst die Hauptrolle im Kampf gegen die Sklaven spielte. Die Darstellung des Quelleninhalts beleuchtet den Kontext von Pompeius' Eingreifen in den Verlauf des Aufstandes.
3. Quellenkritik
Dieses Kapitel befasst sich mit der Quellenkritik von Appians Darstellung des Spartacus-Aufstands. Es werden die Stärken und Schwächen von Appians Arbeit diskutiert, insbesondere im Hinblick auf seine chronologischen Angaben und seine Einbeziehung sozialer und ökonomischer Faktoren. Die Arbeit analysiert auch die Frage, inwieweit Appians Interessenlage seine Schilderung des Spartacus-Aufstands beeinflusst hat.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Spartacus-Aufstand, Quellenkritik, Appian, Pompeius, Crassus, römische Republik, römische Geschichte, Sklavenaufstand, militärische Strategie, Historiografie.
- Quote paper
- Arne Friedemann (Author), 2004, Pompeius' Eingreifen in den Spartacus-Aufstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37751