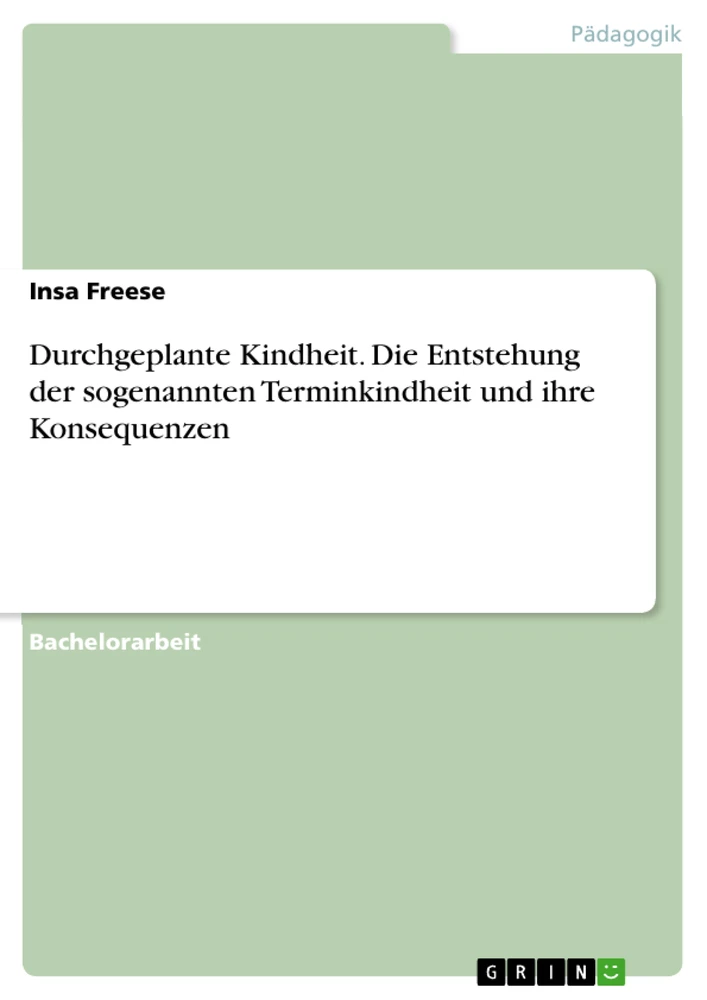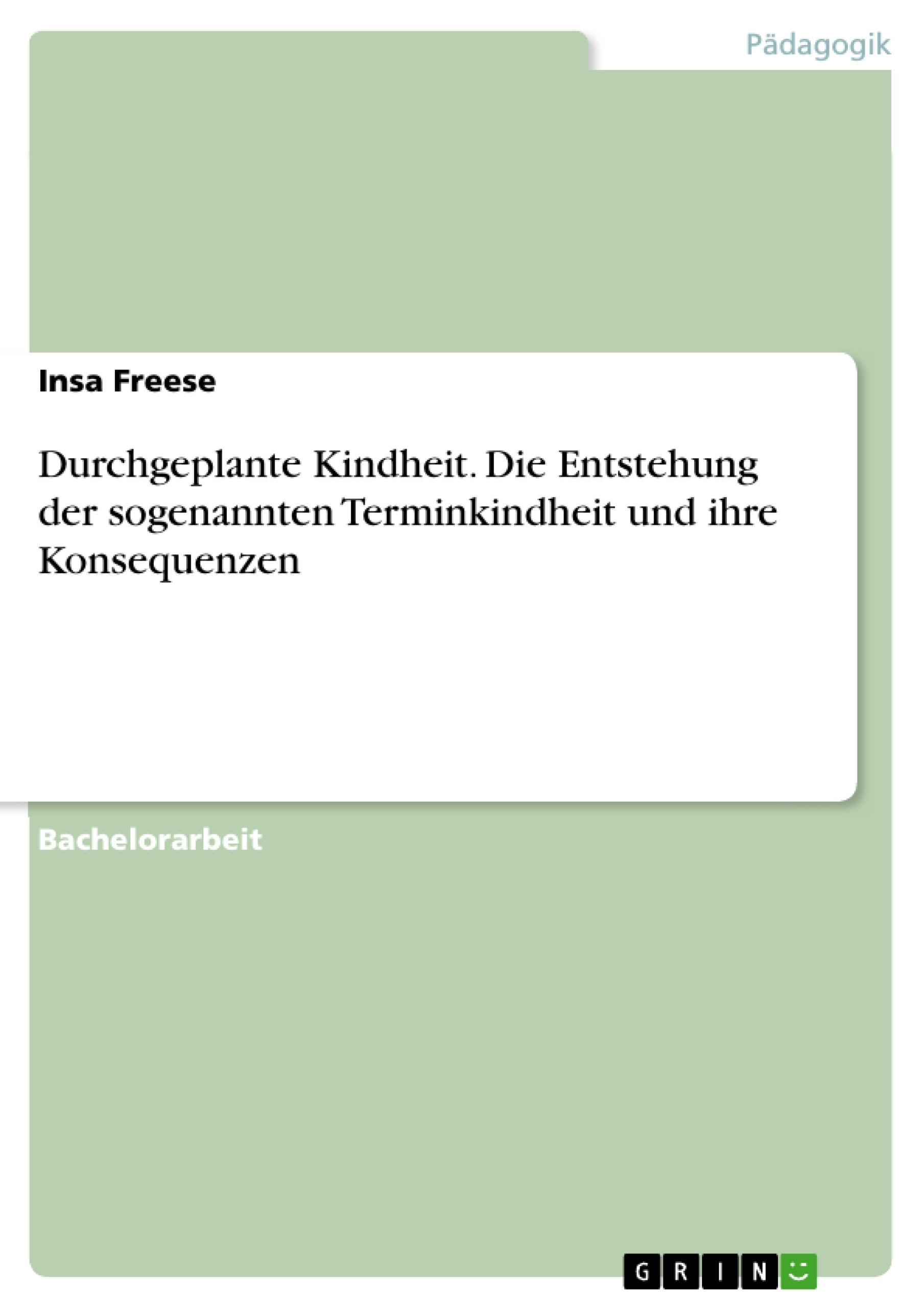Die Arbeit setzt sich mit den Folgen einer sich durch die historischen und gesellschaftlichen Einflüsse veränderten Konstruktion von Kindheit auseinander. Sie geht im Besonderen auf die Entstehung der sogenannten Terminkindheit ein. Welchem Druck unterliegen Kinder in ihrer heutigen durchgeplanten / verplanten Kindheit und welche Rolle spielt hierbei die elterliche Sorge?
Zudem ist es in diesem Rahmen sinnvoll, die Intentionen der Eltern und der Gesellschaft zu beleuchten, welche zu einer solch intensiven und verschachtelten Nutzung von Zeit und zu einer Verdichtung von Freizeitangeboten geführt haben. Liegen diese Intentionen noch in einem eigentlichen Bestreben, Freizeit sinnvoll nutzen zu können oder auf außerfamiliäre Betreuungsangebote zurückzugreifen? Oder ist eine tendenzielle Verlagerung zu Aspekten der Leistungs- und Zusatzförderung beobachtbar?
Wann entstand der Begriff Terminkindheit und sind mögliche Konsequenzen oder Risiken und Chancen heute schon ersichtlich beziehungsweise analysierbar? Ich werde die Entstehung der Kindheit aus ihrem historischen Kontext herleiten, um den Begriff der Terminkindheit zu skizzieren und mich mit den gesellschaftlichen Veränderungen und Anforderungen auseinandersetzen. Zudem werde ich kurz auf Aspekte bezüglich des Verständnisses und des Umgangs mit Zeitstrukturen und der Fähigkeit zur Fragmentierung von Zeit im Kindesalter eingehen und mögliche Schwierigkeiten der Kohärenz zur Terminkindheit ableiten. In einer abschließenden Betrachtung in der Gegenwart gehe ich auf mögliche, mittlerweile beobachtbare Konsequenzen oder Risiken für Kinder ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Kind
- Der Begriff Kind
- Der Begriff kindgerecht
- Die historische Entstehung der Kindheit
- Vom Mittelalter in die Gegenwart
- Der kleine Erwachsene
- Die Trennung des Kindes vom Erwachsenen
- Das unschuldige Kind
- Die Idee von der Menschlichkeit des Menschen
- Die Theorie der Kindheit
- Die Autonomie des Kindes
- Das Jahrhundert der Kindheit
- Kindheit in der Moderne
- Industrialisierung und Fortschritt
- Kindheit und Nationalsozialismus
- Wirtschaftswunder und Modernisierungsschub
- Von der Verhäuslichung zur Verinselung
- Wandel der Kindheit
- Vom Mittelalter in die Gegenwart
- Von der Verinselung zur Verplanung
- Die Pädagogisierung der Kindheit
- Die Entstehung der Terminkindheit
- Kindheit als natürliche Entwicklungsphase
- Kindheit als Konstrukt
- Merkmale „neuer“ Kindheit
- Der Einfluss der Postmoderne
- Der Verlust des Schonraumes
- Sozialisationswirkungen der Terminkindheit
- Das Spiel der Kindheit mit der Zeit
- Kindheit fremdbestimmt – selbstbestimmt
- Chancen und Risiken einer veränderten Konstruktion von Kindheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung der „Terminkindheit“ und deren möglichen Konsequenzen. Sie untersucht den Wandel der Konstruktion von Kindheit im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und die Herausforderungen, denen Kinder in ihrer durchgeplanten Lebensphase gegenüberstehen. Die Analyse betrachtet die Rolle elterlicher Sorge und gesellschaftlicher Intentionen in der Entwicklung der Terminkindheit und hinterfragt, inwieweit die intensive Nutzung von Zeit und die Verdichtung von Freizeitangeboten dem eigentlichen Bestreben nach sinnvoller Freizeitgestaltung oder der Leistungs- und Zusatzförderung dienen.
- Die historische Entwicklung des Konstrukts „Kindheit“
- Die Entstehung der „Terminkindheit“
- Die Auswirkungen der Terminkindheit auf die kindliche Entwicklung
- Die Rolle elterlicher Sorge und gesellschaftlicher Intentionen
- Mögliche Konsequenzen und Risiken der Terminkindheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Wandel der Kindheit als ein anhaltendes Phänomen und führt die Bedeutung der Terminkindheit in den heutigen gesellschaftlichen Kontext ein. Kapitel 1 beleuchtet den Begriff des Kindes und den Wandel des Konstrukts "Kindheit" in der Geschichte. Es werden wichtige Stationen der historischen Entwicklung der Kindheit von der Antike bis zur Gegenwart erläutert, wobei auf die Entstehung des „unsündigen Kindes“ und die Trennung vom Erwachsenen eingegangen wird. Kapitel 2 analysiert die Auswirkungen der Industrialisierung, des Nationalsozialismus und des Wirtschaftswunders auf die Konstruktion von Kindheit und untersucht den Wandel von der Verhäuslichung zur Verinselung. Kapitel 3 beleuchtet die Pädagogisierung der Kindheit und die Entstehung der Terminkindheit. Es wird auf die Konstruktionen der Kindheit als natürliche Entwicklungsphase sowie als Konstrukt eingegangen. Kapitel 4 untersucht die „neuen“ Merkmale der Terminkindheit, darunter der Einfluss der Postmoderne, der Verlust des Schonraumes und die Sozialisationswirkungen. Es wird auch auf die Bedeutung der zeitlichen Struktur und die Fragmentierung von Zeit im Kindesalter eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit setzt sich mit den Schlüsselbegriffen „Kindheit“, „Terminkindheit“, „Sozialisation“, „Zeitstruktur“, „Fragmentierung“, „Leistungsförderung“, „Elternrolle“ und „gesellschaftliche Intentionen“ auseinander. Sie untersucht die Entstehung und die Auswirkungen der Terminkindheit im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen, die die Konstruktion von Kindheit und die kindliche Entwicklung beeinflussen.
- Quote paper
- Insa Freese (Author), 2012, Durchgeplante Kindheit. Die Entstehung der sogenannten Terminkindheit und ihre Konsequenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/377239