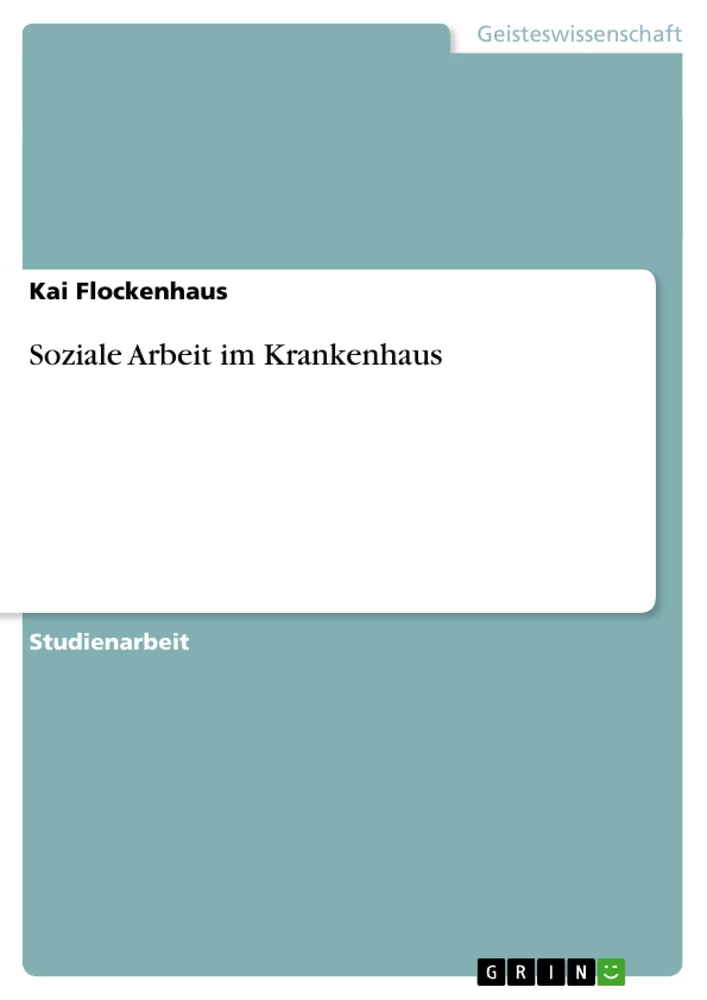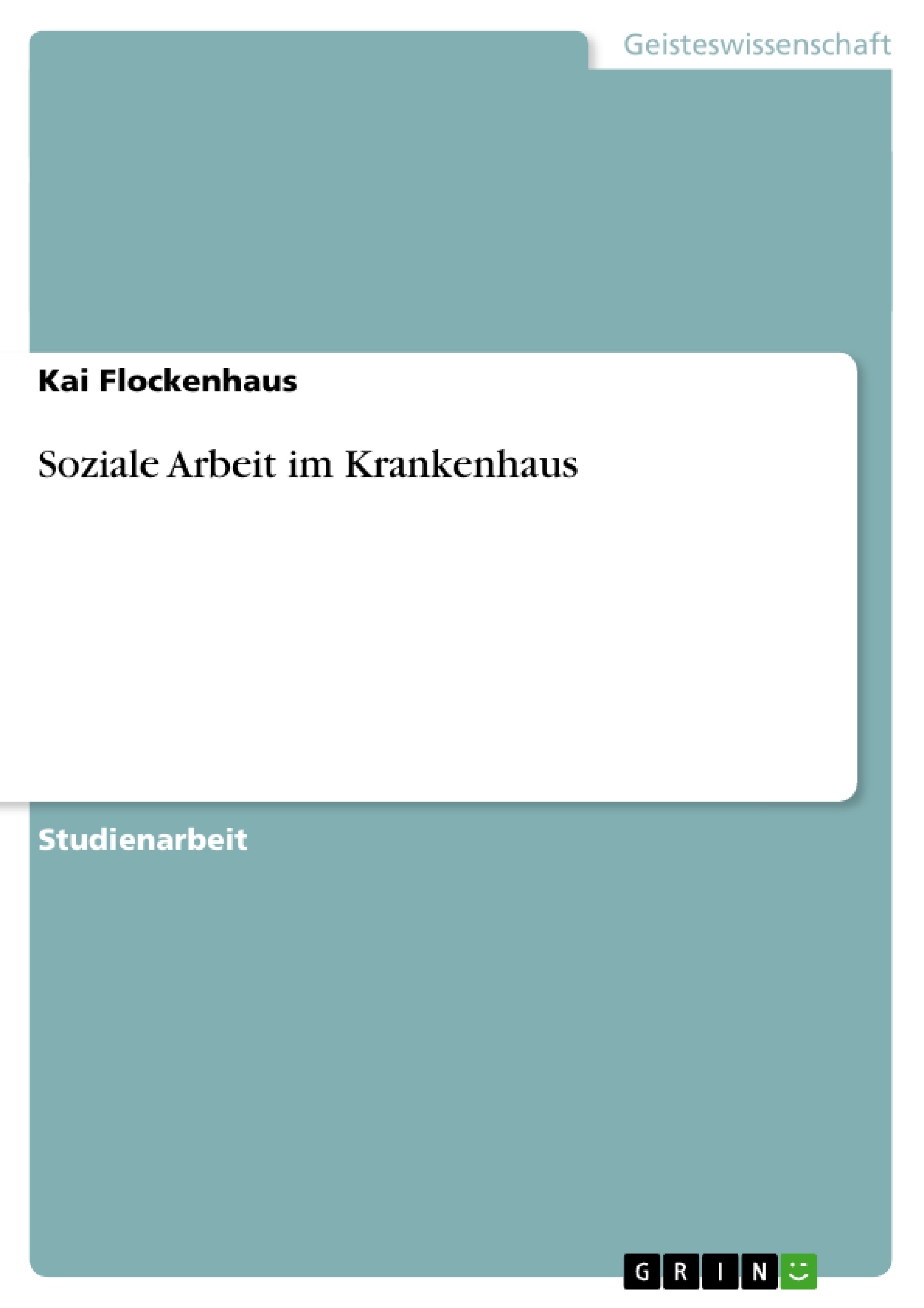Während meines ersten pflegerischen Praktikums in der Kinderklinik des Helios – Klinikum in Schwelm durfte ich einen Einblick in den
Krankenhausalltag und somit in zahlreiche Bereiche erhalten. Leider kam es aus verschiedenen Gründen nicht zu einem Treffen mit der hausangestellten Sozialarbeiterin, womit mir ein tieferer Einblick in ihren Tätigkeitsbereich leider verwehrt blieb. Mit dem Seminarangebot „Gesundheitswesen“ sehe ich meine Chance dieses Arbeitsfeld nachträglich zu erforschen und mir somit zusätzliches Wissen neben den Erfahrungen der Praktikumszeit anzueignen. Im Bereich des Gesundheitswesens bestehen viele Tätigkeitsbereiche. Die Soziale Arbeit im Krankenhaus stellt einen Teil davon da. Der klinische Aufenthalt ist oft mit schwerwiegenden körperlichen, seelischen oder sozialen Beeinträchtigungen verbunden. Aufgrund dessen besteht hier ein Handlungsfeld für die Sozialarbeit. Diese ist in den Krankenhäusern unter anderem ein wichtiger Bestandteil der ganzzeitlichen Patientenbetreuung geworden. Meine Seminararbeit soll den Teilbereich „klinische Sozialarbeit“ erforschen und einen dem Umfang angemessenen Einblick geben. Es soll zunächst der Bezug zwischen Krankheit auf der einen Seite soziale Arbeit auf der anderen Seite hergestellt werden. Dies ermöglicht eine bessere Darstellung der Tätigkeitsfelder und eine konkrete Bezugnahme auf Beiträge zur Krankheitsbewältigung.1 1 Vgl. Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 11
Inhaltsverzeichnis
1. Persönlicher Zugang
2. Einleitung
3. In welchem Bezug stehen Krankheit und Soziale Arbeit zueinander und wie wichtig ist die klinische Sozialarbeit?
4. Darstellung des Arbeitsfeldes
4.1. Tätigkeitsprofil
4.2. Methodische Ansätze
4.2.1. Soziale Beratung
4.2.2. Case - Management
4.3. Situationsanalyse
5. Handlungsfelder
5.1. Sozialarbeit in Rehabilitationskliniken
5.2. Sozialarbeit in Psychiatrieform
6. Resümee
Literaturverzeichnis
1. Persönlicher Zugang
Während meines ersten pflegerischen Praktikums in der Kinderklinik des
Helios – Klinikum in Schwelm durfte ich einen Einblick in den Krankenhausalltag und somit in zahlreiche Bereiche erhalten.
Leider kam es aus verschiedenen Gründen nicht zu einem Treffen mit der hausangestellten Sozialarbeiterin, womit mir ein tieferer Einblick in ihren Tätigkeitsbereich leider verwehrt blieb.
Mit dem Seminarangebot „Gesundheitswesen“ sehe ich meine Chance dieses Arbeitsfeld nachträglich zu erforschen und mir somit zusätzliches Wissen neben den Erfahrungen der Praktikumszeit anzueignen.
2. Einleitung
Im Bereich des Gesundheitswesens bestehen viele Tätigkeitsbereiche. Die Soziale Arbeit im Krankenhaus stellt einen Teil davon da.
Der klinische Aufenthalt ist oft mit schwerwiegenden körperlichen, seelischen oder sozialen Beeinträchtigungen verbunden. Aufgrund dessen besteht hier ein Handlungsfeld für die Sozialarbeit.
Diese ist in den Krankenhäusern unter anderem ein wichtiger Bestandteil der ganzzeitlichen Patientenbetreuung geworden.
Meine Seminararbeit soll den Teilbereich „klinische Sozialarbeit“ erforschen und einen dem Umfang angemessenen Einblick geben.
Es soll zunächst der Bezug zwischen Krankheit auf der einen Seite soziale Arbeit auf der anderen Seite hergestellt werden. Dies ermöglicht eine bessere Darstellung der Tätigkeitsfelder und eine konkrete Bezugnahme auf Beiträge zur Krankheitsbewältigung.[1]
3. In welchem Bezug stehen Krankheit und Soziale Arbeit zueinander und wie wichtig ist die klinische Sozialarbeit?
Selbstverständlich ist die Soziale Arbeit mit Patienten nicht bei jeder stationären Behandlung notwendig. Vielmehr spielt sie bei Krankheiten eine Rolle, die komplikationsreich und mit sozialen Konsequenzen verbunden sind, da letztere Situationen den Heilungsprozess beeinflussen.[2] Leidet ein Patient beispielsweise an einer chronischen Erkrankung, so ist es für den Heilungsverlauf von enormer Bedeutung, dass dem Hilfebedürftigen neben den heilenden Maßnahmen auch persönliche Hilfen zur Krankheitsbewältigung entgegengebracht werden. Ansen macht dies mit folgendem Satz deutlich: „Für die Soziale Arbeit sind die sozialen, ökonomischen, und psychischen Implikationen von Krankheiten relevant, um ein fachlich angemessenes Verständnis zu entwickeln und geeignete Interventionen planen und durchführen zu können.“[3] Zudem folgt ein Hinweis darauf, dass zwischen der objektiven Krankheit (disease) und der subjektiven Krankheit (illness) unterschieden werden muss.
Ansen differenziert somit strikt Krankheit und Kranksein. „Für den Patienten ist die Krankheit immer eine gelebte Erfahrung, während der Arzt dem Bericht des Patienten über seine Krankheit entnimmt, dass hier wahrscheinlich ein medizinisches Problem vorliegt, das einer biologischen Erklärung bedarf (Morris 2000).“[4] Für die sozialarbeiterischen Tätigkeiten muss explizit das subjektive Krankheitserleben berücksichtigt werden. Es ist somit unerlässlich, dass die zuständigen SozialarbeiterInnen über ein vertieftes Wissen von Krankheit und ein verstärktes Verständnis von Gesundheit verfügen, um angemessene und wirkungsvolle Interventionsmaßnahmen anzuwenden.[5]
Meiner Meinung nach verdeutlicht der Autor H. Pauls die Wichtigkeit der klinischen Sozialarbeit mit folgendem Satz: „Die Gesellschaft wird niemals mit Medikamenten ausgleichen können, was an Störungen und Problemen aus Mangel an sozialer Zuwendung und psycho-sozialem Wohlbefinden entsteht.“[6] Dies macht in meinen Augen deutlich, wie wichtig die Soziale Arbeit mit Patienten ist. Doch Pauls geht weiter indem er Melchinger zitiert und somit auf eine groß angelegte Untersuchung der Krankenkassen von 1999 aufmerksam macht, in der nachgewiesen wurde, dass sich aus ökonomischer Sicht eine klinische Sozialarbeit durchaus rentiert.[7] Pauls belegt dies mit einer Summe aus der genannten Studie: „Es wurden durchschnittlich ca. DM 25.000,- pro Patient eingespart gegenüber der Vergleichsgruppe ohne Soziotherapie.“[8] Dies verdeutlicht nach meinem Empfinden sehr eindringlich den Erfolg sowohl aus ökonomischer Sicht als auch aus Sicht der Sozialen Arbeit.
„Im Ergebnis können wir mit Mühlum (2001, 115f) festhalten, dass die Soziale Arbeit mit ihren Beiträgen zur Verbesserung der Lebensumstände und der Bewältigung von Problemen gesundheitsrelevant ist.“[9]
Um auf den Umfang der Seminararbeit Rücksicht zu nehmen, habe ich in diesem Punkt nicht ausführlich den Begriff „klinische Sozialarbeit“ erklärt. Dies soll im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung deutlich werden.
4. Darstellung des Arbeitsfeldes
In den folgenden Punkten soll ein Einblick in die Arbeitsbereiche des Sozialarbeiters im Krankenhaus gegeben werden.
4.1 Tätigkeitsprofil
Der Gesetzgeber spricht dem Patienten eine angemessene Krankenhausbehandlung zu.
So ist unter anderem in §112 II Nr. 4 und 5 SGB V
geregelt, dass der Patient ein Recht auf die soziale Betreuung und Beratung im Krankenhaus und auf einen nahtlosen Übergang von der Krankenhausbehandlung zur Rehabilitation oder Pflege hat.
Das Arbeitsfeld eines Sozialarbeiters im Krankenhaus teilt sich in zwei Tätigkeitsbereiche. Im ersten Bereich geht es um administrative Aufgaben. Hierunter versteht man zum Beispiel die Vermittlung des Patienten in Rehabilitationsmaßnahmen oder Pflegeeinrichtungen. Auch fällt die Klärung der Kostenübernahme oder die Einrichtung von Betreuungen in diesen Teilbereich. Der zweite Tätigkeitsfeld beschäftigt sich mit persönlichen Hilfen. Hier geht es um psychosoziale Maßnahmen und um Förderung von persönlichen Kompetenzen in Bezug auf komplikationsreiche Erkrankungen.[10]
Dies ist die Theorie und die Interpretation des Gesetzestextes. „In der Praxis des Sozialdienstes geht es im Wesentlichen um die Klärung rechtlicher, finanzieller und persönlicher Fragen in Bezug auf Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Organisation geeigneter Hilfen nach der Krankenhausentlassung.“[11]
Bei der Vermittlung in ein Pflegeheim oder einer häuslichen Hilfe, geht es vor allem darum, dem Patienten eine psychosoziale - „Stütze“ zu sein. Die Begleitung der Menschen in der Phase der Einsicht nicht mehr alleine zurechtzukommen und Hilfen in Anspruch nehmen zu müssen, sind nur ein kleiner Ausschnitt der Handlungssituationen in solchen Fällen.
4.2. Methodische Ansätze
Um ein Problem zu erfassen, einen angemessenen Hilfeprozess gestalten zu können und geeignete Maßnahmen einzuleiten, bedarf es methodischer Ansätze.
Damit diese umgesetzt werden können, bewegt sich der Sozialarbeiter verpflichtend innerhalb zweier Themenschwerpunkte.
Zum einen der Sozialen Beratung und zum anderen der Fallbearbeitung (Case – Management).[12] Im Folgenden sollen beide Themenfelder in den nächsten zwei Unterpunkten behandelt werden.
4.2.1 Soziale Beratung
In der Sozialen Beratung geht es überwiegend immer um krankheits- und behandlungsbedingte soziale, persönliche und finanzielle Probleme eines Patienten. Dies ist ein wichtiger Punkt, da es darauf ankommt, andere beratungsrelevante Probleme an Institutionen zu delegieren, die nach dem Krankenhausaufenthalt im jeweiligen Bereich tätig werden (z.B.: Schuldnerberatung). Da sich die Problembereiche häufig überschneiden bzw. sich die Fragestellungen wiederholen, verläuft die Soziale Beratung immer nach einem typischen Ablaufmuster. Grundsätzlich findet die Kommunikation immer auf das Problem bezogen statt. Die Aufgabe eines Beraters ist es somit, dem Ratsuchenden mit Informationen und Empfehlungen zu Seite zu stehen.[13]
Dabei muss der Berater zwischen zwei Aspekten verbinden. Zum einen das Wissensdefizit des Ratsuchenden und zum anderen seine Entscheidungsunfähigkeit. Ersteres kann durch eine sachlich orientierte Beratung behoben werden, die das Ziel haben muss, dem Ratsuchenden zu relativ leichten Entscheidungen zu verhelfen (z.B.: in der Rechtsberatung, Erziehungsberatung, Partnerberatung etc.). Sollte trotz ausreichender Informationsvermittlung dennoch Unsicherheit und Angst bestehen, rückt die Entscheidungshilfe im Vordergrund, da in dieser Situation ein längerer Beratungsprozess von Nöten ist.[14]
Das Beratungsgespräch beginnt mit der Erfassung der Lebenslage und der sozialen Probleme des Ratsuchenden. Deren Ursachen werden im Zwiegespräch gemeinsam reflektiert, Lösungen werden abgewogen, gezielte Lösungsschritte verabredet und anschließend umgesetzt.[15]
Wichtig für den Berater ist, dass er die sprachlichen Möglichkeiten des Ratsuchenden würdigt. „Generell gilt, dass der Berater möglichst kurz und anschaulich formuliert, Aussagen des Ratsuchenden aufgreift, Peinlichkeiten vermeidet und mit Deutungen sparsam umgeht (Finke 1999).“[16]
Durch die erste Annäherung an den Krankenhauspatienten wird deutlich, in welche Richtung die Beratung gehen muss. „Eine genauere Analyse des Unterstützungsbedarfs von Patienten mit komplikationsreichen Erkrankungen trägt dazu bei, die möglichen Themen der Sozialen Beratung zu spezifizieren.“[17]
Die oberste Intention der Beratung besteht darin, die Integration der Patienten sicherzustellen, damit ein möglichst normales, unabhängiges Leben realisierbar wird. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, indem man während der Beratung bestimmte Fähigkeiten anspricht und fördert.
Verbessert man die kognitiven, emotionalen und handlungsorientierten Fähigkeiten, so besteht die Chance, dass der Patient bestehende Probleme und Konflikte selbstständig bewältigen kann, vorhandene Chancen sieht und sie letztendlich auch nutzt. Selbstverständlich geht es in der Sozialen Beratung nicht nur um einen Kommunikationsaustausch sondern auch speziell um materielle und soziale Dienstleistungen, die den Alltag erleichtern sollen.[18]
„Der Erfolg einer Beratung hängt nicht nur von den eingebrachten Inhalten und Gesprächstechniken ab, sondern auch von der Bereitschaft des Ratsuchenden, sich auf die Beratung einzulassen und mitzuarbeiten.“[19]
Auch wenn der soziale und/oder der persönliche Druck sich beraten zu lassen sehr groß ist, so liegt dennoch die Grundvoraussetzung für die Beratung in der Freiwilligkeit und der Fähigkeit zur freien Verantwortung.[20]
Um eine effektive Beratung durchzuführen und die oben genannten Ziele realisierbar zu machen, ist die Beratungsbeziehung zwischen Ratsuchenden und Berater von größter Bedeutung. Der Berater darf sich im Gespräch nicht als Therapeut verstehen, da es sich hier nicht um eine therapeuthische Beziehung handelt. Vielmehr sollten die Probleme des Patienten im Mittelpunkt stehen. Um auch den Patienten zu erreichen, der sich nicht auf eine längerfristige Beratungsbeziehung einlässt gilt es, ihn die belastende Realität sehen zu lassen, ihm im Laufe der Beratung Zeit zu gewähren, sein Selbst- und Problemverständnis zu entwickeln, seinen Wunsch nach Nähe und Distanz zu achten und keine falschen Versprechungen zu machen.
[...]
[1] Vgl. Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 11
[2] Vgl. Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 13
[3] Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 13
[4] Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 13 - 14
[5] Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 15
[6] H. Pauls, 1
[7] Vgl. H. Pauls, 1-2
[8] H. Pauls, 2
[9] Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 15
[10] Vgl. P.Reinicke, 2001, 63
[11] P. Reinicke, 2001, 63
[12] Vgl. Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 61
[13] Vgl. P. Reinicke, 2001, 65
[14] Vgl. H. Waller, 2002, 134
[15] Vgl. Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 63
[16] Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 63
[17] Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 63
[18] Vgl. P. Reinicke, 2001, 65
[19] Ansen / Gödecker-Geenen / Nau, 2004, 62
[20] Vgl. H. Waller, 2002, 134
- Quote paper
- Kai Flockenhaus (Author), 2005, Soziale Arbeit im Krankenhaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37703