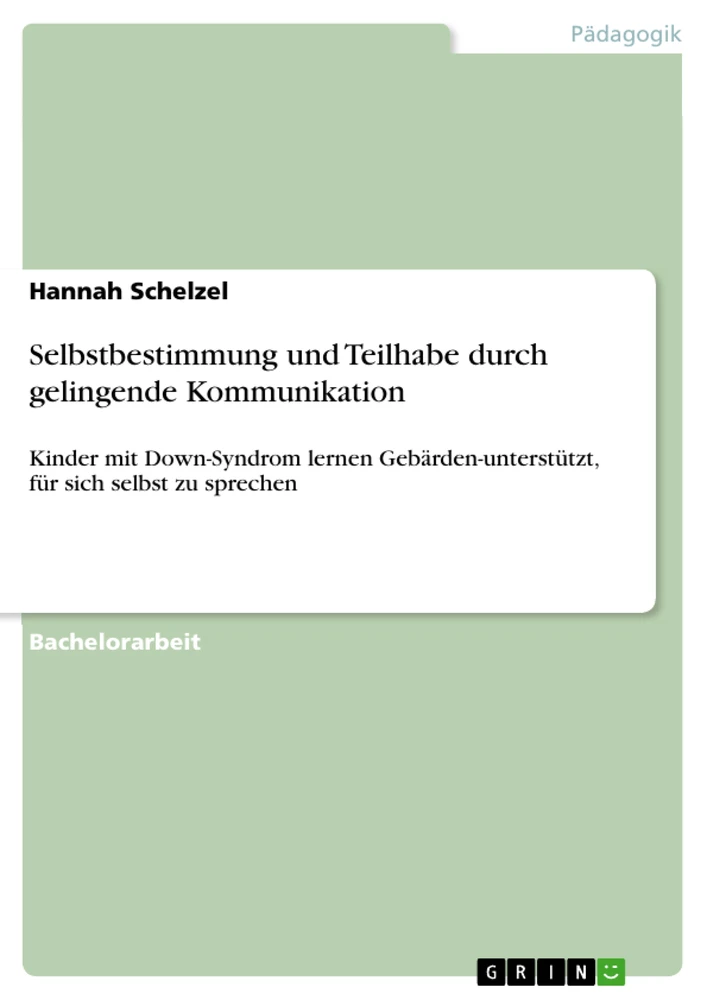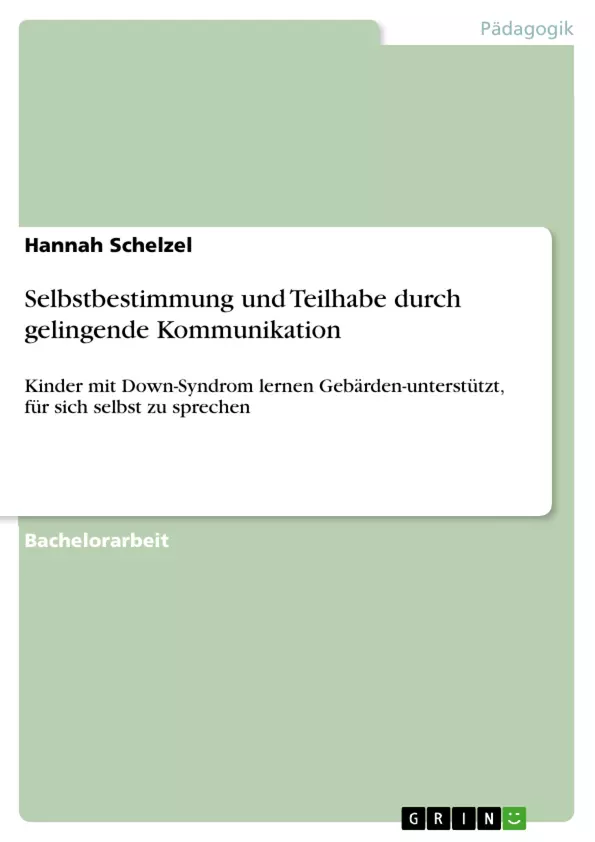Kommunikation und (Laut-)Sprache haben in unserer Gesellschaft eine wichtige Bedeutung. Doch Kinder haben auch schon etwas zu "sagen", wenn sie noch nicht sprechen - erst recht Kinder mit Down Syndrom, die oft deutlich später sprechen lernen und damit noch länger warten müssen, bis sie sich lautsprachlich äußern können. diese Arbeit setzt sich zum Ziel herauszufinden, ob und wie Gebärden die Kommunikation in dieser Phase erleichtern
Auf einen Vergleich der Sprachentwicklung bei Kindern mit und ohne Down-Syndrom und einen Überblick über die verschiedenen, häufig genutzten Gebärdensysteme folgen Argumente für und gegen die Nutzung von Gebärden in der Kommunikationsförderung. Für die praktische Umsetzung werden Hinweise zum methodischen Vorgehen in der Arbeit mit Gebärden und wichtige Aspekte zur Kooperation zwischen Kind, Eltern und Fachpersonal genannt. Den Abschluss bilden Überlegungen dazu, warum eine gelingende Kommunikation ein entscheidender Faktor für Selbstbestimmung und Teilhabe ist.
Durch Gebärden können Kinder zeigen, was sie wissen und können. Eine dadurch geänderte Erwartungshaltung dem Kind und seinen Fähigkeiten gegenüber kann weiteres ungeahntes Potential freisetzen. Durch eine offene, interessierte Haltung kann ein echter Dialog entstehen, der z.B. auch Provokationen als Äußerungen ernst nimmt. Kinder gewinnen dadurch an Kommunikationsfähigkeit und Selbstbewusstsein. Beides ist wichtig auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung und Teilhabe.
Das darf jedoch nicht dazu führen, dass Hilfe-Leistungen in Form von Finanzmitteln und Personal gestrichen werden, um Kosten zu sparen. Selbstbestimmung bedeutet nicht, dass keine Hilfe mehr notwendig ist, sondern dass die Art der Hilfe von den assistenzbedürftigen Menschen mitbestimmt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kindliche Sprachentwicklung und Sprachförderung
- 2.1 Sprachentwicklung
- 2.1.1 Früher Dialog, Turn-taking und „Lallphase“
- 2.1.2 Triangulieren und Beginn der Wortschatzentwicklung
- 2.1.3 Von Proto-Wörtern zur „Wortexplosion“
- 2.1.4 Funktions- und Symbolspiel
- 2.1.5 Mehr-Wort-Äußerungen
- 2.2 Zusätzliche anatomische und medizinische Aspekte
- 2.3 Zusammenhang von Sprache und Kognition
- 2.4 Sprachförderung
- 3. Kommunikationsförderung durch Gebärden
- 3.1 Gebärdensysteme im Vergleich
- 3.2 Argumente für und gegen Gebärden
- 3.2.1 Sprachanbahnende Wirkung und sprachliche Gesamtentwicklung
- 3.2.2 Entwicklung eines Symbolsystems
- 3.2.3 Freude und Frust in Bezug auf Kommunikation
- 3.2.4 Verständnisprobleme
- 3.2.5 Ressourcen-Orientierung
- 3.2.6 Einfluss auf die sonstige Entwicklung
- 3.2.7 Motorik
- 3.2.8 Alltagstauglichkeit und Kosten
- 3.2.9 Soziale Anerkennung
- 3.3 Methodisches Vorgehen in der Arbeit mit Gebärden
- 3.3.1 Zeitpunkt ihrer Einführung
- 3.3.2 Auswahl der Gebärden
- 3.3.3 Rahmenbedingungen für die Arbeit mit Gebärden
- 3.3.4 Ganzheitlichkeit und Alltagsbezogenheit
- 3.3.5 Über- und Unterforderung vermeiden
- 3.3.6 Konkrete Praxisideen
- 3.4 Kooperation zwischen Kind, Eltern und Fachpersonal
- 3.4.1 Die Lebenssituation der Familie
- 3.4.2 Die Arbeitssituation des Fachpersonals
- 3.4.3 Mögliche Chancen und Schwierigkeiten der Kooperation
- 4. Kommunikation als entscheidender Faktor für Selbstbestimmung und Teilhabe
- 4.1 Kommunikation und Selbstbestimmung
- 4.2 Kommunikation und Teilhabe
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Kommunikation für Kinder mit Down-Syndrom und untersucht die Möglichkeiten der Gebärdenunterstützung als Instrument zur Sprachförderung und zur Verbesserung der Selbstbestimmung und Teilhabe.
- Sprachentwicklung bei Kindern mit Down-Syndrom
- Kommunikationsförderung durch Gebärden
- Methodisches Vorgehen in der Arbeit mit Gebärden
- Kooperation zwischen Familie und Fachpersonal
- Bedeutung von Kommunikation für Selbstbestimmung und Teilhabe
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz der Thematik vor und erläutert den persönlichen Hintergrund der Autorin. Sie beschreibt die Motivation und die Zielsetzung der Arbeit, die sich auf die Förderung der Kommunikation bei Kindern mit Down-Syndrom durch Gebärden fokussiert.
- Kapitel 2: Kindliche Sprachentwicklung und Sprachförderung: Dieses Kapitel beleuchtet die allgemeine Sprachentwicklung, wobei die Besonderheiten bei Kindern mit Down-Syndrom hervorgehoben werden. Es werden wichtige Phasen der Sprachentwicklung wie der frühe Dialog, das Turn-taking, die Lallphase und die Wortschatzentwicklung sowie die Bedeutung der Kommunikation und die Interaktion zwischen Kind und Bezugsperson beschrieben.
- Kapitel 3: Kommunikationsförderung durch Gebärden: Dieses Kapitel widmet sich der Kommunikation durch Gebärden. Verschiedene Gebärdensysteme werden miteinander verglichen und Argumente für und gegen den Einsatz von Gebärden in der Sprachförderung dargestellt. Das Kapitel enthält praktische Hinweise zur Einführung, Auswahl und Anwendung von Gebärden in der Arbeit mit Kindern mit Down-Syndrom.
- Kapitel 4: Kommunikation als entscheidender Faktor für Selbstbestimmung und Teilhabe: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Kommunikation für die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Down-Syndrom und zeigt die Rolle der Kommunikation für die Entwicklung von Selbstständigkeit, Autonomie und sozialer Integration.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den Themen Gebärdenunterstützte Kommunikation, Sprachentwicklung, Down-Syndrom, Kommunikation, Selbstbestimmung, Teilhabe, Sprachförderung, Interaktion, Familienarbeit und Fachkräfte-Kooperation. Sie beleuchtet die Herausforderungen der Sprachentwicklung bei Kindern mit Down-Syndrom und untersucht den Einsatz von Gebärden als Mittel zur Kommunikationsförderung, Sprachentwicklung und Verbesserung der Selbstbestimmung und Teilhabe.
Häufig gestellte Fragen
Wie helfen Gebärden Kindern mit Down-Syndrom bei der Kommunikation?
Da Kinder mit Down-Syndrom oft erst spät sprechen, ermöglichen Gebärden ihnen, sich schon früher mitzuteilen, was Frustration mindert und das Selbstbewusstsein stärkt.
Verhindern Gebärden das Erlernen der Lautsprache?
Nein, die Arbeit zeigt auf, dass Gebärden oft eine sprachanbahnende Wirkung haben und die sprachliche Gesamtentwicklung eher fördern als behindern.
Was ist bei der Einführung von Gebärden methodisch zu beachten?
Wichtig sind die Auswahl alltagsrelevanter Gebärden, ein spielerischer Ansatz und die Vermeidung von Überforderung des Kindes.
Warum ist Kooperation zwischen Eltern und Fachpersonal so wichtig?
Nur wenn Gebärden sowohl zu Hause als auch in der Therapie oder Kita einheitlich genutzt werden, kann das Kind ein stabiles Kommunikationssystem aufbauen.
Was bedeutet Teilhabe im Kontext gelingender Kommunikation?
Gelingende Kommunikation ist der Schlüssel, damit Menschen mit Behinderung ihre Bedürfnisse äußern und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
- Quote paper
- Hannah Schelzel (Author), 2016, Selbstbestimmung und Teilhabe durch gelingende Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376797