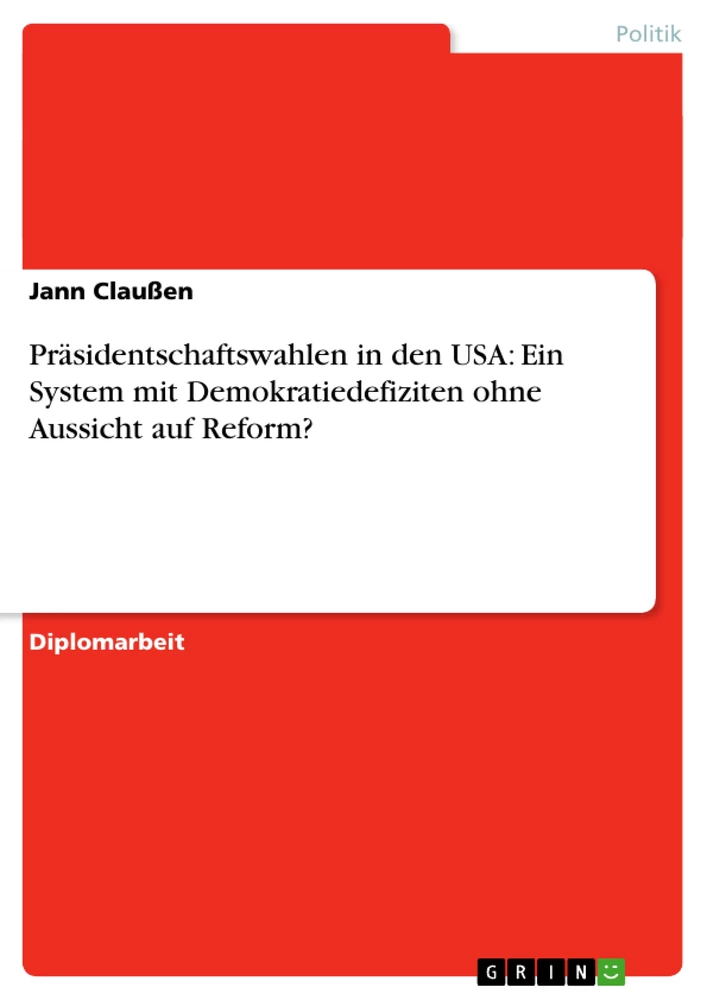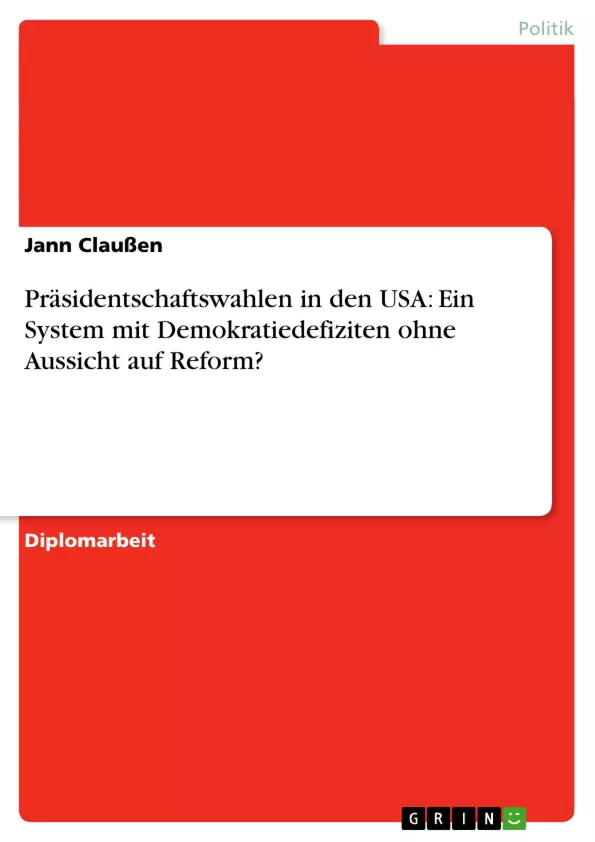Hauptaufgabe dieser Arbeit wird es sein, die Hintergründe des US-amerikanischen Präsidentschaftswahlsystems auf den verschiedenen Ebenen zu durchleuchten.
Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem historischen Ursprung des
Präsidentschaftswahlsystems. Besonders interessant ist in diesem
Abschnitt die Frage danach, warum sich die „Schöpfer der Verfassung“ nicht für eine direkte Wahl des Präsidenten entschieden haben, sondern für die Instanz der Wahlmännerstimmen.
Im zweiten Teil soll die politische Entwicklung und Gegenwart ein wenig näher
beleuchtet werden. Im Vordergrund stehen dabei die Wahlen, in deren Folge es zu Reformen gekommen ist und die bei denen das Wahlsystem problematische Auswirkungen gehabt hat.
Anschließend geht es um den Verlauf der Präsidentschaftswahlen der Gegenwart. Hinter
dieser Untersuchung steckt die Frage, ob die Wahl des Präsidenten in den Vereinigten Staaten in der Gegenwart überhaupt noch den Intentionen der Verfassungsväter entspricht, obwohl sie grundsätzlich auch heute noch auf den von diesen festgelegten Regeln basiert.
Der dritte und letzte Teil widmet sich einer genauen Analyse der Defizite des gegenwärtigen Präsidentschaftswahlsystem und beschäftigt sich mit alternativen Konzepten. Außerdem stellt sich die Frage, warum es in über 200 Jahren nicht gelungen ist, etwaige Demokratiedefizite zu beseitigen. Diese Frage soll mit Hilfe des historischen Institutionalismus beantwortet werden. Entscheidend sind in diesem Zusammenhang die Strategie und die Motive der Reformgegner. Es werden allerdings auch die Reformhindernisse untersucht, die durch die Regeln des Gesetzgebungsprozesses und die Auflagen für eine Verfassungsänderung entstehen. Beides ist von großer Bedeutung.
Dieser Arbeit liegt eine eher pessimistische Vermutung zu Grunde: Wenn selbst die chaotischen Konsequenzen der Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 nicht zu einer grundlegenden Reform des Wahlsystems für das wichtigste und mächtigste politische Amt der Welt geführt haben, werden die Wähler in den Vereinigten Staaten ihren Präsidenten auch noch in ferner Zukunft mit einem extrem problembehafteten Wahlsystem bestimmen. Dieses System wird bei einigen Wahlen auch weiterhin den Wählerwillen umkehren und den Kandidaten zum Präsidenten machen, der nicht die Mehrheit der Wählerstimmen bekommen hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil I: Historischer Ursprung
- 1.1. Verfassungsväter
- 1.2. Verfassungskonvent
- 1.3. Fazit: Präsidentschaftswahlen im Sinne der Verfassungsväter: Ein ungenaues System mit bewusst integrierten und nicht antizipierten Demokratiedefiziten
- Teil II: Evolution eines Systems & Wahlen in der Gegenwart
- 2.1. Evolution
- 2.1.1 Frühe Schwierigkeiten und der zwölfte Verfassungszusatz
- 2.1.2 Auswahl der Wahlmänner: Scheinbare Demokratisierung eines Systems
- 2.1.3 Adams und Hayes: Zwei Präsidenten des Kongresses, nicht des Volkes
- 2.1.4 Close Calls
- 2.2. Wahlen in der Gegenwart
- 2.2.1 Kandidatenauswahl
- 2.2.2 Geld, Medien und Strategien
- 2.2.3 Wahlmänner: Ihre Nominierung, ihre Wahl und ein missverstandenes System
- 2.2.4 Election Night
- 2.3. Fazit: Evolution mit eingeschränkter Demokratisierung
- Teil III: Defizite und Reformdiskussion
- 3.1. Probleme und Defizite
- 3.1.1 „Wrong Winner“
- 3.1.2 Ungleiche Wähler und gefährliche Drittkandidaten
- 3.1.3 Volkszählung
- 3.1.4 Wahlbeteiligung
- 3.1.5 Bevölkerungsgruppen
- 3.1.6 Unvollständiger Wahlvorgang
- 3.1.7 Verzerrungen
- 3.2. Alternativen? Reformvorschläge in der Diskussion
- 3.2.1 Der „Distriktplan“
- 3.2.2 Der automatische Plan
- 3.2.3 Der proportionale Plan
- 3.2.4 Der nationale Bonusplan
- 3.2.5 Direkte Präsidentschaftswahlen
- 3.3. Keine Aussicht auf Reform? Reformversuche und Reformen aus der Sicht des historischen Institutionalismus und ein Ausblick
- 3.3.1 Der Ansatz
- 3.3.2 Chancenlose Reformversuche
- 3.4. Fazit: Erdrückende Defizite und eine Lösung ohne Erfolgschancen
- Fazit: Präsidentschaftswahlen in den USA: Ein System mit Demokratiedefiziten ohne Aussicht auf eine sinnvolle Reform
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das US-amerikanische Präsidentschaftswahlsystem, untersucht dessen historischen Ursprung und Entwicklung sowie die daraus resultierenden Demokratiedefizite. Sie befasst sich mit der Frage, warum die Verfassungsväter sich für ein indirektes Wahlsystem entschieden haben und welche Faktoren die Evolution des Systems beeinflusst haben. Darüber hinaus werden die Herausforderungen und Probleme des aktuellen Wahlsystems beleuchtet und Reformvorschläge diskutiert.
- Historische Entwicklung und Entstehung des US-amerikanischen Präsidentschaftswahlsystems
- Analyse der Demokratiedefizite des Wahlsystems
- Bewertung der Reformen und Reformversuche
- Diskussion der Chancen und Herausforderungen einer Reform
- Bedeutung der Wahlmänner und ihre Rolle im Wahlprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die US-Präsidentschaftswahlen 2000 und die Kritik am Wahlsystem, die im Zuge der umstrittenen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs entstand. Im Fokus steht die Frage, ob das US-amerikanische Präsidentschaftswahlsystem noch zeitgemäß ist.
Teil I: Historischer Ursprung: Dieser Teil befasst sich mit den historischen Ursprüngen des Wahlsystems, der Rolle der Verfassungsväter und den Gründen für die Wahl eines indirekten Wahlsystems.
Teil II: Evolution eines Systems & Wahlen in der Gegenwart: Dieser Teil analysiert die Evolution des US-amerikanischen Präsidentschaftswahlsystems anhand ausgewählter Wahlbeispiele und untersucht, ob die Wahl des Präsidenten in der Gegenwart noch den Intentionen der Verfassungsväter entspricht.
Teil III: Defizite und Reformdiskussion: Dieser Teil analysiert die Probleme und Defizite des Wahlsystems, wie z.B. das „Wrong Winner“-Problem, ungleiche Wählergewichtung und die Wahlbeteiligung. Er stellt Reformvorschläge vor und diskutiert deren Chancen und Herausforderungen.
Schlüsselwörter
US-amerikanische Präsidentschaftswahlen, Wahlsystem, Demokratiedefizite, Wahlmänner, Verfassungsväter, historische Entwicklung, Reformdiskussion, Reformvorschläge, Wrong Winner, ungleiche Wählergewichtung, Wahlbeteiligung, historische Institutionalismus, Wahlkampf, Kandidatenauswahl.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben die US-Verfassungsväter kein direktes Wahlsystem eingeführt?
Die Schöpfer der Verfassung entschieden sich bewusst gegen eine Direktwahl und für das System der Wahlmännerstimmen, um bestimmte politische Kompromisse einzugehen und die Macht zu verteilen.
Was ist das "Wrong Winner"-Problem bei US-Präsidentschaftswahlen?
Das Problem beschreibt Situationen, in denen ein Kandidat Präsident wird, obwohl er nicht die Mehrheit der landesweiten Wählerstimmen (Popular Vote) erhalten hat, sondern nur die Mehrheit der Wahlmännerstimmen.
Welche Rolle spielen die Wahlmänner heute noch?
Wahlmänner sind weiterhin die entscheidende Instanz bei der Wahl des Präsidenten. Das System basiert grundlegend immer noch auf den Regeln der Verfassungsväter, auch wenn sich die Auswahlprozesse demokratisiert haben.
Warum gab es nach der Wahl im Jahr 2000 keine grundlegende Reform?
Reformen scheitern oft an den hohen Hürden für Verfassungsänderungen, den Strategien der Reformgegner und den Regeln des Gesetzgebungsprozesses, was durch den historischen Institutionalismus erklärt werden kann.
Welche Reformvorschläge werden für das US-Wahlsystem diskutiert?
Zu den diskutierten Alternativen gehören der Distriktplan, der proportionale Plan, der nationale Bonusplan sowie die Einführung einer direkten Präsidentschaftswahl.
Was ist der historische Institutionalismus in diesem Kontext?
Dies ist ein theoretischer Ansatz, der erklärt, warum Institutionen und Regeln über lange Zeit stabil bleiben und warum es so schwierig ist, tief verwurzelte Systeme wie das US-Wahlsystem zu reformieren.
- Quote paper
- Diplompolitologe Jann Claußen (Author), 2004, Präsidentschaftswahlen in den USA: Ein System mit Demokratiedefiziten ohne Aussicht auf Reform?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37678