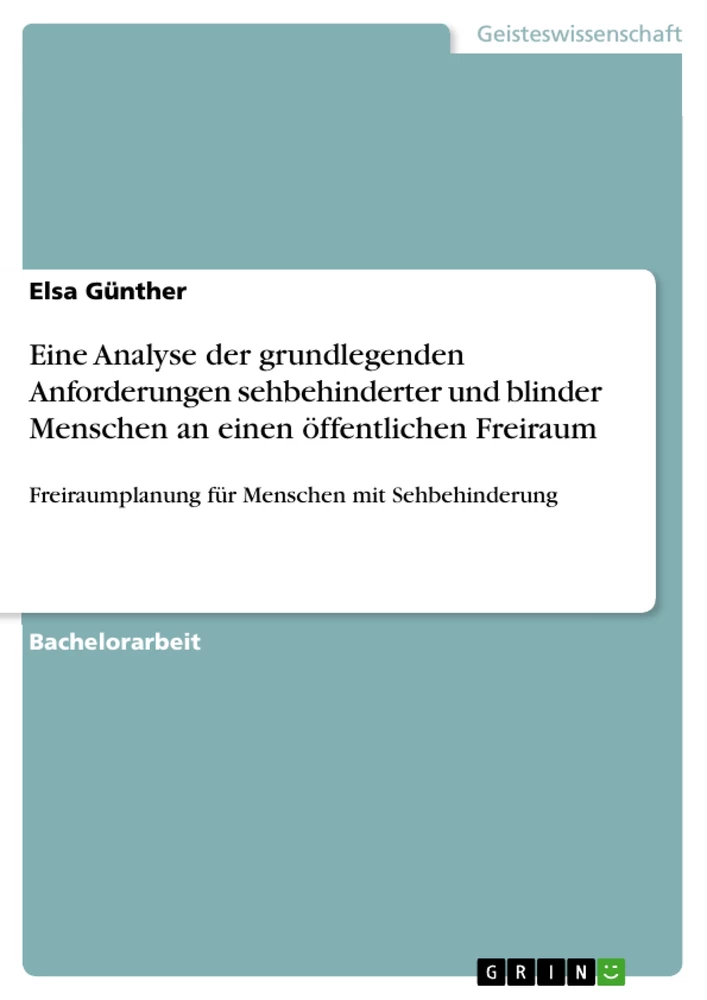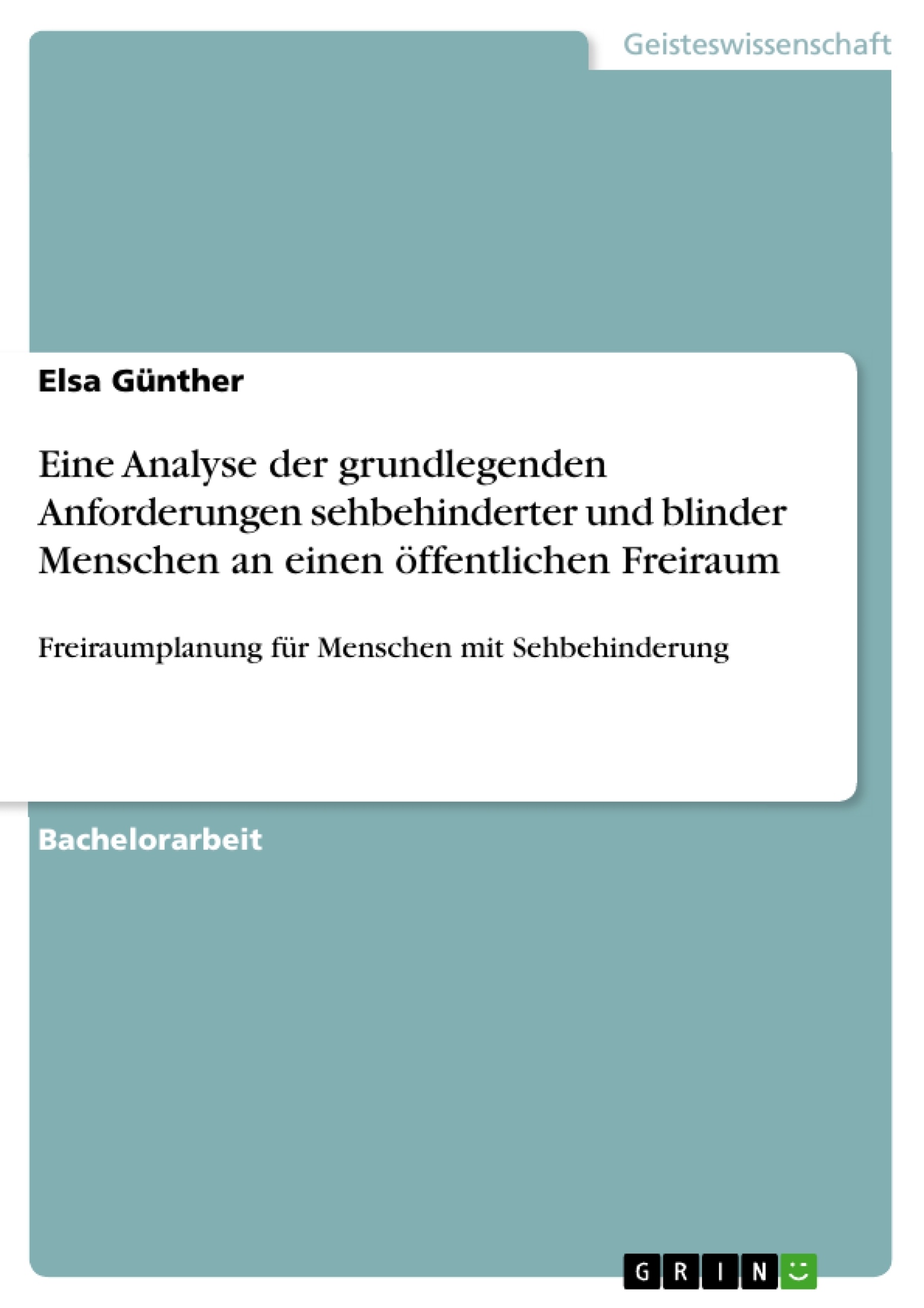Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Freiraumplanung für Menschen mit sensorischer Einschränkung. Das Interesse gilt der Freiraumplanung für die Menschen mit einer Sehbehinderung. Zu Beginn ist anzumerken, dass in dieser Arbeit der Oberbegriff „Sehbehinderung“ der Bauliteratur entsprechend für die Unterkategorien „Blindheit“ und „Sehbehinderung“ verwendet wird. Ein Mensch mit uneingeschränkter Sehkraft nimmt die Umwelt zu 80-90 % über die Augen, zu 10 % über das Gehör wahr. Wie also findet sich ein Sehbehinderter in seiner Umwelt zurecht? Wie gilt es einen Freiraum dementsprechend zu gestalten, um diesen für die besondere Menschengruppe zugänglich und nutzbar zu machen?
Sich mit dem Thema der Sehbehinderung zu beschäftigen, ergab sich aus meiner persönlichen Zustimmung der Aussage von Herbert Bienk, Staatskoordinator für die Gleichstellung behinderter Menschen der Freien und Hansestadt Hamburg, die folgendermaßen lautet: „Die Frage, ob etwas rollstuhlgerecht ist, wird oft diskutiert. Hindernisse, die man wegen einer Sinnesbehinderung überwinden muss, sind vielen nicht automatisch bewusst.“ Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Anforderungen dieser besonderen Menschengruppe an einen öffentlichen Freiraum herauszufinden und entsprechende grundlegende bauliche sowie gestalterische Maßnahmen zu nennen. Es soll dargestellt werden, durch welche Maßnahmen ein Freiraum als Mittel zur Inklusion Sehbehinderter dienen kann. Zu Beginn der Arbeit wird die Definition der Sehbehinderung gemäß des deutschen Rechts aufgezeigt. Es findet eine Kategorisierung des Oberbegriffs „Sehbehinderung“ in „Blindheit“ und „Sehbehinderung“ statt. Die Definition und Kategorisierung einer Sehbehinderung stellen das zweite Kapitel dar. Im Anschluss folgt das dritte Kapitel, das sich mit den Ursachen einer Sehbehinderung und einer Blindheit beschäftigt. Neben den Ursachen wird in diesem Kapitel die entsprechende Sinnesbeeinträchtigung durch Abbildungen dargestellt. Dieses Kapitel wird die unterschiedlichen Sinnesbeeinträchtigungen durch bildliche und tabellarische Darstellungen deutlich vermitteln. Das vierte Kapitel thematisiert die räumliche Wahrnehmung Sehbehinderter und Blinder.
Inhaltsverzeichnis
- Ehrenwörtliche Erklärung
- Einleitung
- Definition Sehbehinderung
- Kategorisierung Sehbehinderung und Blindheit
- Zahlen und Altersverteilung
- Ursachen einer Sehbehinderung oder Blindheit
- Formen einer Sehbehinderung
- Formen einer Blindheit
- Zwischenfazit
- Bauliche Anforderungen eines öffentlichen Freiraums Sehbehinderter und Blinder in Bezug zu ihrer räumlichen Wahrnehmung
- Wahrnehmung der Umgebung - Optimale Unterstützung des „Restsinns“
- Persönliche Hilfsmittel sehbehinderter Menschen
- Alternative Wahrnehmung
- Hilfsmittel blinder Menschen
- Fortbewegung blinder Menschen mit dem Langstock
- Fortbewegung blinder Menschen mit dem Blindenführhund
- Verkehrsschutzzeichen
- Zwischenfazit
- Prioritätsstufen nach C. Ruhe
- Grundlegende Planungsanforderungen
- Relevante Normen
- Visuell kontrastierende Anforderungen
- Leuchtdichtekontrast
- Farbkombinationen
- Schriftarten
- Piktogramme
- Belichtung und Beleuchtung
- Taktil und haptisch kontrastierende Anforderungen
- Tastkanten
- Bodenindikatoren
- Leitstreifen
- Aufmerksamkeitsfelder
- Tastmodell
- Brailleschrift an Handläufen
- Auditiv kontrastierende Anforderungen
- Bauliche und gestalterische Maßnahmen von Freiraumelementen für Sehbehinderte und Blinde
- Leitsystem
- Gehweggestaltung
- Überquerungssituation
- Treppenanlage
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Freiraumplanung für Menschen mit Sehbehinderung. Sie analysiert die grundlegenden Anforderungen sehbehinderter und blinder Menschen an einen öffentlichen Freiraum und beleuchtet die notwendigen baulichen und gestalterischen Maßnahmen, um diesen für sie zugänglich und nutzbar zu machen. Der Fokus liegt auf der Berücksichtigung ihrer spezifischen Wahrnehmung und der Integration entsprechender Hilfsmittel in die Planung.
- Wahrnehmung von Umgebung und Raum durch sehbehinderte und blinde Menschen
- Relevante Normen und Richtlinien zur Gestaltung barrierefreier Freiräume
- Visuelle, taktile und auditive Kontraste als wesentliche Gestaltungselemente
- Spezielle Anforderungen an Freiraumelemente wie Leitsysteme, Gehwege und Treppenanlagen
- Entwicklung eines Plans für einen inklusiven öffentlichen Freiraum, der den Bedürfnissen sehbehinderter und blinder Menschen gerecht wird.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Bachelorarbeit vor und erläutert die Relevanz der Barrierefreiheit in Bezug auf die Teilhabe sehbehinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben. Sie führt in die Thematik der Barrierefreiheit in Bezug auf öffentliche Freiräume ein und betont die Notwendigkeit einer inklusiven Gestaltung.
Das Kapitel "Definition Sehbehinderung" definiert die Begriffe "Sehbehinderung" und "Blindheit" und präsentiert statistische Informationen zur Häufigkeit und Altersverteilung von Sehbehinderten in Deutschland.
Das Kapitel "Ursachen einer Sehbehinderung oder Blindheit" beleuchtet die verschiedenen Formen der Sehbehinderung und Blindheit und analysiert deren Ursachen.
Das Kapitel "Bauliche Anforderungen eines öffentlichen Freiraums Sehbehinderter und Blinder in Bezug zu ihrer räumlichen Wahrnehmung" widmet sich der besonderen Wahrnehmung von Menschen mit Sehbehinderungen und erklärt, wie sie ihre Umgebung wahrnehmen. Es präsentiert verschiedene Hilfsmittel und Strategien, die sehbehinderte und blinde Menschen nutzen, um sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden.
Das Kapitel "Prioritätsstufen nach C. Ruhe" stellt verschiedene Prioritätsstufen in der Gestaltung barrierefreier Freiräume vor, die sich auf die Bedürfnisse sehbehinderter Menschen beziehen.
Das Kapitel "Grundlegende Planungsanforderungen" untersucht die relevanten Normen und Richtlinien, die bei der Planung barrierefreier Freiräume berücksichtigt werden müssen. Es beleuchtet insbesondere die Anforderungen an visuelle, taktile und auditive Kontraste in der Gestaltung.
Das Kapitel "Bauliche und gestalterische Maßnahmen von Freiraumelementen für Sehbehinderte und Blinde" widmet sich den spezifischen Anforderungen an verschiedene Freiraumelemente wie Leitsysteme, Gehwege und Treppenanlagen und präsentiert konkrete Gestaltungsempfehlungen für die Planung barrierefreier Freiräume.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Barrierefreiheit, inklusiven Freiraumplanung, Sehbehinderung, Blindheit, Wahrnehmung, Hilfsmittel, taktile und auditive Kontraste, Leitsysteme, Gehweggestaltung, Treppenanlagen.
- Quote paper
- Elsa Günther (Author), 2017, Eine Analyse der grundlegenden Anforderungen sehbehinderter und blinder Menschen an einen öffentlichen Freiraum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376629