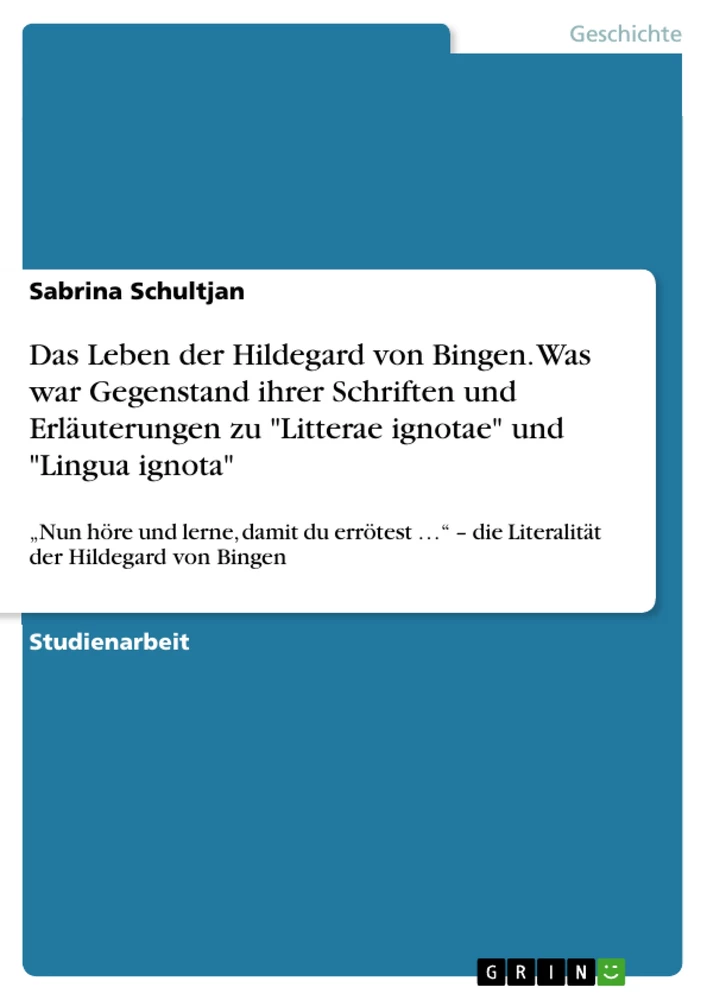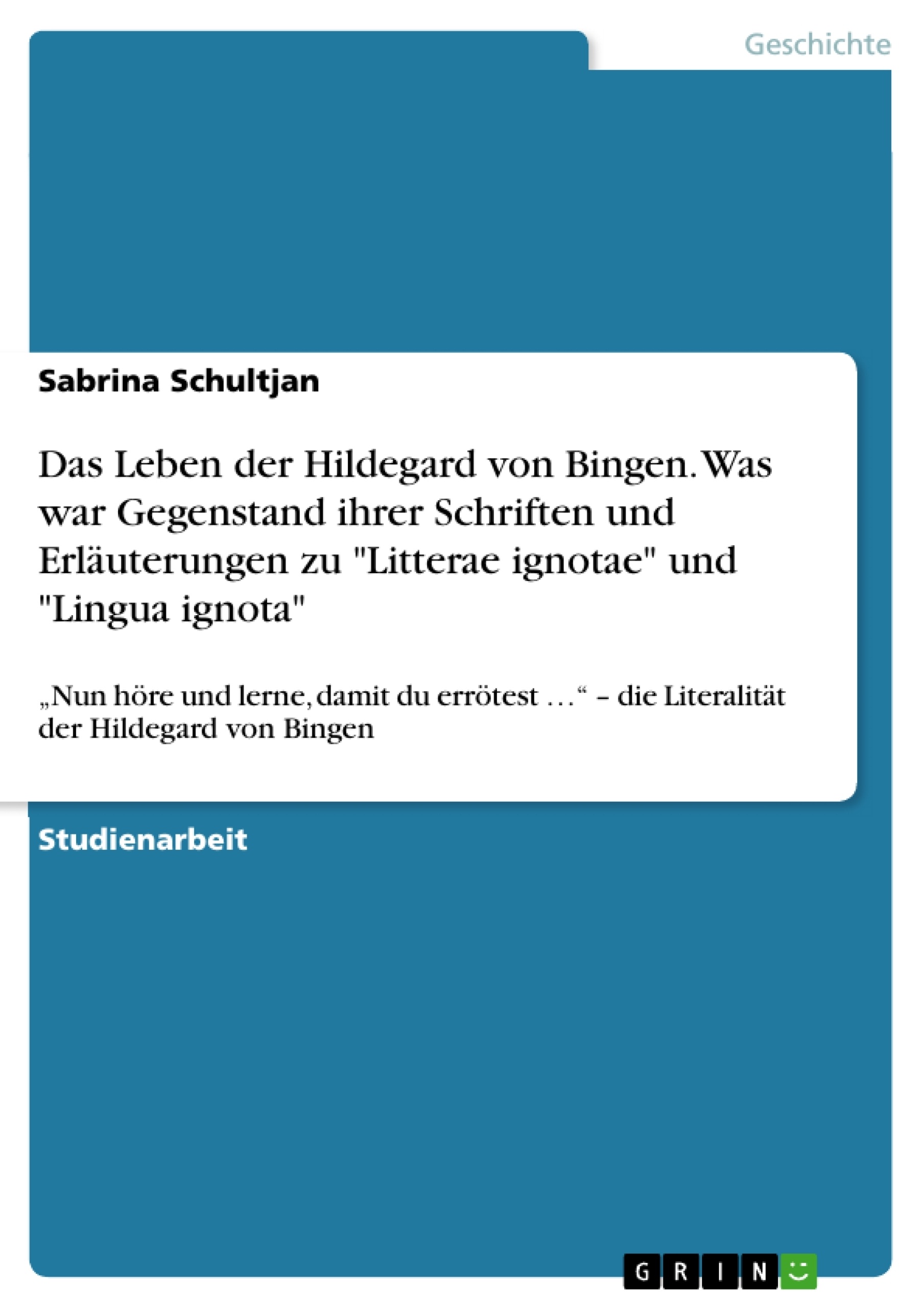Die Begriffe ‚Mystik‘, ‚Frömmigkeit‘ und ‚Bildung‘ werden in Bezug auf die Forschungsergebnisse von Edith Ennen und Laetitia Boehm erläutert. Auf deren Grundlage wird auch die Frage nach dem ‚Bild der Frau‘ im Mittelalter geklärt, das in der Forschung als sehr problematisch gesehen wird, da die verschiedenen zugänglichen apodiktischen Quellen nur teilweise mit der Lebensrealität übereinstimmen. Es sind kaum Quellen vorhanden, welche den weiblichen Alltagsturnus aller Stände abbilden. Historische Aufzeichnungen sind zumeist klerikalen Ursprungs – weltliche literarische Darstellungen geben zuweilen nur Wunschbilder wieder oder wollen durch Übertreibung unterhalten, während die höfische Epik nur einen Einblick in das Leben der feudalen Oberschicht zeigt und die Städterinnen und Bäuerinnen zumeist unerwähnt bleiben. Im Rahmen dieser Hausarbeit liegt die Konzentration allerdings auf den weiblichen adligen Lebensbedingungen, da Hildegard selbst dem Adel entstammte.
Auch zu Hildegards Lebensgeschichte sind leider nur wenig historisch nutzbringende Quellen, Überreste wie Traditionen zugänglich. Schon zu ihren Lebzeiten entstanden, entsprechend dem mittelalterlichen Geschichtsverständnis, um und über sie Legenden, die sich mit den Fakten verknüpften. Dadurch ist es schwierig die historischen von den legendenhaften Überlieferungen zu unterscheiden. Die sprachlichen Änderungen in Abschriften, Kopien, Kompilationen geben darüber hinaus Anlass die Quellenlage zu erläutern. Im Anschluss daran folgt ein Einblick in Hildegards Vita. Ihre Erziehung und Bildung wird geschildert, um Aufschluss über ihre eigene Lese- und Schreibkompetenz zu erlangen. Dazu wird vorwiegend die älteste Lebensbeschreibung Hildegards berücksichtigt, welche von den Mönchen Gottfried und Theoderich verfasst und von Adelgundis Führkötter in der Schrift Das Leben der heiligen Hildegard von Bingen aus dem Lateinischen übersetzt und kommentiert wurde. Die Hausarbeit versucht Antworten auf folgende zentralen Fragen zu finden: Warum ließ Hildegard verschiedene Schriften verfassen? Was war Gegenstand ihrer Schriften? Warum verfasste sie in ihren späteren Jahren selbst ihre Schriften und entwickelte das Litterae ignotae und Lingua ignota? Weshalb bezeichnete sie sich selbst als ‚indocta‘? Eine weitere Frage stellt das Ausmaß ihres Einflusses auf die Gesellschaft durch ihren regen Briefwechsel dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Historische Rahmenbedingungen um 1200
- 1.1 Bedeutung und Dimension von Literalität
- 1.2 Weibliche Bedingungen in der mittelalterlichen Gesellschaft
- 2 Hildegard von Bingen
- 2.1 Quellenlage
- 2.2 Bildungs- und Lebensweg
- 2.3 Modalitäten und Impulse des Werks im Überblick
- 2.4 Adressaten und Wirkung ihres Epistolariums
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Literalität der Hildegard von Bingen und analysiert ihren Einfluss auf das mittelalterliche Schrifttum. Sie untersucht, inwiefern Hildegards Literalität sowohl konventionelle als auch außergewöhnliche Aspekte aufweist, basierend auf den gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen sowie ihrem individuellen Lebensweg.
- Die historische Bedeutung von Literalität im 12. Jahrhundert
- Die gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für Frauen im Mittelalter
- Hildegards Bildungs- und Lebensweg und ihr Einfluss auf ihr Werk
- Die Modalitäten und Impulse von Hildegards Schriften
- Die Rezeption und Wirkung von Hildegards Epistolarium
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt Hildegard von Bingen als eine bedeutende Beraterin, Autorin und Predigerin vor. Sie erläutert den Kontext der Arbeit und die Fragestellungen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen.
1 Historische Rahmenbedingungen um 1200
Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Rahmenbedingungen im 12. Jahrhundert und erläutert die Bedeutung und Dimension von Literalität in dieser Zeit. Es setzt sich zudem mit der spezifischen Situation von Frauen in der mittelalterlichen Gesellschaft auseinander.
2 Hildegard von Bingen
Dieses Kapitel befasst sich mit Hildegard von Bingen selbst. Es wird die Quellenlage und die Relevanz von Legenden für die historische Einordnung ihrer Person diskutiert. Anschließend wird Hildegards Bildungs- und Lebensweg beleuchtet, um Aufschluss über ihre Lese- und Schreibkompetenz zu gewinnen. Darüber hinaus werden die Modalitäten und Impulse ihres Werkes sowie die Adressaten und Wirkung ihres Epistolariums analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Literalität, Hildegard von Bingen, Mittelalter, Schriftkultur, Frauenrolle, Bildung, Mystik, Frömmigkeit, Epistolarium, Lebensweg, Werk, Einfluss, Gesellschaft. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Hildegards Leben und Werk und beleuchtet ihre einzigartige Position in der mittelalterlichen Gesellschaft.
- Quote paper
- Sabrina Schultjan (Author), 2016, Das Leben der Hildegard von Bingen. Was war Gegenstand ihrer Schriften und Erläuterungen zu "Litterae ignotae" und "Lingua ignota", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376425