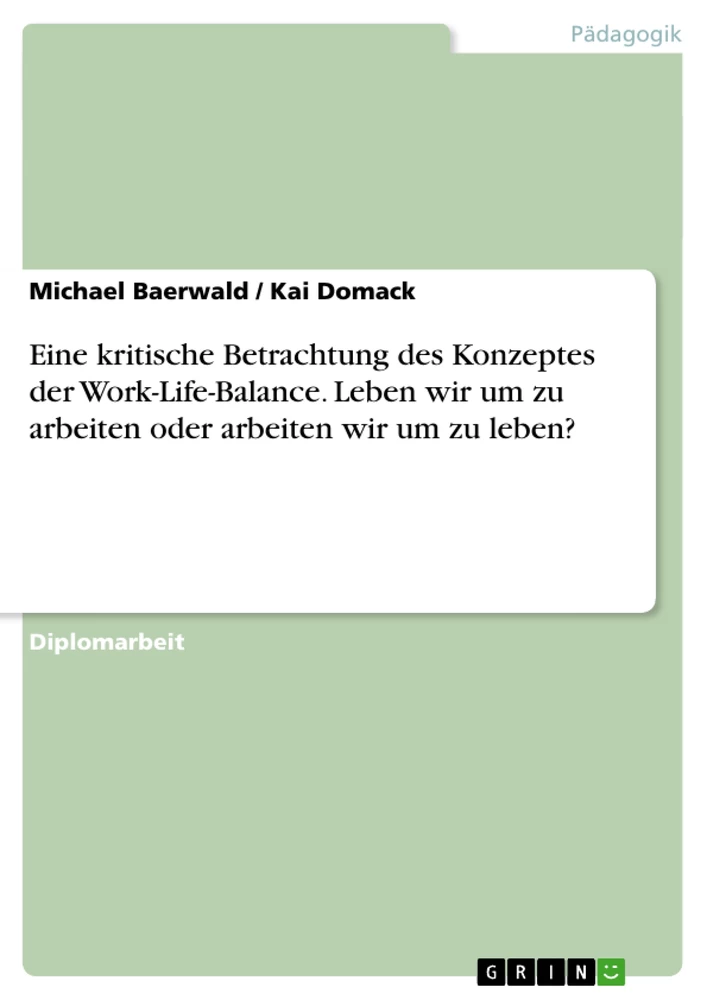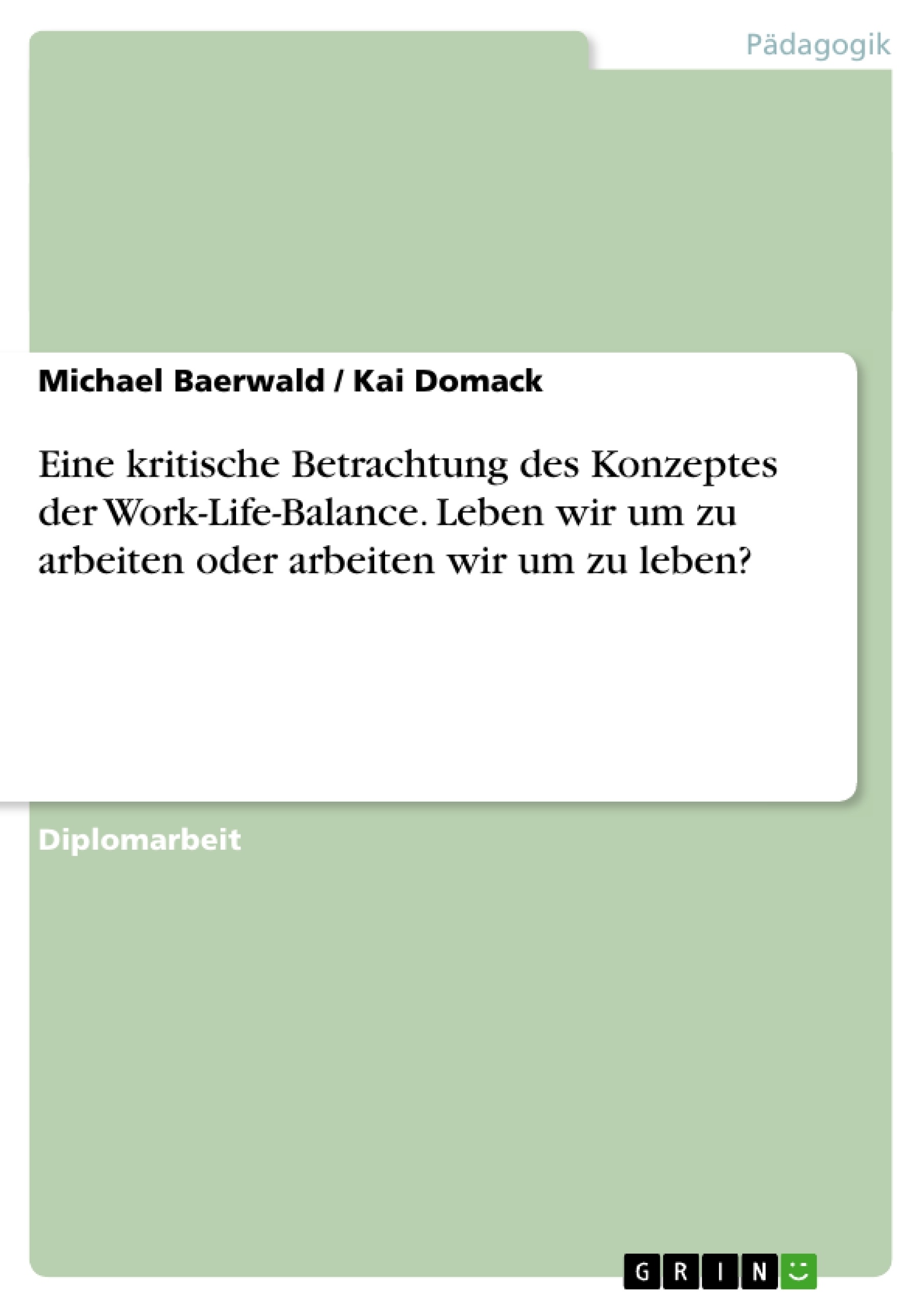Vorwort
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik „Work-Life-Balance“. Hinter diesem neudeutschen Anglizismus versteckt sich ein deutlich zunehmendes Spannungsverhältnis der Lebensbereiche Arbeit bzw. Beruf auf der einen Seite und Familie bzw. Freizeit auf der anderen Seite.
Unser Interesse an der Arbeit begründet sich aus der Teilnahme an der Lehrveranstaltung Postmoderne I und II, bei der Prof. Dr. Kh. GEIßLER und Dipl.Päd. Andreas THEODORFF uns den Blick für das Individuum in der heutigen Zeit eröffnet haben. Mit dem vermittelten Grundverständnis für die Entwicklungsdynamiken von der Moderne zur Postmoderne oder auch „Reflexiven Moderne“, wie sie beispielsweise von BECK et al. (1994) genannt wird, haben wir begonnen unsere eigene Situation zu reflektieren. Wir stellten fest, dass wir im Laufe unserer militärischen Laufbahn, genau wie viele junge Berufseinsteiger aber auch langjährig Berufstätige, persönlich von einer Dysbalance in den verschiedenen Lebensbereichen betroffen waren bzw. sind. Die Erfordernisse der Arbeitswelt dehnen sich zunehmend in die angrenzenden Lebensbereiche aus. Dies führt schließlich dazu, dass wir auch den privaten Bereich – vor allem in zeitlicher Hinsicht – zunehmend rationell gestalten müssen, um die heutigen Anforderungen zu bewältigen. HABERMAS (1981) hat dies als „Kolonialisierung der Lebenswelt“ bezeichnet und „damit seiner Kritik an einer Gesellschaft Ausdruck verliehen, die sich nur noch an marktförmigen Rationalitäten orientiert.“ (THEDORFF 2004, S.48) Die Floskel „keine Zeit“ und das allgegenwärtige Klagen über Stress und Überforderung werden zur Normalität und damit als unhinterfragte Entschuldigung für das mangelnde soziale Engagement bis hinunter auf die familiäre bzw. partnerschaftliche Ebene akzeptiert.
Wir versuchen im Rahmen dieser Arbeit zu hinterfragen, woher dieser Stress und Druck resultiert, wo wir doch eigentlich heute mehr Freiheiten und auch mehr Freizeit denn je haben. Wir selbst haben im Rahmen der militärischen Ausbildung erlebt, was es heißt sich den Anforderungen der Arbeit komplett unterzuordnen und auch den privaten, außerberuflichen Lebensbereich daran auszurichten. Arbeiten bis spät in die Nacht, Wochenenddienste und tagelange bzw. wochenlange Gefechtsübung haben dabei einen teilweise sehr hohen Tribut gefordert.
Wir stellen uns daher die Frage:
Leben wir um zu arbeiten oder arbeiten wir um zu leben?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Work-Life-Balance
- 1.1 Work-Life-Balance: Bitte? - Noch nie gehört!
- 1.2 Work-Life-Balance - Ein facettenreicher Begriff
- 1.3 Arbeit und Leben - Zwei unvereinbare Gegenpole?
- 1.4 Historische Rekonstruktion des Konzeptes „Work-Life-Balance“
- 1.5 Work-Life-Balance - Vorteilhaft für alle Akteure
- 1.6 Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen
- 1.6.1 Die Kosten mangelnder Work-Life-Balance
- 1.6.2 Kosten für die Förderung von Work-Life-Balance
- 2. Die Rahmenbedingungen des täglichen Lebens
- 2.1 Modernisierung und Veränderung – Aber wie?
- 2.2 Mirkoelektronik - Fluch oder Segen?
- 2.3 Weltwirtschaftlicher Wandel und Globalisierung
- 2.4 Wertewandel
- 2.4.1 Arbeit wie eh und je?
- 2.4.2 Individualisierung: Ich bin mein eigener Herr - und zwar allein!
- 2.4.3 Die stille Reserve - Frauen machen mobil
- 2.4.4 Familie: Von der Notgemeinschaft zur Wahlgemeinschaft
- 2.5 Demographie: Die Pyramide kippt
- 2.6 Wandel total - ein Zwischenfazit
- 3. Zeit und Zeitverständnis
- 3.1 Warum Zeit?
- 3.2 Das vormoderne Zeitverständnis
- 3.3 Das moderne Zeitverständnis
- 3.4 Das postmoderne Zeitverständnis
- 3.5 Halten wir kurz inne! - ein Zwischenfazit
- 4. Arbeitszeit
- 4.1 Von der Stechuhr zum 24-Stunden-Tag
- 4.2 Folgen flexibilisierter Arbeitszeiten
- 4.3 Arbeiten immer und überall - ein Zwischenfazit
- 5. Entwicklung von Arbeit und Freizeit
- 5.1 Grundlagen von Arbeit und Freizeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch das Spannungsfeld zwischen Arbeit und Leben, insbesondere im Kontext der Work-Life-Balance. Die Autoren reflektieren ihre eigenen Erfahrungen und analysieren die gesellschaftlichen Veränderungen, die zu einer zunehmenden Belastung in diesem Bereich führen. Ziel ist es, die Ursachen für Stress und Überforderung zu ergründen und den Diskurs um die Work-Life-Balance zu beleuchten.
- Die zunehmende Belastung durch die Anforderungen der Arbeitswelt.
- Der Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen (Modernisierung, Globalisierung, Wertewandel) auf die Work-Life-Balance.
- Die Rolle von Zeit und Zeitverständnis in der Gestaltung von Arbeit und Leben.
- Die Auswirkungen flexibilisierter Arbeitszeiten.
- Der Konflikt zwischen individuellen Bedürfnissen und den Erfordernissen des Arbeitsmarktes.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Work-Life-Balance ein und beschreibt das zunehmende Spannungsverhältnis zwischen Arbeit und Privatleben. Die Autoren erläutern ihre Motivation für die Arbeit und beleuchten die Problematik aus persönlicher und gesellschaftlicher Perspektive, wobei sie den Begriff der „Kolonialisierung der Lebenswelt“ von Habermas (1981) im Kontext von zunehmendem Stress und Überforderung diskutieren.
1. Work-Life-Balance: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Work-Life-Balance und untersucht seine verschiedenen Facetten. Es wird eine historische Perspektive eingenommen und die Vorteile einer ausgewogenen Work-Life-Balance für alle Beteiligten betrachtet. Wirtschaftliche Aspekte, inklusive der Kosten einer schlechten Work-Life-Balance und der Investitionen in familienfreundliche Maßnahmen, werden ebenfalls analysiert.
2. Die Rahmenbedingungen des täglichen Lebens: Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftlichen Veränderungen, die die Work-Life-Balance beeinflussen. Es betrachtet die Modernisierung, den Einfluss der Mikroelektronik, die Globalisierung und den Wertewandel mit seinen Auswirkungen auf Arbeit, Individualisierung und die Familie. Der demografische Wandel und seine Konsequenzen werden ebenfalls beleuchtet.
3. Zeit und Zeitverständnis: Dieses Kapitel widmet sich verschiedenen Zeitverständnissen – vormodern, modern und postmodern – und untersucht deren Einfluss auf die Wahrnehmung und Organisation von Arbeit und Freizeit. Es analysiert, wie unterschiedliche Zeitverständnisse die Work-Life-Balance beeinflussen können.
4. Arbeitszeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Arbeitszeit von der Stechuhr bis hin zum 24-Stunden-Tag. Es untersucht die Folgen flexibilisierter Arbeitszeiten und die damit verbundenen Herausforderungen für die Work-Life-Balance.
5. Entwicklung von Arbeit und Freizeit: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der Interaktion zwischen Arbeit und Freizeit. Es bietet einen Rahmen zur Analyse der komplexen Dynamik zwischen diesen beiden Bereichen des Lebens.
Schlüsselwörter
Work-Life-Balance, Stress, Überforderung, Modernisierung, Globalisierung, Wertewandel, Individualisierung, Familie, Arbeitszeit, Zeitverständnis, Modernität, Postmoderne, Reflexive Moderne, Betriebswirtschaft.
FAQ: Work-Life-Balance - Eine kritische Untersuchung
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Work-Life-Balance. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der kritischen Untersuchung des Spannungsfelds zwischen Arbeit und Leben, insbesondere im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Aspekte der Work-Life-Balance, darunter die zunehmende Belastung durch die Arbeitswelt, den Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen (Modernisierung, Globalisierung, Wertewandel), die Rolle von Zeit und Zeitverständnis, die Auswirkungen flexibilisierter Arbeitszeiten und den Konflikt zwischen individuellen Bedürfnissen und den Erfordernissen des Arbeitsmarktes. Es werden historische Perspektiven beleuchtet und wirtschaftliche Aspekte der Work-Life-Balance analysiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Work-Life-Balance (Definition, historische Entwicklung, wirtschaftliche Aspekte), Die Rahmenbedingungen des täglichen Lebens (Modernisierung, Globalisierung, Wertewandel, Demografie), Zeit und Zeitverständnis (vormodern, modern, postmodern), und Arbeitszeit (Entwicklung, Flexibilisierung). Ein fünftes Kapitel legt die Grundlagen für das Verständnis der Interaktion zwischen Arbeit und Freizeit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch das Spannungsfeld zwischen Arbeit und Leben und zielt darauf ab, die Ursachen für Stress und Überforderung im Kontext der Work-Life-Balance zu ergründen. Die Autoren reflektieren ihre eigenen Erfahrungen und analysieren gesellschaftliche Veränderungen, die zu einer zunehmenden Belastung in diesem Bereich führen. Der Diskurs um die Work-Life-Balance wird beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Work-Life-Balance, Stress, Überforderung, Modernisierung, Globalisierung, Wertewandel, Individualisierung, Familie, Arbeitszeit, Zeitverständnis, Modernität, Postmoderne, Reflexive Moderne, Betriebswirtschaft.
Wie wird der Begriff "Work-Life-Balance" definiert?
Der Begriff "Work-Life-Balance" wird im ersten Kapitel definiert und seine verschiedenen Facetten untersucht. Es wird eine historische Perspektive eingenommen und der Begriff im Kontext von Stress und Überforderung, sowie im Kontext der "Kolonialisierung der Lebenswelt" (Habermas, 1981) diskutiert.
Welche gesellschaftlichen Veränderungen werden analysiert?
Das zweite Kapitel analysiert die Auswirkungen von Modernisierung, Mikroelektronik, Globalisierung, Wertewandel (inkl. Individualisierung und Veränderungen der Familienstrukturen) und demografischem Wandel auf die Work-Life-Balance.
Wie wird das Thema "Zeit und Zeitverständnis" behandelt?
Kapitel drei widmet sich unterschiedlichen Zeitverständnissen (vormodern, modern, postmodern) und untersucht deren Einfluss auf die Wahrnehmung und Organisation von Arbeit und Freizeit. Es wird analysiert, wie verschiedene Zeitverständnisse die Work-Life-Balance beeinflussen.
Wie wird das Thema "Arbeitszeit" behandelt?
Kapitel vier behandelt die Entwicklung der Arbeitszeit von der Stechuhr bis zum 24-Stunden-Tag und untersucht die Folgen flexibilisierter Arbeitszeiten und die damit verbundenen Herausforderungen für die Work-Life-Balance.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, das Dokument enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die zentralen Inhalte und Argumente jedes Kapitels prägnant darstellt.
- Quote paper
- Michael Baerwald (Author), Kai Domack (Author), 2004, Eine kritische Betrachtung des Konzeptes der Work-Life-Balance. Leben wir um zu arbeiten oder arbeiten wir um zu leben?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37636