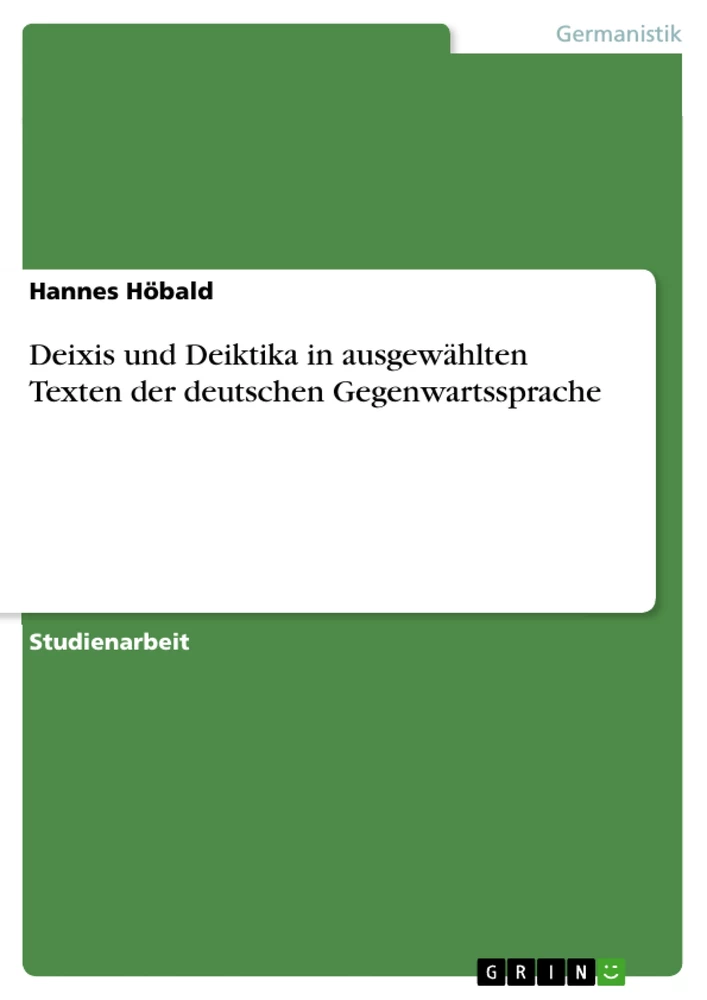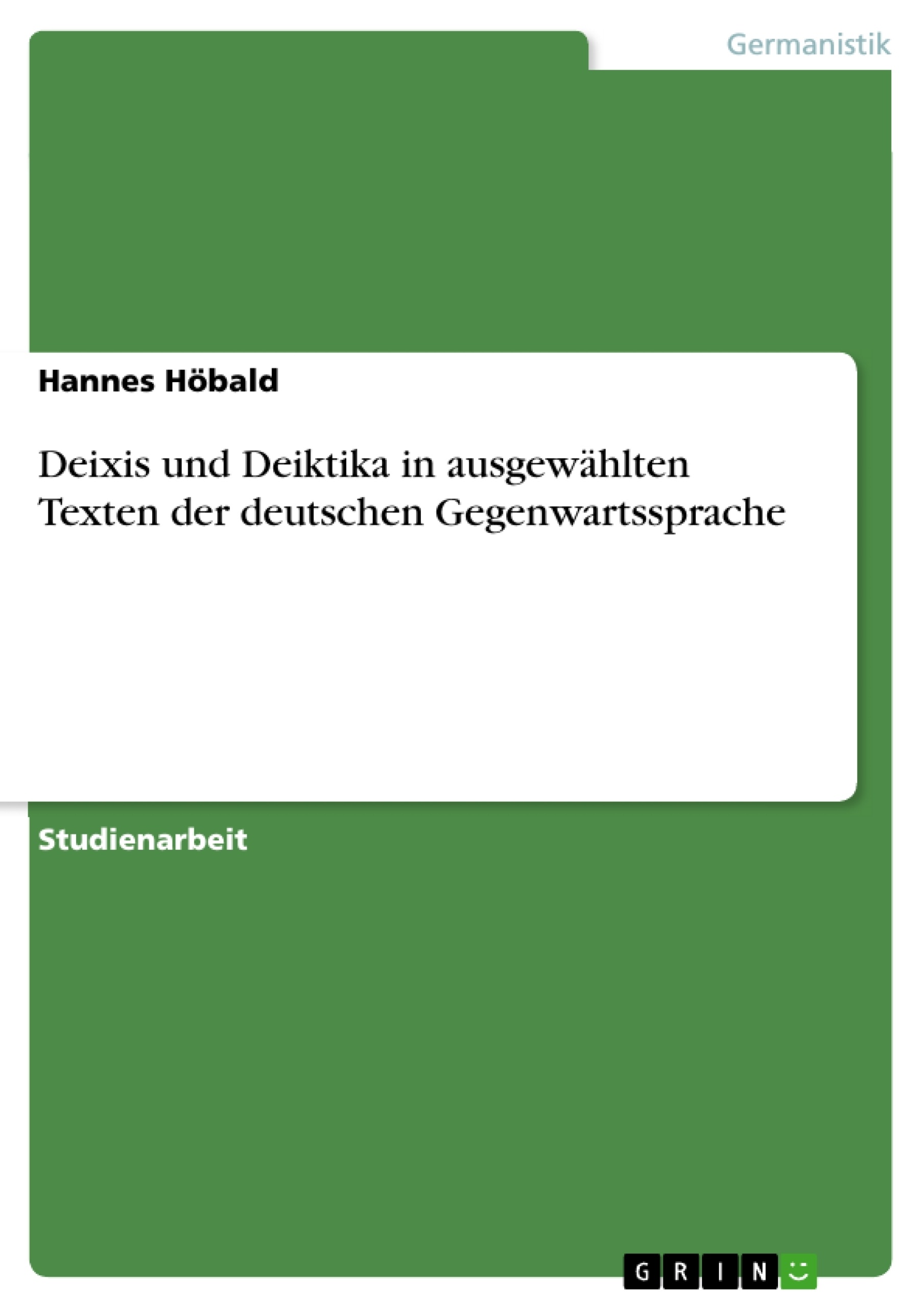In Gesprächen von Angesicht zu Angesicht ist es noch relativ leicht zu zeigen, was man meint. Man deutet mit dem Finger darauf und der Hörer weiß sofort, dass dieses oder jenes gemeint ist. Trotzdem finden sich in der mündlichen Kommunikation relativ viele Deiktika, auch wenn man sich dessen als Sprecher oder Hörer nicht wirklich bewusst ist. Wie aber verhält es sich in Texten verschiedenster Art mit Deiktika? Findet man in bestimmten Textsorten mehr oder weniger Deiktika? Weisen literarische Texte andere Deiktika auf als nicht literarische Texte? Gibt es typische Deiktika, die bestimmte Textsorten prägen? All diese und weitere Fragen im Detail zu klären würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, aber trotzdem soll versucht werden einen kleinen Überblick über dieses Thema zu geben, weshalb unterschiedliche Textsorten verwendet werden und nicht nur ein bestimmter Typ, wie etwa der des fiktionalen Textes. Es sollen hier nicht unterschiedliche Textsorten miteinander verglichen werden, jedenfalls nicht das, was nichts mit dem Thema zu tun hat. Die verschiedenen Textsorten sollen die unterschiedliche Verwendung von Deiktika in bestimmten Texten verdeutlichen. Hierbei wurde versucht eine Auswahl zu treffen, die sich nicht nur auf einen Bereich beschränkt, da man bei gegenwartssprachlichen Texten ja nicht nur literarische Werke verwenden muss. Ein Teil der Texte wurde ganz untersucht und ein anderer Teil nur auszugsweise aufgrund des Umfangs.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Deixis
- 2.1. Origo
- 2.2. Personaldeixis
- 2.3. Temporaldeixis
- 2.4. Lokaldeixis
- 2.5. Textdeixis
- 3. Deiktika in ausgewählten Texten
- 3.1. Presseartikel
- 3.2. Lexikoneintrag
- 3.3. Satirischer Text
- 3.4. Literarischer Text
- 3.5. Essay
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung von Deixis und Deiktika in verschiedenen Textsorten der deutschen Gegenwartssprache. Ziel ist es, einen Überblick über die unterschiedliche Anwendung von Deixis in verschiedenen Texttypen zu geben und die Besonderheiten der jeweiligen Verwendung zu beleuchten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse ausgewählter Texte, um die Vielfältigkeit der deiktischen Ausdrucksmittel zu verdeutlichen.
- Untersuchung der Deixis als sprachliches Zeigemittel
- Analyse der verschiedenen Deixisformen (Personal-, Temporal-, Lokal-, Textdeixis)
- Vergleich der Verwendung von Deiktika in unterschiedlichen Textsorten (Presseartikel, Lexikoneintrag, satirischer Text, literarischer Text, Essay)
- Herausarbeitung der kontextuellen Abhängigkeit der Interpretation von Deiktika
- Behandlung der Herausforderungen bei der Interpretation deiktischer Ausdrücke
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Deixis und Deiktika ein und skizziert die Forschungsfrage. Sie erläutert die Notwendigkeit, verschiedene Textsorten zu untersuchen, um ein umfassendes Verständnis der Verwendung von Deiktika zu gewinnen. Die Auswahl der zu analysierenden Texte (Presseartikel, Lexikoneintrag, satirischer Text, literarischer Text, Essay) wird begründet und die Vorgehensweise der Analyse umrissen. Der Fokus liegt auf der Erforschung der unterschiedlichen Verwendung von Deixis in den verschiedenen Texttypen, nicht auf einem direkten Vergleich der Textsorten selbst. Die Arbeit verdeutlicht die komplexen Herausforderungen der Analyse deiktischer Ausdrücke und setzt den Rahmen für die detaillierte Betrachtung der Deixis im folgenden Kapitel.
2. Deixis: Dieses Kapitel liefert eine grundlegende Einführung in den Begriff der Deixis als sprachliches Zeigemittel. Ausgehend von Bühlers Sprachtheorie und dem Konzept der Origo, wird die deiktische Prozedur als sprachliches "zeigen" erläutert. Es werden die zentralen Elemente des Zeigfelds und die Bedeutung der Origo ("Ich-jetzt-hier") herausgestellt. Die Origo wird als Mittelpunkt beschrieben, von dem aus die Beziehung zu anderen Objekten im Diskurs hergestellt wird. Die Kapitel legt die Basis für das Verständnis der folgenden Unterkapitel, die sich mit den verschiedenen Deixisformen befassen. Der egozentrische Charakter der Deixis und die damit verbundenen interpretatorischen Herausforderungen werden angesprochen.
2.1. Origo: Dieses Unterkapitel präzisiert den Begriff der Origo als den Mittelpunkt des Zeigfelds, von dem aus alle deiktischen Bezugnahmen erfolgen. Es wird der egozentrische Charakter der Deixis hervorgehoben, da alles um die Origo und deren Beziehung zu den dargestellten Objekten kreist. Die Origo teilt den Raum konzeptuell in origoinklusive und origoexklusive Bereiche. Die Herausforderung, die Origo in einem Satz präzise zu identifizieren, wird ebenfalls angesprochen, da die räumliche Lage des Sprechers oft nicht eindeutig festlegbar ist (z.B. "hier in Leipzig"). Trotz der potenziellen Schwierigkeiten wird betont, dass die Origo zentral für das Verständnis deiktischer Bezugnahmen ist.
2.2. Personaldeixis: Dieses Unterkapitel fokussiert sich auf die Personaldeixis als Mittel der Identifizierung von Gesprächspartnern. Es wird der hohe Grad an Kontextgebundenheit bei der Interpretation von Personaldeiktika, insbesondere Pronomina, hervorgehoben. Der Unterschied zwischen der Verwendung von "ich" in einem fiktiven Text und der Verwendung in einem autobiografischen Text wird als Beispiel genannt. Die Bedeutung der Groß- und Kleinschreibung bei der Interpretation von Anreden (z.B. "Sie" vs. "sie") wird ebenfalls erläutert. Der Einbezug der Sozialdeixis als Unterform der Personaldeixis wird erwähnt, ohne jedoch detailliert darauf einzugehen.
2.3. Temporaldeixis: Das Unterkapitel behandelt die Temporaldeixis und deren Funktion, die zeitliche Orientierung im Diskurs zu verankern. Starke Temporaldeiktika (z.B. "heute", "nächstes Jahr") werden von schwachen Temporaldeiktika (Verben, die den Zeitpunkt implizit angeben) unterschieden. Die Rolle von Verben bei der Kennzeichnung der Zeit wird erklärt, wobei das Beispiel "trinkt" (Gegenwart) und "wird trinken" (Zukunft) verwendet wird. Das historische Präsens wird als Ausnahme erwähnt, deren Interpretation kontextuell abgeleitet werden muss. Das Kapitel verdeutlicht die Komplexität der zeitlichen Bezugnahme in Sprache.
2.4. Lokaldeixis: Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Lokaldeixis, die sich auf die räumliche Orientierung bezieht. Ähnlich wie bei der Temporaldeixis, spielen lokale Adverbien (z.B. "dort", "da"), Präpositionen (z.B. "vor") und Demonstrativpronomina (z.B. "jener") eine wichtige Rolle. Das Koordinationsproblem und das Abgrenzungsproblem werden als Herausforderungen bei der Interpretation lokaler Deiktika angesprochen. Als Beispiel wird die Verwendung von "hier" in einer E-Mail genannt, die sich auf den Ort des Schreibenden, nicht des Lesenden bezieht. Die Vieldeutigkeit lokaler Deiktika wird anhand des Beispiels "hier" illustriert, das sowohl eine kleine Wohnung als auch die ganze Welt bezeichnen kann.
Schlüsselwörter
Deixis, Deiktika, Origo, Personaldeixis, Temporaldeixis, Lokaldeixis, Textdeixis, Textsorten, Gegenwartssprache, Sprachliches Zeigen, Kontextgebundenheit, Interpretation, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Deixis und Deiktika in ausgewählten Texten"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verwendung von Deixis und Deiktika in verschiedenen Textsorten der deutschen Gegenwartssprache. Der Fokus liegt auf der Analyse der unterschiedlichen Anwendung von Deixis in verschiedenen Texttypen und der Beleuchtung der Besonderheiten der jeweiligen Verwendung.
Welche Textsorten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Texte aus fünf verschiedenen Textsorten: Presseartikel, Lexikoneintrag, satirischer Text, literarischer Text und Essay. Diese Auswahl dient dazu, die Vielfältigkeit der deiktischen Ausdrucksmittel zu verdeutlichen.
Was ist Deixis und was sind Deiktika?
Deixis bezeichnet das sprachliche "Zeigen". Deiktika sind die sprachlichen Mittel, die dieses Zeigen ermöglichen, wie z.B. Pronomen ("ich", "du", "er"), Adverbien ("hier", "da", "jetzt", "dann") und Demonstrativpronomen ("dieser", "jener").
Welche Arten von Deixis werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Formen der Deixis: Personaldeixis (Bezug auf Personen), Temporaldeixis (Bezug auf Zeit), Lokaldeixis (Bezug auf Ort) und Textdeixis (Bezug auf Textstellen).
Was ist die Origo?
Die Origo ist der Mittelpunkt des deiktischen Bezugsrahmens, der meist mit dem Sprecher ("Ich"), dem Sprechzeitpunkt ("Jetzt") und dem Sprechort ("Hier") identifiziert wird. Alles im Diskurs wird in Relation zur Origo gesetzt.
Welche Herausforderungen werden bei der Interpretation von Deiktika angesprochen?
Die Arbeit hebt die Kontextgebundenheit der Interpretation von Deiktika hervor. Die Bedeutung deiktischer Ausdrücke hängt stark vom Kontext ab und kann mehrdeutig sein. Die Identifizierung der Origo und die Unterscheidung zwischen starken und schwachen Deiktika stellen besondere Herausforderungen dar.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur allgemeinen Deixis mit Unterkapiteln zu den verschiedenen Deixisformen, ein Kapitel zur Analyse der Deixis in den ausgewählten Texten und einen Schluss. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deixis, Deiktika, Origo, Personaldeixis, Temporaldeixis, Lokaldeixis, Textdeixis, Textsorten, Gegenwartssprache, Sprachliches Zeigen, Kontextgebundenheit, Interpretation, Kommunikation.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit hat zum Ziel, einen Überblick über die unterschiedliche Anwendung von Deixis in verschiedenen Texttypen zu geben und die Besonderheiten der jeweiligen Verwendung zu beleuchten. Sie soll die Vielfältigkeit der deiktischen Ausdrucksmittel verdeutlichen und die Herausforderungen bei der Interpretation deiktischer Ausdrücke behandeln.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Personen gedacht, die sich akademisch mit Linguistik, insbesondere mit der deutschen Gegenwartssprache, befassen. Sie eignet sich für Studierende und Forschende, die sich mit dem Thema Deixis auseinandersetzen wollen.
- Quote paper
- Hannes Höbald (Author), 2010, Deixis und Deiktika in ausgewählten Texten der deutschen Gegenwartssprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376233