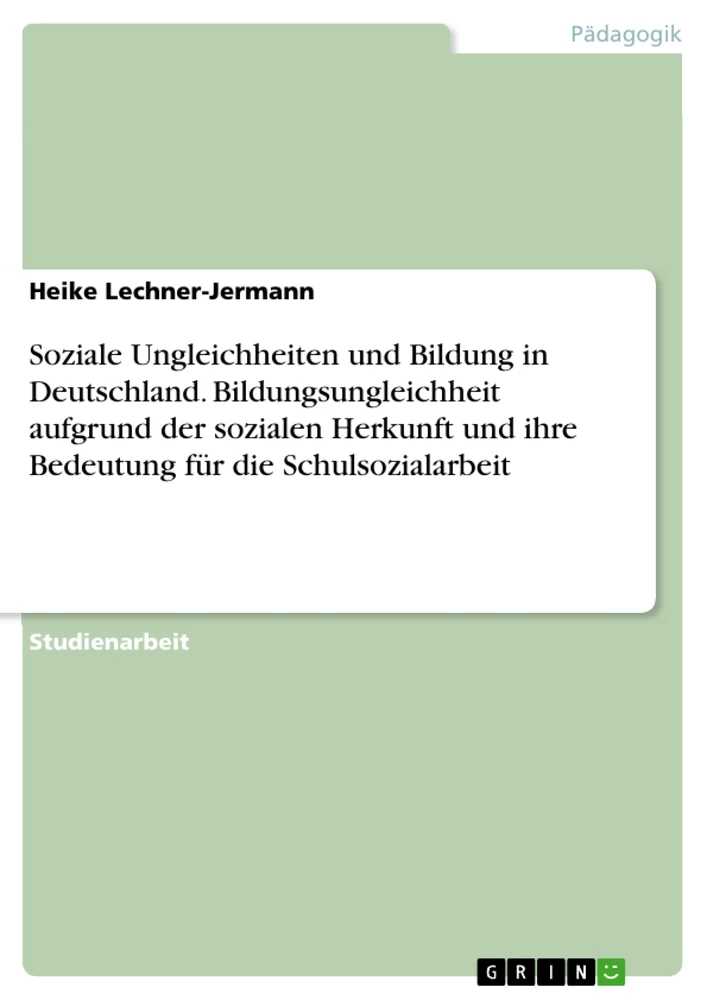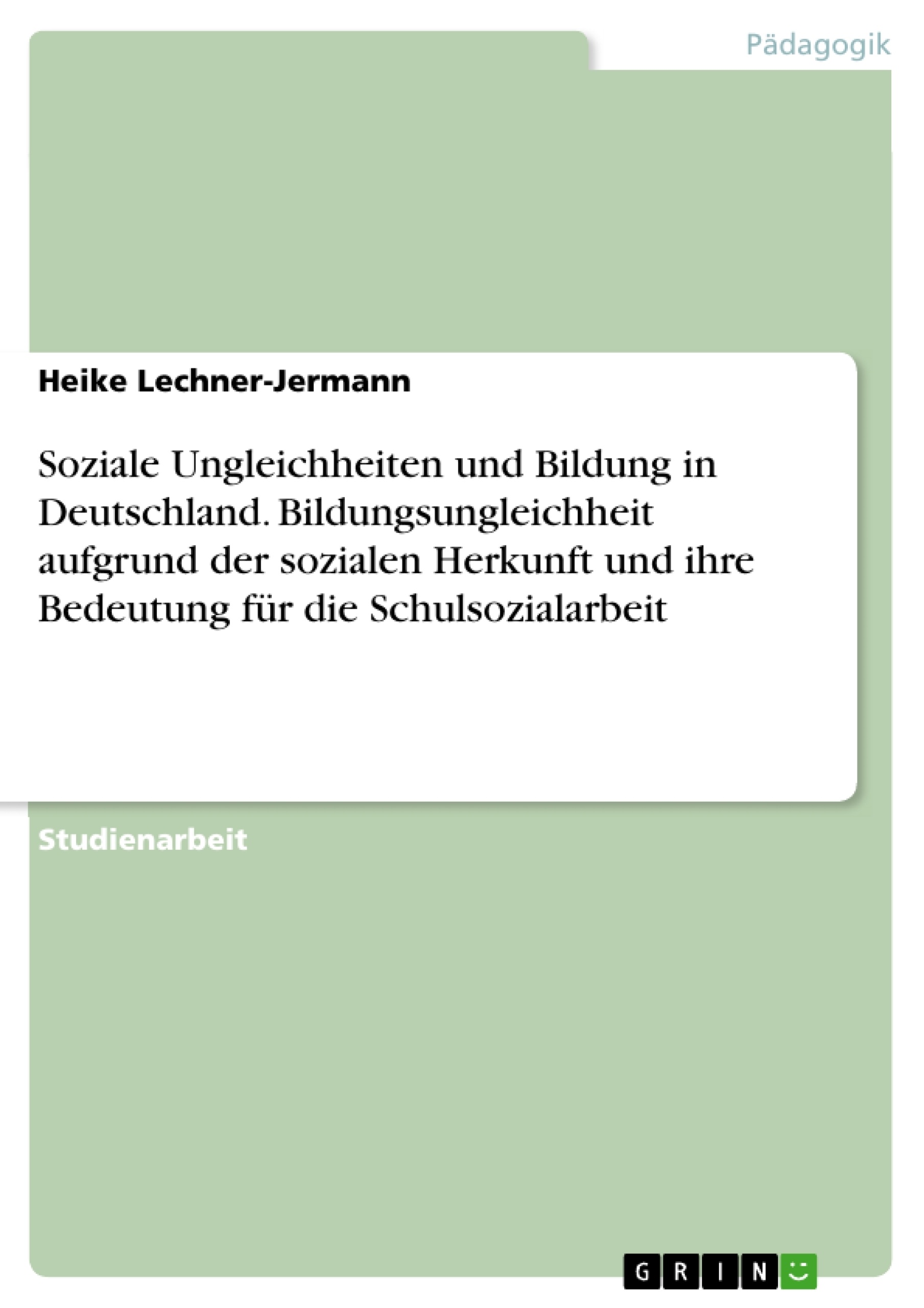Bildung ist eine der wichtigsten sozialen Fragen des 21. Jahrhunderts und nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Sie ist Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe und setzt die Weichenstellung für fast alle anderen Bereiche wie Arbeit, Einkommen Wohnen, Sozialstatus, politische Partizipation und private Lebensqualität der einzelnen Gesellschaftsmitglieder. Das Recht auf Bildung ist daher nicht nur ein autonomes Menschenrecht, sondern auch ein Instrument, um anderen Menschenrechten zu deren Einfluss zu verhelfen. Im Bereich Bildung zeigt sich soziale Gerechtigkeit folglich darin, dass Bildung in einer Gesellschaft für alle Menschen frei von Diskriminierung garantiert wird und Armut, Geschlecht, Migrationshintergrund und soziale Herkunft keine Rolle beim Zugang zu Bildung spielen dürfen. Dieses Ziel hat Deutschland aber noch nicht erreicht.
Das Bildungssystem in Deutschland weist, das zeigen mehrere Studien auf, in Bezug auf Bildungsgerechtigkeit größere Mängel auf. Hier wird ersichtlich, dass ein großer Zusammenhang zwischen Leistungskompetenz und sozialer Herkunft besteht und Deutschland noch weit davon entfernt ist, sich mit Chancengleichheit in Bezug auf Bildung zu rühmen, obwohl soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit Werte sind, die in Deutschland durchaus von Bedeutung sein sollten.
Doch welche Ungerechtigkeiten bestehen im Hinblick auf soziale Herkunft tatsächlich im deutschen Schulsystem und wie kann Soziale Arbeit, bzw. hier konkreter Schulsozialarbeit, dies versuchen auszugleichen? Diese Arbeit befasst sich mit dieser Problematik. Dazu werden zunächst einige relevante Begriffe definiert, um darauffolgend die bestehenden Ursachen sozialer Bildungsungleichheiten aufzuzeigen. Die theoretischen Ansätze zur Erklärung der herkunftsspezifischen Ungleichheiten werden anhand der Ansätze von Pierre Bourdieu und Raymond Boudon dargestellt, um die bereits erläuterten Aussagen zu den Ursachen der Bildungsbenachteiligung zu erklären. Darauffolgend geht es dann um die Folgerungen der Schulsozialarbeit auf die vorhergehenden Erkenntnisse und was Schulsozialarbeit zur Minderung der herkunftsspezifischen Benachteiligung im Bereich Bildung tun kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2. Begriffserklärungen
- 2.1 Soziale Ungleichheit
- 2.2. Bildungsungleichheit
- 2.3. Soziale Herkunft
- 3. Ursachen der Bildungsbenachteiligung
- 3.1 Die Bildungsexpansion
- 3.2. Institutionelle Bildungsungleichheit
- 4. Erklärungsmodelle der Bildungsungleichheiten
- 4.1 Die Reproduktion ungleicher Bildungschancen nach Bourdieu
- 4.2 Primäre und sekundäre Herkunftseffekte nach Boudon
- 4.2.1 primäre Herkunftseffekte
- 4.2.2 sekundäre Herkunftseffekte
- 5. Folgerungen für die Schulsozialarbeit
- 5.1 Übergang Grundschule an die weiterführenden Schulen (2. Schwelle)
- 5.2 Übergang in Ausbildung oder Studium (3. Schwelle)
- 5.3. Schulsozialarbeit an Gymnasien
- 5.4. Unterstützung in der Schulentwicklung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beleuchtet die Problematik der Bildungsungleichheit in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die soziale Herkunft. Sie analysiert die Ursachen und Auswirkungen dieser Ungleichheit und untersucht, wie Schulsozialarbeit dazu beitragen kann, diese zu mindern.
- Definitionen von sozialer Ungleichheit, Bildungsungleichheit und sozialer Herkunft
- Analyse der Ursachen von Bildungsbenachteiligung, insbesondere der Bildungsexpansion und der institutionellen Bildungsungleichheit
- Erklärung der Reproduktion ungleicher Bildungschancen anhand der Ansätze von Bourdieu und Boudon
- Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Schulsozialarbeit, um herkunftsspezifische Benachteiligung im Bildungsbereich zu reduzieren
- Zusammenfassende Betrachtung der Bedeutung sozialer Herkunft im Kontext der Bildungsungleichheit in Deutschland.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die Bedeutung des Rechts auf Bildung im Kontext sozialer Gerechtigkeit. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Bildung und sozialer Teilhabe sowie die Bedeutung der Bildung für die Lebensqualität und die Chancen der Menschen. Die Einleitung zeigt auf, dass Deutschland trotz Fortschritten in den Pisa-Studien noch immer große soziale Bildungsungleichheit aufweist und es wichtig ist, die Ursachen und Folgen dieser Ungleichheit genauer zu betrachten.
Das zweite Kapitel definiert zentrale Begriffe: soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit und soziale Herkunft. Es erläutert, wie ungleiche Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen zu unterschiedlichen Lebensbedingungen und sozialen Positionen führt. Die Bedeutung der Bildung im Kontext sozialer Ungleichheit wird hervorgehoben, da Bildung Einfluss auf zentrale Lebens- und Zukunftschancen hat.
Kapitel drei widmet sich den Ursachen der Bildungsbenachteiligung. Dabei werden die Bildungsexpansion und die institutionelle Bildungsungleichheit als zwei zentrale Faktoren beleuchtet. Die Bildungsexpansion hat zwar zu einer höheren Bildungsteilnahme geführt, gleichzeitig hat sie aber auch bestehende Ungleichheiten verstärkt. Die institutionelle Bildungsungleichheit bezieht sich auf die ungleichen Strukturen und Prozesse im Bildungssystem, die zu Benachteiligung bestimmter Gruppen führen.
In Kapitel vier werden zwei Erklärungsmodelle für Bildungsungleichheiten vorgestellt: der Ansatz von Bourdieu und der Ansatz von Boudon. Der Ansatz von Bourdieu fokussiert auf die Reproduktion ungleicher Bildungschancen durch die Vermittlung von Kapitalformen (kulturelles, soziales, ökonomisches Kapital). Boudons Ansatz konzentriert sich auf die primären und sekundären Herkunftseffekte, die die Bildungsentscheidungen von Individuen beeinflussen.
Kapitel fünf leitet Handlungsempfehlungen für die Schulsozialarbeit ab, die sich aus den zuvor dargestellten Ursachen und Erklärungsmodellen ableiten. Es geht um die Rolle der Schulsozialarbeit bei der Förderung von Bildungsgerechtigkeit, insbesondere in Bezug auf den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule und den Übergang in Ausbildung oder Studium. Darüber hinaus werden die Bedeutung von Schulsozialarbeit an Gymnasien und die Unterstützung in der Schulentwicklung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, soziale Herkunft, Bildungsexpansion, institutionelle Bildungsungleichheit, Bourdieu, Boudon, Kapitalformen, Herkunftseffekte und Schulsozialarbeit. Diese Begriffe bilden den Rahmen für die Analyse der Bildungsungleichheit in Deutschland und die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Schulsozialarbeit.
- Quote paper
- Heike Lechner-Jermann (Author), 2014, Soziale Ungleichheiten und Bildung in Deutschland. Bildungsungleichheit aufgrund der sozialen Herkunft und ihre Bedeutung für die Schulsozialarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376162