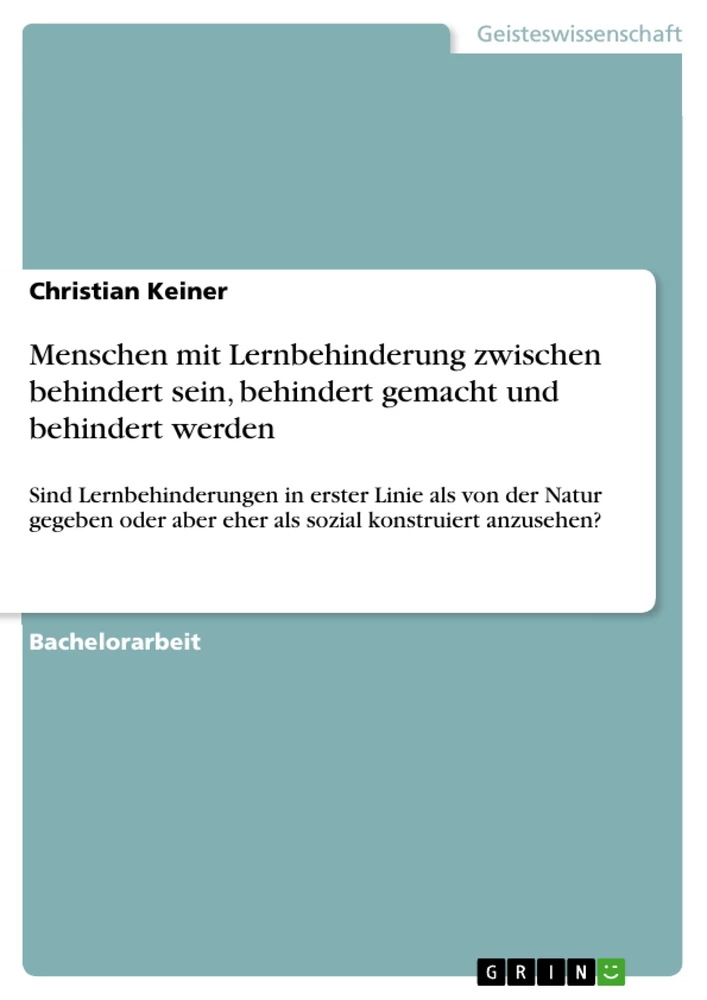Im Laufe der Arbeit wird diese entscheidende Fragestellung beantwortet: Sind Lernbehinderungen in erster Linie als von der Natur gegeben oder aber eher als sozial konstruiert anzusehen? Um dieser Frage tiefgreifend nachgehen zu können, wird das Thema aus den Blickwinkeln dreier wissenschaftlicher Disziplinen betrachtet. Dabei wird eine Disziplin auf der anderen aufbauen, um letzten Endes ein möglichst klares und umfassendes Gesamtbild zu erhalten.
Zunächst beschäftigt sich der Autor mit der Ansicht, dass Menschen mit Lernbehinderung auf Grund ihrer genetischen Dispositionen und kognitiven Voraussetzungen behindert sind. Diese medizinische Perspektive wird sich vor allem an den Klassifikationssystemen der ICD-10 sowie der DSM-V orientieren, welche auch erste genauere Definitionen zum Begriff Lernbehinderung sowie zu den Störungsbildern, die unter ihm subsumiert werden, liefern werden. Des Weiteren soll hier auch die Definition des Begriffes Behinderung, wie sie im SGB IX verwendet wird, thematisiert werden, da auch sie dem medizinischen Modell folgt und somit Einfluss auf die gesellschaftliche Wahrnehmung einer Behinderung sowie eines Menschen, der durch die Diagnose Behinderung etikettiert ist, hat.
Hieran anschließend wird die entwicklungspsychologische Perspektive betrachtet. Es soll dabei herausgefunden werden, inwieweit eine Behinderung, beispielsweise durch die Umstände des Aufwachsens, die familiale Situation und etwaige Störungen im Bindungsverhalten zwischen Eltern und Kind gemacht bzw. entwickelt worden ist. Urie Bronfenbrenners „Ökologische Systemtheorie der Entwicklung“ dient hierbei als wissenschaftliche Grundlage. Die umfangreichste Erforschung erfährt die soziologische Perspektive, anhand derer unter-sucht werden soll, ob eine gewisse Gruppe von Menschen derart stark behindert wird, dass eine Lernbehinderung als Konsequenz gesellschaftlicher Vorgänge resultiert. Als theoretische Grundlage werden hier zunächst Pierre Bourdieus Theorien der Klassen, des Kapitals sowie des Habitus skizziert.
Im Anschluss an die Einzelbetrachtung der drei Perspektiven sollen diese dann in ihrem Zu-sammenspiel besprochen werden, um zu sehen, welche Faktoren den größten Anteil an der Entwicklung einer Lernbehinderung haben und welche relevanten Zusammenhänge sich ergeben. Abgerundet wird diese Arbeit durch einen biografischen Forschungsteil, um die bis dahin gesammelten Ergebnisse überprüfen und evaluieren zu können
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die medizinische Perspektive (behindert sein)
- 2.1 Einführung
- 2.2 Klassifikationssysteme und Definitionen
- 2.2.1 Lernbehinderung nach ICD-10
- 2.2.1.1 Intelligenzstörung (F70-F79)
- 2.2.1.2 Entwicklungsstörungen (F80-F89)
- 2.2.2 Lernbehinderung nach DSM-V
- 2.2.2.1 Spezifische Lernstörung (F81)
- 2.2.2.2 Intellektuelle Entwicklungsstörung (F70-F73)
- 2.2.3 Behinderung nach SGB IX
- 2.3 Zusammenfassung
- 3. Die entwicklungspsychologische Perspektive (behindert gemacht)
- 3.1 Einführung
- 3.2 Bronfenbrenners Ökologische Systemtheorie der Entwicklung
- 3.3 Lernbehinderung anhand der Theorie
- 3.4 Zusammenfassung
- 4. Die soziologische Perspektive (behindert werden)
- 4.1 Einführung
- 4.2 Bourdieus Theorien
- 4.2.1 Kapital
- 4.2.2 Klassen
- 4.2.3 Habitus
- 4.3 Lernbehinderung anhand der Theorien
- 4.3.1 Wirkung des Kapitals
- 4.3.2 Auswirkungen von Armut und Vernachlässigung
- 4.3.3 Auswirkungen von Schule und Bildung
- 4.3.4 Auswirkungen des Stigmas Lernbehinderung
- 4.3.5 (Lern-)Behinderung als soziales Konstrukt
- 4.3.6 (Lern-)Behinderung nach ICF
- 4.4 Zusammenfassung
- 5. Zusammenwirken der Perspektiven
- 6. Biografiearbeit anhand qualitativer Forschung
- 6.1 Einführung
- 6.2 Interviewführung
- 6.3 Themen
- 6.4 Transkription
- 7. Die persönliche Perspektive
- 7.1 Herr A
- 7.2 Herr B
- 7.3 Frau C
- 7.4 Frau D
- 7.5 Auswertung
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den komplexen Begriff der Lernbehinderung aus verschiedenen Perspektiven. Ziel ist es, ein umfassenderes Verständnis für die vielschichtigen Faktoren zu entwickeln, die zur Diagnose "Lernbehinderung" führen und die Lebensrealität betroffener Personen prägen.
- Medizinische Klassifizierung und Definition von Lernbehinderung
- Entwicklungspsychologische Einflüsse auf die Entstehung von Lernbehinderungen
- Soziologische Perspektiven und die soziale Konstruktion von Lernbehinderung
- Zusammenspiel der medizinischen, entwicklungspsychologischen und soziologischen Faktoren
- Qualitative Forschungsergebnisse aus Biografiearbeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Lernbehinderung ein und beschreibt die Schwierigkeiten bei der Definition und Diagnose. Der Autor erläutert seine Motivation, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ausgehend von seinen Erfahrungen in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Die Diskrepanz zwischen dem oftmals unscheinbaren Auftreten der Betroffenen im Alltag und ihrer Diagnose wird hervorgehoben, und die Notwendigkeit einer differenzierteren Betrachtungsweise wird betont.
2. Die medizinische Perspektive (behindert sein): Dieses Kapitel beleuchtet die medizinische Definition und Klassifizierung von Lernbehinderung anhand des ICD-10 und des DSM-V. Es werden verschiedene Störungsbilder und Klassifizierungssysteme detailliert vorgestellt, darunter Intelligenzstörungen, Entwicklungsstörungen und spezifische Lernstörungen. Die Grenzen und Unzulänglichkeiten dieser rein medizinischen Sichtweise werden implizit angesprochen, da die Einleitung bereits auf die unzureichende Erklärung der individuellen Fälle in der WfbM hingewiesen hat.
3. Die entwicklungspsychologische Perspektive (behindert gemacht): Dieses Kapitel betrachtet Lernbehinderung aus entwicklungspsychologischer Sicht. Es greift Bronfenbrenners ökologische Systemtheorie auf, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen dem Individuum und seiner Umwelt zu analysieren. Der Fokus liegt auf den Einflüssen verschiedener Systeme (Mikrosystem, Mesosystem, Exosystem, Makrosystem, Chronosystem) auf die Entwicklung und die Herausbildung von Lernbehinderungen. Es wird diskutiert, wie diese Faktoren zur Entstehung von Defiziten beitragen.
4. Die soziologische Perspektive (behindert werden): Dieses Kapitel analysiert Lernbehinderung unter soziologischen Aspekten, wobei Bourdieus Theorien zu Kapital, Klassen und Habitus im Mittelpunkt stehen. Es wird untersucht, wie soziale Ungleichheiten, Armut, Vernachlässigung, Stigmatisierung und die Rolle von Schule und Bildung die Entstehung und den Verlauf von Lernbehinderungen beeinflussen können. Die soziale Konstruktion von (Lern-)Behinderung und das ICF-Modell werden ebenfalls behandelt.
5. Zusammenwirken der Perspektiven: Dieses Kapitel synthetisiert die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel und zeigt auf, wie die medizinischen, entwicklungspsychologischen und soziologischen Perspektiven zusammenwirken und sich gegenseitig beeinflussen. Es wird eine ganzheitliche Betrachtungsweise präsentiert, die die Komplexität des Phänomens Lernbehinderung unterstreicht.
6. Biografiearbeit anhand qualitativer Forschung: Dieses Kapitel beschreibt die Durchführung qualitativer Forschungsmethoden im Kontext der Arbeit, insbesondere die Interviewführung und die daraus resultierenden Themen. Es geht um die methodische Vorgehensweise bei der Erhebung von biographischen Daten, um ein tieferes Verständnis der individuellen Lebenswelten von Menschen mit Lernbehinderung zu ermöglichen.
Schlüsselwörter
Lernbehinderung, ICD-10, DSM-V, ICF, Bronfenbrenners ökologische Systemtheorie, Bourdieu, Kapital, Habitus, soziale Ungleichheit, Stigmatisierung, qualitative Forschung, Biografiearbeit, Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), inklusive Bildung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Lernbehinderung aus verschiedenen Perspektiven
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den komplexen Begriff der Lernbehinderung aus verschiedenen Perspektiven – medizinisch, entwicklungspsychologisch und soziologisch – um ein umfassenderes Verständnis der Faktoren zu entwickeln, die zur Diagnose und Lebensrealität Betroffener beitragen.
Welche Perspektiven werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Lernbehinderung aus drei Hauptperspektiven: der medizinischen (Klassifizierungssysteme wie ICD-10 und DSM-V), der entwicklungspsychologischen (Bronfenbrenners ökologische Systemtheorie) und der soziologischen (Bourdieus Theorien zu Kapital, Klassen und Habitus). Zusätzlich wird die persönliche Perspektive von vier Betroffenen durch Biografiearbeit erforscht.
Welche Klassifizierungssysteme werden im medizinischen Teil behandelt?
Der medizinische Teil beschreibt detailliert die Klassifizierung von Lernbehinderung nach ICD-10 (Intelligenzstörungen, Entwicklungsstörungen) und DSM-V (spezifische Lernstörungen, intellektuelle Entwicklungsstörung). Die Grenzen dieser rein medizinischen Sichtweise werden kritisch betrachtet.
Welche entwicklungspsychologische Theorie wird angewendet?
Die Arbeit nutzt Bronfenbrenners ökologische Systemtheorie, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen Individuum und Umwelt zu analysieren und den Einfluss verschiedener Systeme (Mikrosystem, Mesosystem, Exosystem, Makrosystem, Chronosystem) auf die Entwicklung und Entstehung von Lernbehinderungen zu beleuchten.
Welche soziologischen Theorien werden verwendet?
Im soziologischen Teil werden Bourdieus Theorien zu Kapital, Klassen und Habitus herangezogen, um die Auswirkungen sozialer Ungleichheiten, Armut, Vernachlässigung, Stigmatisierung und die Rolle von Schule und Bildung auf die Entstehung und den Verlauf von Lernbehinderungen zu untersuchen. Das ICF-Modell und die soziale Konstruktion von Lernbehinderung werden ebenfalls thematisiert.
Wie wird die persönliche Perspektive der Betroffenen berücksichtigt?
Die persönliche Perspektive wird durch qualitative Forschung in Form von Biografiearbeit mit vier Betroffenen (Herr A, Herr B, Frau C, Frau D) gewonnen. Die Interviewführung, die Themen der Interviews und die Transkription werden detailliert beschrieben.
Welche Forschungsmethoden werden eingesetzt?
Die Arbeit verwendet qualitative Forschungsmethoden, insbesondere Biografiearbeit, mit Interviews als Datenerhebungsinstrument. Die methodische Vorgehensweise, inklusive Interviewführung und Transkription, wird ausführlich dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lernbehinderung, ICD-10, DSM-V, ICF, Bronfenbrenners ökologische Systemtheorie, Bourdieu, Kapital, Habitus, soziale Ungleichheit, Stigmatisierung, qualitative Forschung, Biografiearbeit, Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM), inklusive Bildung.
Wie werden die verschiedenen Perspektiven zusammengeführt?
Ein eigenes Kapitel synthetisiert die Erkenntnisse der medizinischen, entwicklungspsychologischen und soziologischen Perspektiven, um ein ganzheitliches Verständnis der Komplexität von Lernbehinderung zu vermitteln.
Wo finde ich die detaillierten Kapitelzusammenfassungen?
Die Arbeit enthält ausführliche Zusammenfassungen für jedes Kapitel, die die Kernaussagen und die Argumentationslinien jedes Abschnitts detailliert beschreiben.
- Quote paper
- Christian Keiner (Author), 2017, Menschen mit Lernbehinderung zwischen behindert sein, behindert gemacht und behindert werden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/376013