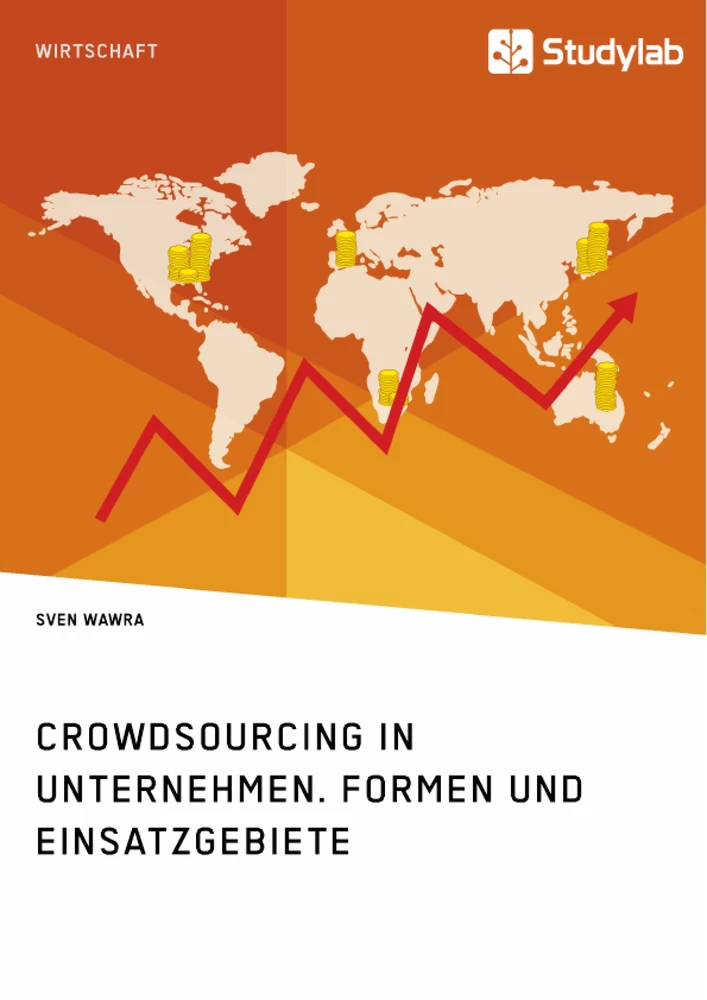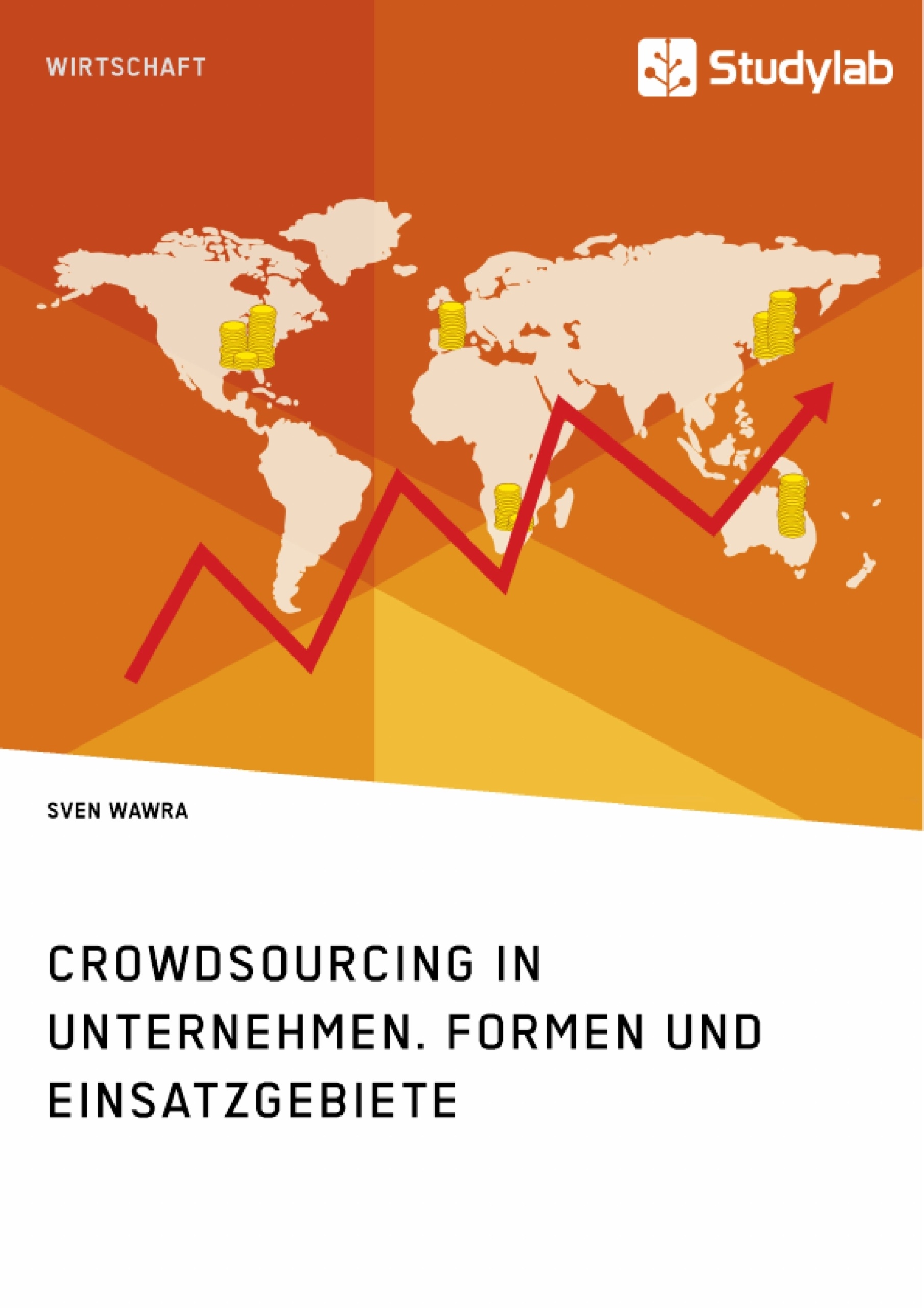Hat ein Unternehmen eine Aufgabe zu bearbeiten, steht es oftmals vor der Wahl, sie selbst zu erledigen oder sie an externe Vertragspartner weiterzugeben. Während diese externen Leistungserbringer traditionell im Rahmen des Outsourcing in anderen Unternehmen bzw. Selbstständigen oder Freiberuflern, häufig mit Tätigkeitsschwerpunkt auf genau der zu erledigenden Aufgabe, gefunden werden, hat sich im Verlauf des aktuellen Jahrtausends eine weitere Möglichkeit der Auslagerung von originär unternehmenseigenen Abläufen herausgebildet, die das Thema dieser Arbeit darstellt: Crowdsourcing.
In seiner Arbeit informiert der Autor darüber, welche Formen des Crowdsourcing existieren und wie Unternehmen sie einsetzen sollten. Er konzentriert sich dabei auf das deutsche Rechtsgebiet.
Aus dem Inhalt:
- Open Innovation;
- Crowd Tools;
- Collective Knowledge;
- Crowdcreation;
- Marketinginstrument
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Hinführung zum Thema
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Grundlagen des Crowdsourcing
- 2.1 Begrifflichkeiten und Akteure
- 2.1.1 Crowdsourcing
- 2.1.2 Crowdsourcer
- 2.1.3 Crowdsourcee
- 2.1.4 Crowdsourcing-Plattform
- 2.2 Grundzüge der Durchführung von Crowdsourcings
- 2.3 Heterogenität der Crowdsourcings und Notwendigkeit der Differenzierung
- 3 Systematisierung von Crowdsourcings
- 3.1 Überblick in der Literatur vertretener Systematisierungen
- 3.2 Analyse der Systematisierungen
- 3.2.1 Transfer englischer Bezeichnungen ins Deutsche und Synonyme
- 3.2.2 Jeff Howes ursprüngliche Gliederung
- 3.2.3 Mögliche Erweiterungen der ursprünglichen Gliederung
- 3.2.3.1 Microwork
- 3.2.3.2 Engagement & charity
- 3.2.3.3 Open Innovation
- 3.2.3.4 Crowd Tools, Community Building, Creative Content Marktplätze
- 3.2.3.5 Collective Knowledge
- 3.2.3.6 Einordnung von Überschneidungen von Collective Knowledge mit Crowdcreation und Crowdvoting
- 3.3 Abschließende Systematisierung von Crowdsourcing
- 3.4 Ausarbeitung der Gattungen
- 3.4.1 Microwork
- 3.4.1.1 Charakteristika der Aufgaben
- 3.4.1.2 Bearbeitung der Aufgaben
- 3.4.1.3 Gegenleistungen an die Crowdsourcees
- 3.4.2 Crowdcreation
- 3.4.2.1 Charakteristika der Aufgaben
- 3.4.2.2 Bearbeitung der Aufgaben
- 3.4.2.3 Gegenleistungen an die Crowdsourcees
- 3.4.3 Crowdvoting
- 3.4.3.1 Charakteristika der Aufgaben
- 3.4.3.2 Bearbeitung der Aufgaben
- 3.4.3.3 Gegenleistungen an die Crowdsourcees
- 3.4.4 Collective Knowledge
- 3.4.4.1 Charakteristika der Aufgaben
- 3.4.4.2 Bearbeitung der Aufgaben
- 3.4.4.3 Gegenleistungen an die Crowdsourcees
- 3.4.5 Zusammenfassung
- 4 Arbeitsaufwand und zu bewältigende Hürden bei der Durchführung von Crowdsourcings
- 4.1 Entscheidung für Crowdsourcing
- 4.2 Festlegung der Rahmenbedingungen
- 4.2.1 Formulierung der auszulagernden Aufgabe
- 4.2.2 Wahl der Plattform
- 4.2.3 Anforderungen an die Crowd
- 4.2.4 Zeitrahmen
- 4.2.5 Vertragliche Regelungen zwischen Crowd, Plattformen und Crowdsourcer
- 4.2.5.1 Eigentum der Erzeugnisse der Crowd
- 4.2.5.2 Arbeitsrechtliches Verhältnis zwischen Crowdsourcer, Crowdsourcees und Plattformen
- 4.3 Management der Crowd
- 4.3.1 Akquisition und Betreuung
- 4.3.2 Wahl der Gegenleistungen
- 4.4 Nachsorge von Crowdsourcings
- 4.5 Zusammenfassung
- 5 Unternehmerischer Nutzen von Crowdsourcing
- 5.1 Überblick der Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen
- 5.2 Lösung der gestellten Aufgaben
- 5.3 Abfragen der Meinungen der Crowd
- 5.4 Steigerung und Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung
- 5.5 Finanzielle Gesichtspunkte
- 5.6 Crowdsourcing als reines Marketinginstrument
- 5.7 Zusammenfassung
- 6 Abwägung der Eignung von Crowdsourcing für Unternehmen
- 6.1 Vorbereitende, interdisziplinäre Abwägungen
- 6.2 Microwork
- 6.3 Crowdcreation
- 6.4 Crowdvoting
- 6.5 Collective Knowledge
- 6.6 Sonderform: Marketing-Crowdsourcing
- 6.7 Sonderform: Unternehmensinterne Crowdsourcings
- 6.8 Zusammenfassung
- 7 Crowdsourcing am Beispiel der Deutschen Telekom AG
- 7.1 Unternehmensüberblick
- 7.2 Beschreibung des durchgeführten Crowdsourcing
- 7.3 Analyse des Arbeitsaufwands des Crowdsourcing
- 7.4 Analyse des Nutzens des Crowdsourcing
- 7.5 Fazit
- 8 Zusammenfassung und Ausblick
- 8.1 Zusammenfassung
- 8.2 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Crowdsourcing im unternehmerischen Kontext. Ziel ist es, die verschiedenen Formen des Crowdsourcing zu systematisieren, den Arbeitsaufwand und die Herausforderungen bei der Umsetzung zu beleuchten und den unternehmerischen Nutzen aufzuzeigen. Die Arbeit analysiert zudem ein konkretes Beispiel aus der Praxis.
- Systematisierung von Crowdsourcing-Formen
- Herausforderungen bei der Durchführung von Crowdsourcing-Projekten
- Unternehmerischer Nutzen von Crowdsourcing
- Fallstudie: Crowdsourcing bei der Deutschen Telekom AG
- Abwägung der Eignung von Crowdsourcing für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema Crowdsourcing im Unternehmenskontext ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Es skizziert die Relevanz des Themas und die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen. Der Fokus liegt auf der Vorbereitung des Lesers auf die folgenden Kapitel, die eine detaillierte Analyse von Crowdsourcing-Methoden, -Herausforderungen und -Nutzen liefern.
2 Grundlagen des Crowdsourcing: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von Crowdsourcing. Es definiert zentrale Begriffe wie Crowdsourcing, Crowdsourcer, Crowdsourcee und Crowdsourcing-Plattformen und beschreibt die grundlegenden Prozesse und die Heterogenität der Crowdsourcing-Ansätze. Die Unterscheidung verschiedener Akteure und Plattformen bildet die Basis für die spätere Systematisierung.
3 Systematisierung von Crowdsourcings: Dieses Kapitel präsentiert eine systematische Klassifizierung verschiedener Crowdsourcing-Methoden. Es analysiert bestehende Klassifizierungssysteme aus der Literatur, identifiziert deren Stärken und Schwächen und entwickelt eine eigene, umfassendere Systematisierung, die Kategorien wie Microwork, Crowdcreation, Crowdvoting und Collective Knowledge umfasst. Die detaillierte Ausarbeitung jeder Kategorie mit Charakteristika der Aufgaben, Bearbeitung und Gegenleistungen für die Beteiligten bildet den Kern dieses Kapitels.
4 Arbeitsaufwand und zu bewältigende Hürden bei der Durchführung von Crowdsourcings: Dieses Kapitel widmet sich den praktischen Herausforderungen bei der Umsetzung von Crowdsourcing-Projekten. Es beleuchtet die Entscheidungsfindung für Crowdsourcing, die Festlegung relevanter Rahmenbedingungen (Aufgabenformulierung, Plattformwahl, Anforderungen an die Crowd, Zeitrahmen, rechtliche Aspekte), das Crowd-Management (Akquisition, Betreuung, Gegenleistungen) und die Nachsorge. Die Kapitel analysiert die potentiellen Schwierigkeiten und bietet Lösungsansätze.
5 Unternehmerischer Nutzen von Crowdsourcing: Dieses Kapitel erörtert den Mehrwert von Crowdsourcing für Unternehmen. Es zeigt verschiedene Einsatzmöglichkeiten auf, wie die Lösung von Aufgaben, die Abfrage von Meinungen, die Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung und die finanziellen Aspekte. Das Kapitel analysiert Crowdsourcing nicht nur als Problemlöser sondern auch als Marketinginstrument.
6 Abwägung der Eignung von Crowdsourcing für Unternehmen: Dieses Kapitel dient der umfassenden Bewertung, wann Crowdsourcing für Unternehmen geeignet ist. Es beinhaltet eine tiefgehende Analyse der verschiedenen Crowdsourcing-Formen im Kontext unternehmerischer Herausforderungen und bietet Orientierungshilfen für die Entscheidung, ob und welche Form des Crowdsourcing im Einzelfall sinnvoll ist. Spezielle Formen wie Marketing-Crowdsourcing und unternehmensinterne Ansätze werden ebenfalls diskutiert.
7 Crowdsourcing am Beispiel der Deutschen Telekom AG: Dieses Kapitel präsentiert eine Fallstudie, die die Anwendung von Crowdsourcing bei der Deutschen Telekom AG analysiert. Es umfasst einen Überblick über das Unternehmen, eine detaillierte Beschreibung des durchgeführten Crowdsourcing-Projekts, eine Analyse des Arbeitsaufwands und des erzielten Nutzens. Dieses Kapitel dient als praxisnahe Illustration der vorangegangenen theoretischen Ausführungen.
Schlüsselwörter
Crowdsourcing, Unternehmen, Systematisierung, Microwork, Crowdcreation, Crowdvoting, Collective Knowledge, Arbeitsaufwand, Herausforderungen, unternehmerischer Nutzen, Fallstudie, Deutsche Telekom AG, Marketing, Open Innovation, Community Building.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Crowdsourcing im Unternehmenskontext
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Crowdsourcing im unternehmerischen Kontext. Sie systematisiert verschiedene Formen des Crowdsourcing, beleuchtet den Arbeitsaufwand und die Herausforderungen bei der Umsetzung und zeigt den unternehmerischen Nutzen auf. Eine Fallstudie der Deutschen Telekom AG veranschaulicht die praktische Anwendung.
Welche Formen des Crowdsourcing werden systematisiert?
Die Arbeit systematisiert Crowdsourcing in die Kategorien Microwork, Crowdcreation, Crowdvoting und Collective Knowledge. Jede Kategorie wird detailliert beschrieben, inklusive der Charakteristika der Aufgaben, der Bearbeitung und der Gegenleistungen für die Beteiligten.
Welche Herausforderungen bei der Durchführung von Crowdsourcing-Projekten werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entscheidungsfindung für Crowdsourcing, die Festlegung der Rahmenbedingungen (Aufgabenformulierung, Plattformwahl, Anforderungen an die Crowd, Zeitrahmen, rechtliche Aspekte), das Crowd-Management (Akquisition, Betreuung, Gegenleistungen) und die Nachsorge. Potentielle Schwierigkeiten und Lösungsansätze werden analysiert.
Welchen unternehmerischen Nutzen bietet Crowdsourcing?
Die Arbeit erörtert den Mehrwert von Crowdsourcing für Unternehmen, inklusive der Lösung von Aufgaben, der Abfrage von Meinungen, der Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung und der finanziellen Aspekte. Crowdsourcing wird sowohl als Problemlöser als auch als Marketinginstrument betrachtet.
Wie wird die Eignung von Crowdsourcing für Unternehmen bewertet?
Die Arbeit bietet eine umfassende Bewertung der Eignung von Crowdsourcing für Unternehmen. Sie analysiert die verschiedenen Crowdsourcing-Formen im Kontext unternehmerischer Herausforderungen und gibt Orientierungshilfen für die Entscheidung, ob und welche Form des Crowdsourcing im Einzelfall sinnvoll ist. Spezielle Formen wie Marketing-Crowdsourcing und unternehmensinterne Ansätze werden ebenfalls diskutiert.
Welche Fallstudie wird präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine Fallstudie, die die Anwendung von Crowdsourcing bei der Deutschen Telekom AG analysiert. Sie umfasst einen Unternehmensüberblick, eine detaillierte Beschreibung des durchgeführten Crowdsourcing-Projekts, eine Analyse des Arbeitsaufwands und des erzielten Nutzens.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselbegriffe sind Crowdsourcing, Unternehmen, Systematisierung, Microwork, Crowdcreation, Crowdvoting, Collective Knowledge, Arbeitsaufwand, Herausforderungen, unternehmerischer Nutzen, Fallstudie, Deutsche Telekom AG, Marketing, Open Innovation und Community Building.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundlagen des Crowdsourcing, Systematisierung von Crowdsourcings, Arbeitsaufwand und Hürden, Unternehmerischer Nutzen, Eignung von Crowdsourcing, Fallstudie Deutsche Telekom AG und Zusammenfassung/Ausblick. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und liefert detaillierte Informationen zu den jeweiligen Aspekten des Crowdsourcings.
- Quote paper
- Sven Wawra (Author), 2017, Crowdsourcing in Unternehmen. Formen und Einsatzgebiete, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375968