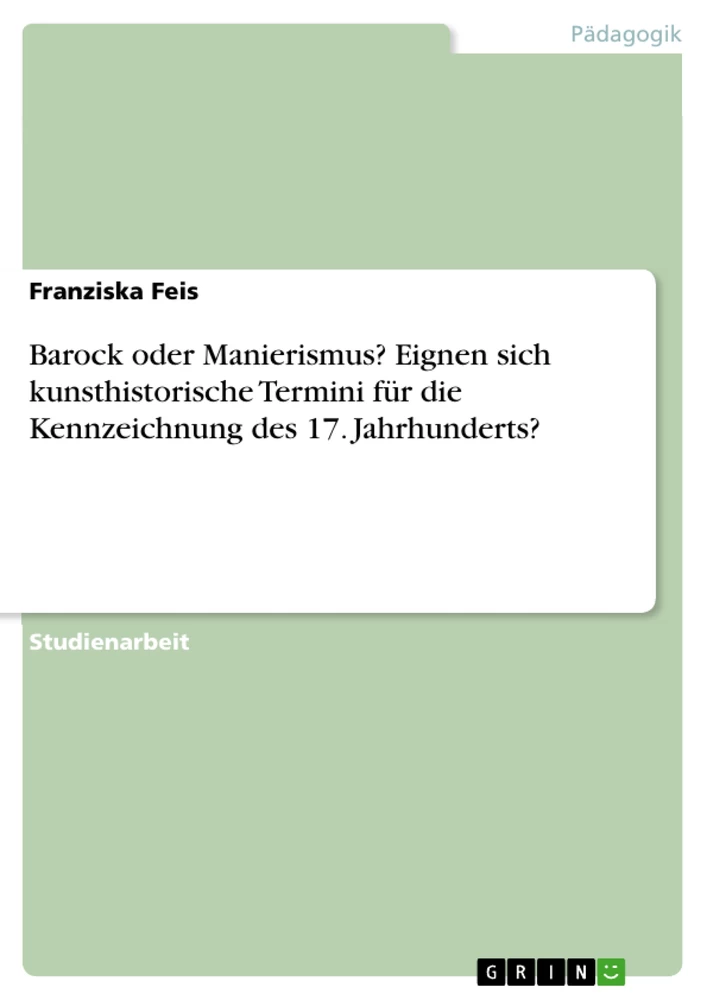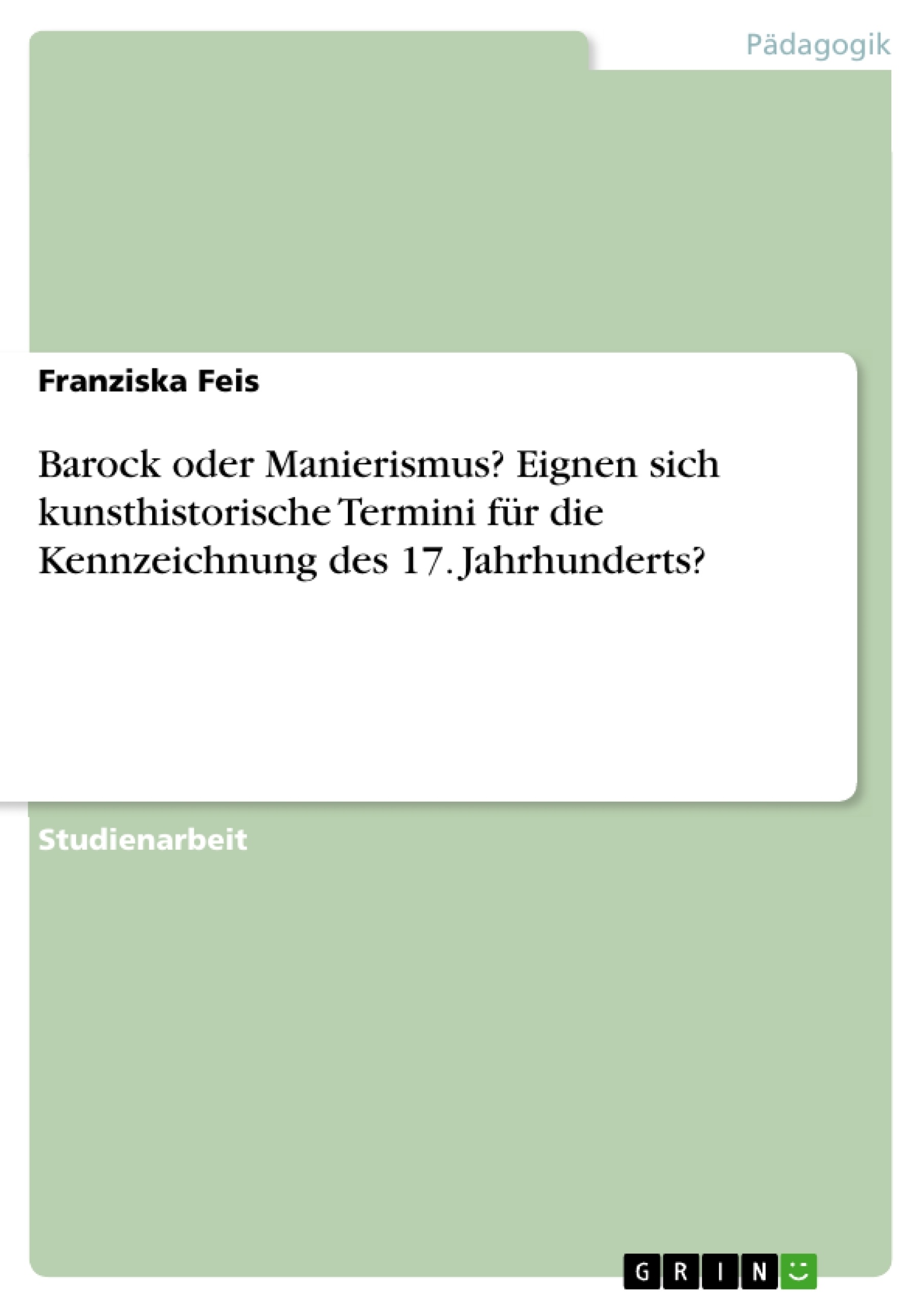Die vorliegende Hausarbeit versucht, das ‚Wesen‘ der umstrittenen Epoche „Barock“ zu ergründen und basiert auf dem Artikel „Barock oder Manierismus?“ von Horst Hartmann, der in dem Sammelband „Der literarische Barockbegriff“, herausgegeben von Wilfried Barner 1975, erschienen ist. Der Autor untersucht in seinem Aufsatz die Eignung kunsthistorischer Termini für die Kennzeichnung der Literatur des 17. Jahrhunderts, auch nachdem bereits Bedenken gegen die Begrifflichkeiten vorgebracht worden sind.
Zunächst sollen kurz die literaturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe des „Barock“-Zeitalters mit den Folgen des Dreißigjährigen Krieges und der verrufenen deutschsprachigen Literatur umrissen werden, bevor dargelegt wird, was unter dem Terminus verstanden wird. Daraufhin werden die Thesen Hartmanns bezüglich des „Barock“- und weiterhin auch bezüglich des „Manierismus“-Begriffs aus seiner oben genannten Abhandlung wiedergegeben und erläutert. Kontrastierend dazu wird anschließend Andreas Gryphius‘ Biographie und eines seiner bekanntesten Werke – „es ist alles eitel“ – vorgestellt und in einem weiteren Schritt auf den „Barock“-Begriff angewendet. Die Arbeit schließt letztlich mit einem Fazit ab, in dem die wichtigsten Punkte der Arbeit prägnant resümiert und anschließend mein eigener Standpunkt zur Verwendung des Terminus „Barock“ dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Literaturgeschichtliche und soziale Zusammenhänge
- 3. Barock oder Manierismus?
- 3.1. Der Begriff „Barock“
- 3.2. Thesen Horst Hartmanns
- 3.3. Der Begriff „Manierismus“
- 3.4. Manierismus statt Barock?
- 4. Andreas Gryphius
- 4.1. Biographie
- 4.2. „Es ist alles eitel“
- 4.3. Zuordnung zum „Barock“
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Eignung des kunsthistorischen Begriffs „Barock“ zur Beschreibung der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts. Sie basiert auf Horst Hartmanns Artikel, der die Debatte um die Verwendung kunsthistorischer Termini in der Literaturwissenschaft beleuchtet. Die Arbeit analysiert die literaturgeschichtlichen und sozialen Kontexte des 17. Jahrhunderts, untersucht Hartmanns Thesen zum „Barock“ und „Manierismus“, und veranschaulicht diese anhand von Andreas Gryphius' Werk.
- Die Eignung des Begriffs „Barock“ für die deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts
- Die literaturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe des 17. Jahrhunderts (Dreißigjähriger Krieg, Sprachgesellschaften)
- Die Thesen Horst Hartmanns zum „Barock“ und „Manierismus“
- Analyse von Andreas Gryphius' Werk im Kontext der Barockdebatte
- Die Entwicklung der deutschen Sprache im 17. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Eignung des Begriffs „Barock“ zur Beschreibung der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts. Sie verweist auf die bestehenden Debatten um die Übertragbarkeit kunsthistorischer Termini auf die Literaturwissenschaft und kündigt den methodischen Ansatz der Arbeit an, der auf Horst Hartmanns Artikel basiert. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die einzelnen Kapitel.
2. Literaturgeschichtliche und soziale Zusammenhänge: Dieses Kapitel beschreibt den historischen und sozialen Kontext der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts. Es beleuchtet die verheerenden Folgen des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) – demografischer Einbruch, Zerstörung der Infrastruktur, politische Fragmentierung. Das Kapitel zeigt auf, wie diese Ereignisse die Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur beeinflusst haben. Die Entstehung von Sprachgesellschaften wie der „Fruchtbringenden Gesellschaft“ wird als Versuch der Sprach- und Literaturreform im Kontext der kulturellen Rückständigkeit Deutschlands gegenüber anderen europäischen Ländern dargestellt. Die soziale Kluft zwischen gebildeter und ungebildeter Bevölkerung wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Barock, Manierismus, Deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts, Dreißigjähriger Krieg, Sprachgesellschaften, Andreas Gryphius, Horst Hartmann, Literaturgeschichte, Epochenbegriff, Literaturreform.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Barock oder Manierismus? Deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Anwendbarkeit des Begriffs „Barock“ auf die deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts. Sie hinterfragt, ob dieser kunsthistorische Begriff angemessen ist, um die literarischen Werke dieser Epoche zu beschreiben.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf den Artikel von Horst Hartmann, der die Debatte um die Verwendung kunsthistorischer Termini in der Literaturwissenschaft beleuchtet. Sie analysiert literaturgeschichtliche und soziale Kontexte des 17. Jahrhunderts und veranschaulicht ihre Argumentation anhand des Werks von Andreas Gryphius.
Welche Themen werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Die Eignung des Begriffs „Barock“, die literaturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe des 17. Jahrhunderts (inkl. Dreißigjähriger Krieg und Sprachgesellschaften), die Thesen Horst Hartmanns zu „Barock“ und „Manierismus“, eine Analyse von Andreas Gryphius' Werk im Kontext der Barockdebatte und die Entwicklung der deutschen Sprache im 17. Jahrhundert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Literaturgeschichtliche und soziale Zusammenhänge, Barock oder Manierismus? (mit Unterkapiteln zu den Begriffen „Barock“ und „Manierismus“ und deren Anwendung), Andreas Gryphius (mit Unterkapiteln zu Biographie, „Es ist alles eitel“ und der Zuordnung Gryphius' zum „Barock“) und Fazit.
Wer ist Andreas Gryphius und welche Rolle spielt er in der Arbeit?
Andreas Gryphius ist ein wichtiger deutscher Dichter des 17. Jahrhunderts. Seine Werke, insbesondere sein Gedicht „Es ist alles eitel“, dienen in dieser Hausarbeit als Beispiel, um die Anwendbarkeit des Begriffs „Barock“ auf die Literatur der Zeit zu untersuchen.
Welche Rolle spielt Horst Hartmann in der Hausarbeit?
Horst Hartmann ist ein wichtiger Bezugspunkt der Arbeit. Seine Thesen zur Verwendung des Begriffs „Barock“ in der Literaturwissenschaft bilden die Grundlage der Analyse und der Argumentation.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Barock, Manierismus, Deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts, Dreißigjähriger Krieg, Sprachgesellschaften, Andreas Gryphius, Horst Hartmann, Literaturgeschichte, Epochenbegriff, Literaturreform.
Welche zentralen Fragen werden in der Einleitung gestellt?
Die Einleitung formuliert die zentrale Forschungsfrage nach der Eignung des Begriffs „Barock“ für die deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts und skizziert den methodischen Ansatz sowie den Aufbau der gesamten Arbeit.
Was wird im Kapitel über die literaturgeschichtlichen und sozialen Zusammenhänge behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet den Kontext des Dreißigjährigen Krieges und seine Auswirkungen auf die deutsche Sprache und Literatur, sowie die Entstehung von Sprachgesellschaften als Reaktion auf die kulturelle Rückständigkeit Deutschlands im europäischen Vergleich.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht im gegebenen Text enthalten und müsste im vollständigen Dokument nachgesehen werden.)
- Quote paper
- Franziska Feis (Author), 2017, Barock oder Manierismus? Eignen sich kunsthistorische Termini für die Kennzeichnung des 17. Jahrhunderts?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375936