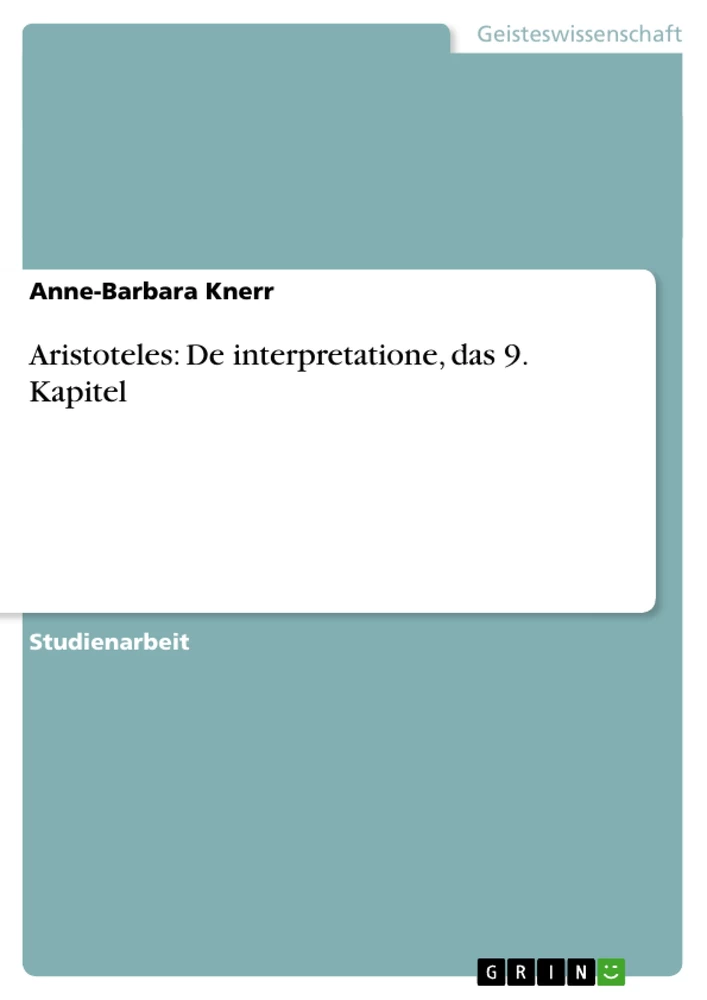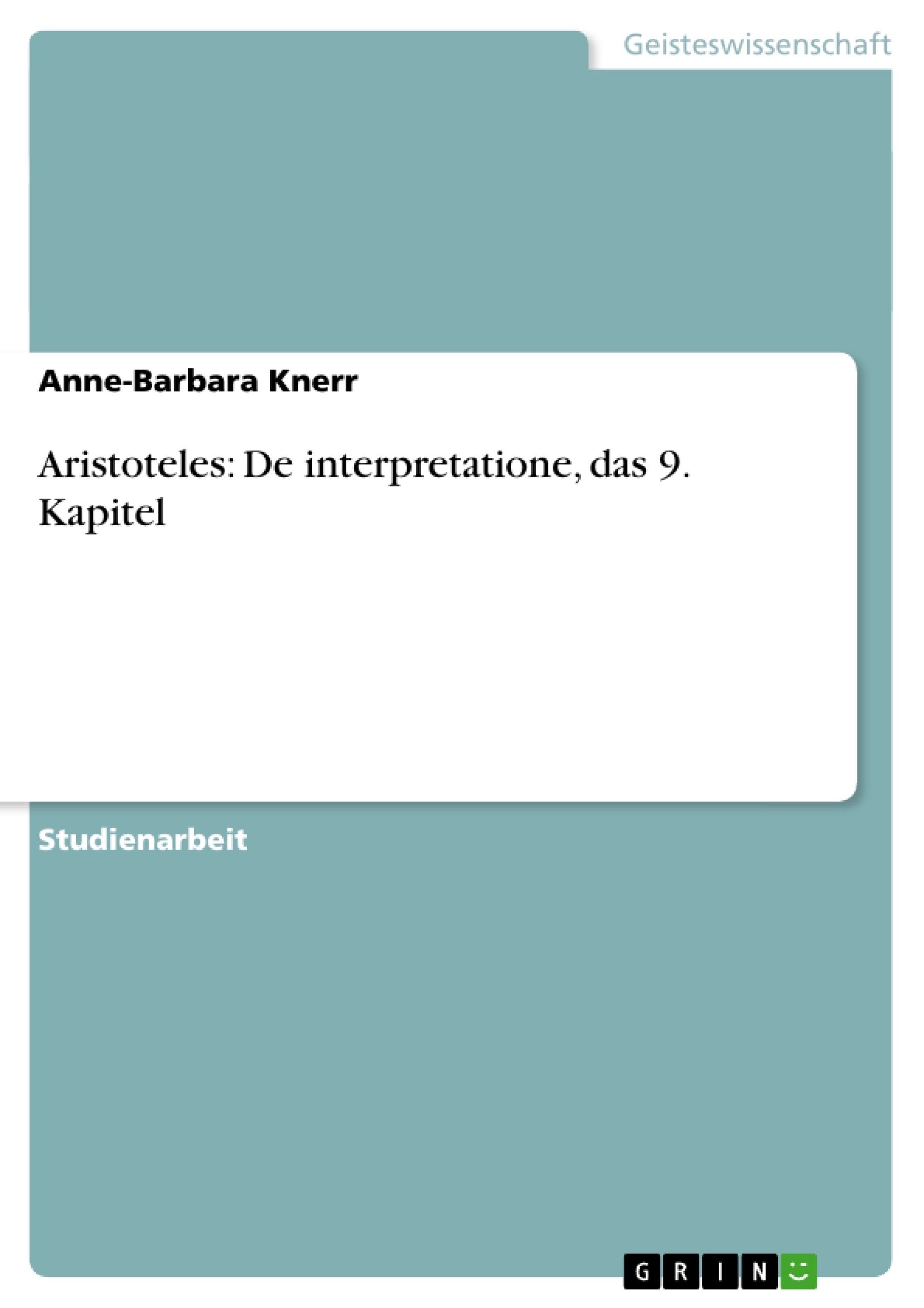Aristoteles und seine Schrift Peri hermeneias
Aristoteles (im Folgenden abgekürzt mit Ar.) wurde 384 v. Chr. in Stagira (Thrakien) geboren und lebte bis 322 v. Chr., wo er auf seinem Landsitz auf Euböa starb. Seine Kindheit verbrachte er vermutlich an der königlichen Residenz in Pella, da sein Vater Leibarzt von Amyntas III. von Makedonien, dem Großvater Alexanders des Großen, war.
367 v. Chr., im Alter von 17 Jahren, kam Ar. nach Athen an die Akademie Platons. Seine dortige Lehrzeit endete erst fast 20 Jahre später mit dem Tode Platons 347. Ar folgte daraufhin der Einladung eines Studienkollegen namens Hermias, Herrscher von Atarneus in Assos, nach Mysien (Kleinasien), wo er einige Jahre in einem kleinen platonischen Zirkel verbrachte. 342 wurde Ar. zurück an den makedonischen Hof berufen, wo er als Erzieher des jungen Alexander fungierte. Etwa 335 kehrte er (nach weiterem Aufenthalt in Stagira) nach Athen zurück und gründete dort eine eigene Schule. 323 verließ er die Stadt wieder, weil man ihn der Gottlosigkeit angeklagt hatte und starb kurze Zeit später auf seinem Landgut bei Chalkis auf Euböa. Ausgangspunkt seiner Lehre sind die Ideen Platons, von denen er sich im Laufe seines Lebens zunehmend distanzierte. I. Ggs. zu seinem Lehrer war Ar. die den Sinnen zugängliche Welt des Alltags Grundlage aller wissenschaftlicher Überlegungen. Dadurch wurde er zum Begründer der modernen Logik . Von seinen Werken sind ausgerechnet die, die er selbst zur Veröffentlichung bestimmt hatte, ausnahmslos verlorengegangen. Die uns erhaltenen, zum sog. Corpus aristotelicum zusammengefassten Schriften dienten wohl eher Unterrichts- und Forschungszwecken. Sie wurden in sieben verschiedene Themengebiete eingeteilt (Jugendschriften, Schriften zur Logik, zur Metaphysik, naturwissenschaftliche Schriften, Schriften zur Ethik, zur Kunst, zu Volkswirtschaft und Politik).
Die hier behandelte Schrift Peri hermenaias ist den Schriften zur Logik, dem sog. Organon (=Werkzeug, Instrument für wissenschaftliche Verfahren), zuzuordnen. Das Organon hat von allen Schriften des Ar. die breiteste Wirkung erlangt...
Inhaltsverzeichnis
- Aristoteles und seine Schrift Peri hermenaias
- Die Einleitung des 9. Kapitels (18 a 28-34)
- Wie könnte eine Wahrheitswertverteilung auf zukunftsbezogene, kontradiktorische Aussagen aussehen?
- Beide Teilaussagen sind wahr (18 a 39-18 b 4)
- Eine Teilaussage ist wahr, eine ist falsch (18 a 34-38, 18 b 4-16)
- Der Zukunftsbegriff des Aristoteles
- Der Zukunftsbegriff des Determinismus
- Die Konsequenzen o.g. Zukunftsvorstellungen für die Überlegungen des Aristoteles
- Beide Teilaussagen sind falsch (18 b 17-25)
- Widerlegung des Determinismus (18 b 25-19 a 6)
- Reductio ad absurdum (18 b 25-34)
- Untätigkeitsargument
- Überlegtes Handeln als menschliches Prinzip
- Unabhängigkeit des Determinismus von tatsächlich gemachten Aussagen (18 b 34-19 a 7)
- Ausdehnung der Determinismusannahme auf große Zeiträume (18 b 34-36, 19 a 2-7)
- Zwischenergebnis der bisher angestellten Überlegungen
- Beide Teilaussagen sind wahr
- Eine Teilaussage ist wahr, eine falsch
- Beide Teilaussagen sind falsch
- Schlussfolgerung
- Der Bereich des Kontingenten oder: Was geschieht nicht mit Notwendigkeit? (19 a 7-22)
- Dinge, die dem menschlichen Handlungsspielraum unterliegen
- Dinge, für die mehrere Möglichkeiten bestehen
- Dinge, die geschehen, wie es sich gerade trifft (19 a 19-20)
- Dinge, die in der Regel eintreffen / nicht eintreffen (19 a 21-22)
- Der Bereich des Notwendigen (19 a 23-27)
- Die temporale Notwendigkeit (19 a 23-25)
- Die schlechthin bestehende Notwendigkeit (19 a 26)
- Die qualifizierte Notwendigkeit
- Die Aristotelische Lösung (19 a 27-19 b 4)
- Was ist an einem zukunftsbezogenen, kontradiktorischen Aussagenpaar wahr? (19 a 7-32)
- Was ist an den beiden Gliedern einer zukunftsbezogenen Kontradiktion wahr? (19 a 33-39)
- Schlussbemerkung (19 b 1-4)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das 9. Kapitel von Aristoteles' Schrift Peri hermeneias widmet sich der Frage, wie sich die Wahrheitswertverteilung auf zukunftsbezogene, kontradiktorische Aussagen verhält. Aristoteles untersucht, ob die bisherige Gegensatzlehre, die besagt, dass von zwei einander entgegengesetzten Aussagen immer eine wahr und eine falsch sein muss, auch auf Aussagen über zukünftige Ereignisse anwendbar ist. Der Text analysiert verschiedene Interpretationen des Zukunftsbegriffs und widerlegt den Determinismus durch logische Argumente.
- Die Gültigkeit der Gegensatzlehre für Zukunftsaussagen
- Die Interpretationen des Zukunftsbegriffs bei Aristoteles und im Determinismus
- Die Widerlegung des Determinismus
- Der Bereich des Kontingenten und des Notwendigen
- Die Aristotelische Lösung für die Wahrheitswertverteilung von zukunftsbezogenen, kontradiktorischen Aussagen
Zusammenfassung der Kapitel
Das 9. Kapitel beginnt mit der Feststellung, dass die Gegensatzlehre, wie sie bisher dargelegt wurde, nicht auf zukunftsbezogene, kontradiktorische Aussagen anwendbar ist. Im Folgenden untersucht Aristoteles verschiedene Möglichkeiten der Wahrheitswertverteilung auf solche Aussagen. Er analysiert die Fälle, in denen beide Teilaussagen wahr, eine wahr und eine falsch oder beide falsch sind. In der Diskussion über die Wahrheit einer Teilaussage, die falsch ist, wird der Zukunftsbegriff des Aristoteles gegenüber dem des Determinismus abgegrenzt. Im nächsten Schritt widerlegt Aristoteles den Determinismus mit Hilfe eines Reductio ad absurdum-Arguments, das die Annahme des Determinismus zu einem Widerspruch führt. Der Autor argumentiert, dass die Gültigkeit des Determinismus nicht von tatsächlich gemachten Aussagen abhängt und dass seine Annahme zu einer unvereinbaren Ausdehnung auf große Zeiträume führt.
Nachdem Aristoteles den Determinismus widerlegt hat, erörtert er den Bereich des Kontingenten, d.h. das, was nicht mit Notwendigkeit geschieht. Hierbei unterscheidet er zwischen Dingen, die dem menschlichen Handlungsspielraum unterliegen, und Dingen, für die mehrere Möglichkeiten bestehen. Im Bereich des Notwendigen unterscheidet Aristoteles zwischen temporaler und schlechthin bestehender Notwendigkeit. Schließlich präsentiert Aristoteles seine Lösung für die Wahrheitswertverteilung von zukunftsbezogenen, kontradiktorischen Aussagen. Er argumentiert, dass die Wahrheit in solchen Aussagen nicht in den einzelnen Gliedern der Kontradiktion, sondern in der Beziehung zwischen ihnen liegt.
Schlüsselwörter
Kontradiktorische Aussagen, Zukunftsaussagen, Wahrheitswert, Determinismus, Reductio ad absurdum, Kontingenz, Notwendigkeit, temporale Notwendigkeit, schlechthin bestehende Notwendigkeit, Aristotelische Lösung
- Quote paper
- Anne-Barbara Knerr (Author), 2000, Aristoteles: De interpretatione, das 9. Kapitel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37562