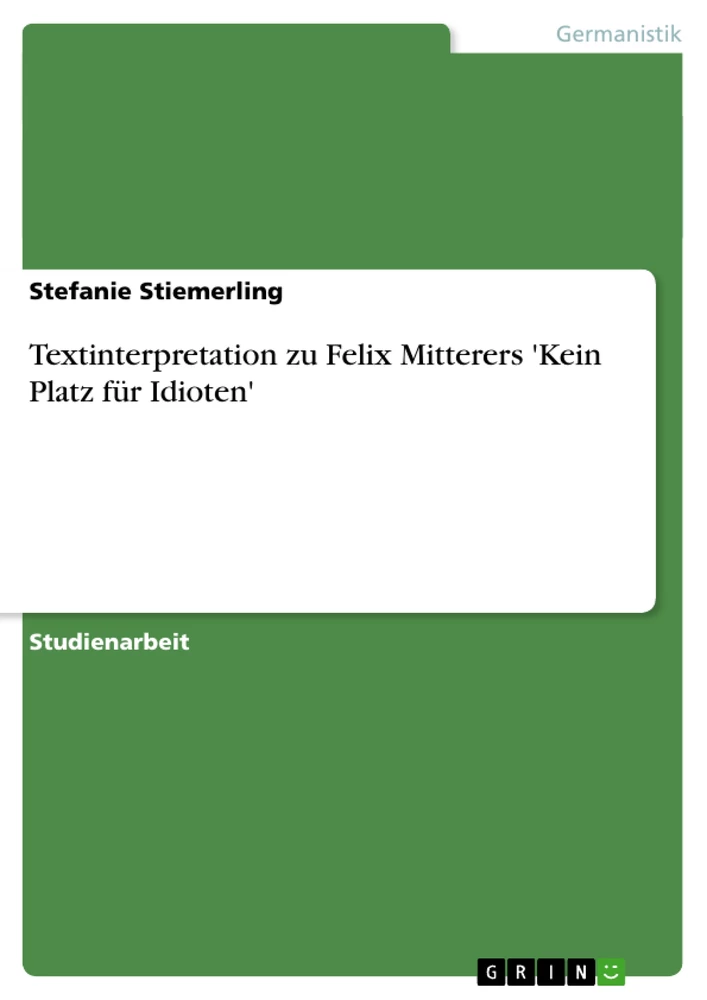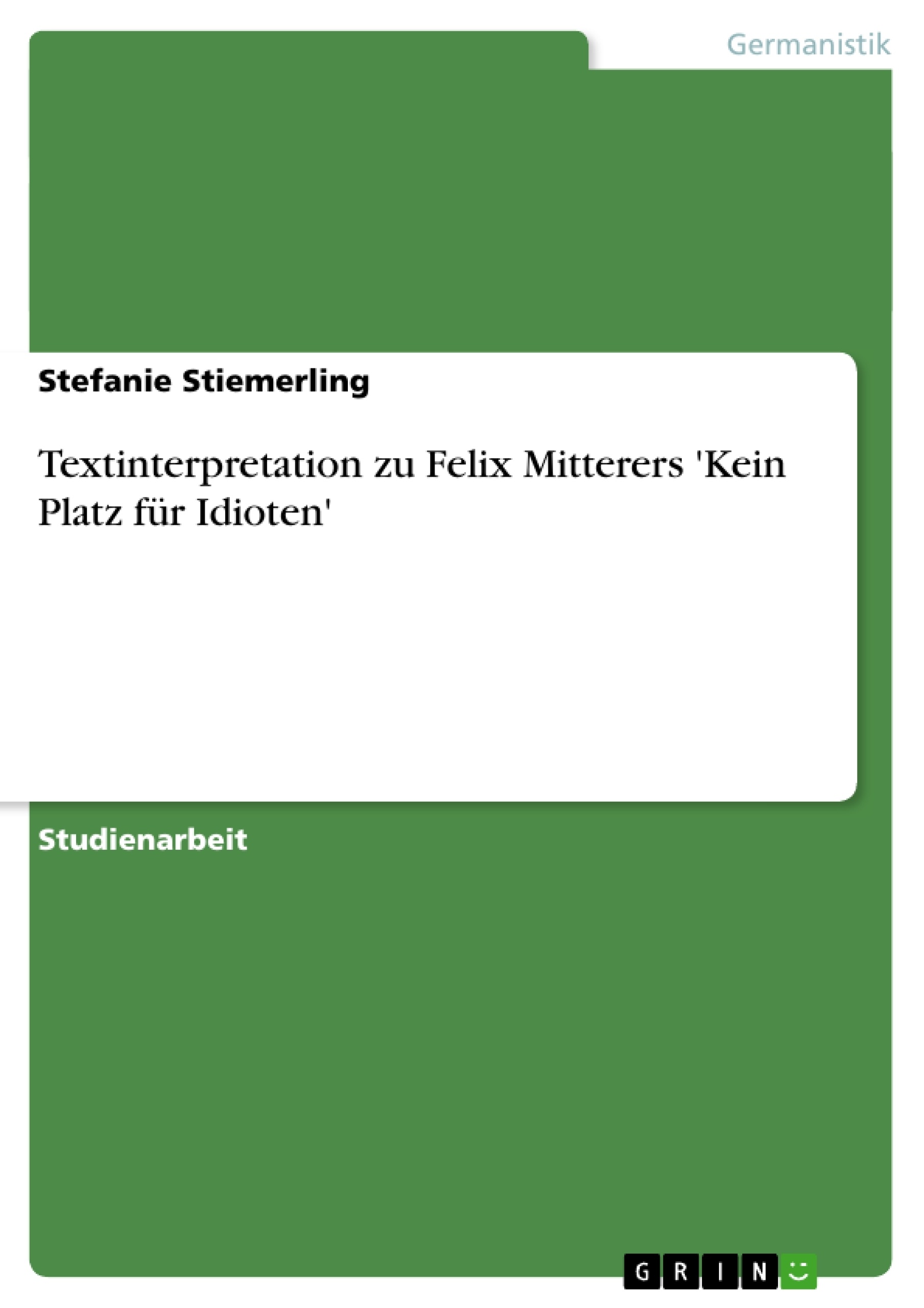EINLEITUNG
Felix Mitterer wurde am 6. Februar 1948 in Achenkrich/ Tirol geboren. Seine Mutter, eine verwitwete Landarbeiterin, überließ ihren Sohn einem Tagelöhnerehepaar, das ihn adoptierte. In Kitzbühl und Kirchberg besuchte er acht Jahre die Volks- und drei Jahre die Mittelschule, um später zehn Jahre beim Innsbrucker Zollamt zu arbeiten. Anfang der 70er Jahre begann er eigene Texte für Rundfunk, Literaturzeitschriften und Zeitungen zu schreiben. Mit seinem Erstlingswerk, dem Volksstück Kein Platz für Idioten, gelang ihm 1977 der Durchbruch. Wie Mitterers gesamten Werke, bezieht sich auch Kein Platz für Idioten auf ein konkretes Ereignis. 1 Anlass für dieses Stück bot Mitterer ein Vorfall, der sich 1974 in einem Tiroler Fremdenverkehrsort ereignete. Eine Mutter wurde aufgrund ihres behinderten Kindes aus einem Gasthaus gewiesen, da der Wirt durch deren Anwesenheit eine Geschäftsschädigung befürchtete.
Zunächst verarbeitete er dieses Ereignis als Hörspiel, das 1976 vom ORF ausgestrahlt wurde. Die Sprecher waren Schauspieler der Volksbühne Blaas in Innsbruck, die den Autor dann auch dazu veranlassten, den Stoff als Theaterstück umzuschreiben. Für Mitterer bot sich damit die Chance, eine Publikumsschicht anzusprechen und mit dem Stück zu konfrontieren, in deren Millieu der Schauplatz von Kein Platz für Idioten zu finden ist- nämlich in der Dorfbevölkerung. Diese war hauptsächlich Publikum in der Volksbühne Blaas und eigentlich auf Bauernschwänke und nicht auf kritische Volksstücke eingestellt.2 Das Stück wurde 1977 in Blaas uraufgeführt, und für Felix Mitterer erfüllte sich sein Wunsch, beim Publikum für seinen Protagonisten Sebastian Möllinger, der den behinderten Jungen darstellt, Verständnis zu erzeugen und Zuneigung zu erwecken.
Mit dem Stück Kein Platz für Idioten will Mitterer die Missstände und Konflikte des Systems der Dorfgemeinschaft beleuchten. Es geht ihm um die Darstellung von individuellem Fehlverhalten, was auf der Bühne aus der sozialen Entwicklung zwar erklärt, damit aber nicht entschuldigt wird.3 „Denn die Aufklärung über die Möglichkeit, Menschlichkeit zu beweisen, das Leben in jeder erdenklichen Konfliktsituation nach ethischen Maßstäben zu gestalten, ist ihm weithin das wichtigste Anliegen.“ 4 Er stellt dar, jedoch ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben. Mittelpunkt Mitterers Werke ist fast ausnahmslos die Figur des Außenseiters...
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- INTERPRETATION DES STÜCKS
- INHALTSANGABE
- PERSONENKONSTELLATIONEN UND HANDLUNGSVERLAUF
- FORM- UND SPRACHBETRACHTUNG
- SCHLUSSBETRACHTUNG
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Felix Mitterer, Autor des Volksstücks "Kein Platz für Idioten", befasst sich in seinem Werk mit der Problematik der Integration von Menschen mit Behinderungen in die Dorfgemeinschaft. Das Stück beleuchtet die Missstände und Konflikte, die entstehen, wenn die Normalität und der scheinbare Anspruch auf ein geordnetes und ungestörtes Dorfleben durch Andersartigkeit in Frage gestellt wird. Mitterer konfrontiert das Publikum mit der Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die von der gesellschaftlichen Norm abweichen.
- Die Darstellung von individuellem Fehlverhalten im Kontext der sozialen Entwicklung
- Die Auseinandersetzung mit der Frage nach Inklusion und Exklusion
- Die Rolle von Vorurteilen und Stigmatisierung in der Dorfgemeinschaft
- Die Suche nach Menschlichkeit und ethischem Verhalten in Konfliktsituationen
Zusammenfassung der Kapitel
EINLEITUNG
Die Einleitung des Textes gibt einen kurzen Einblick in das Leben und Werk von Felix Mitterer. Sie beleuchtet den biografischen Hintergrund des Autors und erklärt die Entstehung seines Volksstücks "Kein Platz für Idioten". Als Inspiration für das Stück diente ein Vorfall, der sich 1974 in einem Tiroler Fremdenverkehrsort ereignete, als eine Mutter aufgrund ihres behinderten Kindes aus einem Gasthaus gewiesen wurde.
INTERPRETATION DES STÜCKS
INHALTSANGABE
Das Stück "Kein Platz für Idioten" spielt in einem ländlichen Ort im 20. Jahrhundert. Sebastian Möllinger, ein geistig und körperlich behinderter Junge, wird von seiner Familie als Belastung empfunden. Platt-Hans, ein alter Hufschmied, findet Mitleid mit Sebastian und nimmt ihn bei sich auf. Die Dorfgemeinschaft zeigt jedoch wenig Verständnis für Sebastians Andersartigkeit. Ein Gastwirt, der gleichzeitig Bürgermeister des Ortes ist, verbietet Sebastian den Zutritt zu seinem Gasthaus, da er dessen Anwesenheit als Gefahr für den Tourismus sieht.
PERSONENKONSTELLATIONEN UND HANDLUNGSVERLAUF
Die Handlung des Stücks dreht sich um die Konfrontation des behinderten Sebastian mit der Dorfgemeinschaft. Die Personenkonstellation zeichnet sich durch den Gegensatz zwischen Sebastians Unschuld und der Härte und Intoleranz der Dorfbewohner aus. Platt-Hans steht in der Rolle des Fürsprechers für Sebastian, wird jedoch letztlich von den negativen Strömungen der Dorfgemeinschaft überrollt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselfragen des Textes umfassen die Darstellung von Inklusion und Exklusion, die Analyse von Vorurteilen und Stigmatisierung in der Dorfgemeinschaft, die Beleuchtung von individuellem Fehlverhalten und die Suche nach ethischem Verhalten in Konfliktsituationen. Der Text beleuchtet die Herausforderungen der Integration von Menschen mit Behinderungen in eine Gesellschaft, die häufig von Angst und Unverständnis geprägt ist.
- Citar trabajo
- Stefanie Stiemerling (Autor), 2004, Textinterpretation zu Felix Mitterers 'Kein Platz für Idioten', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37555