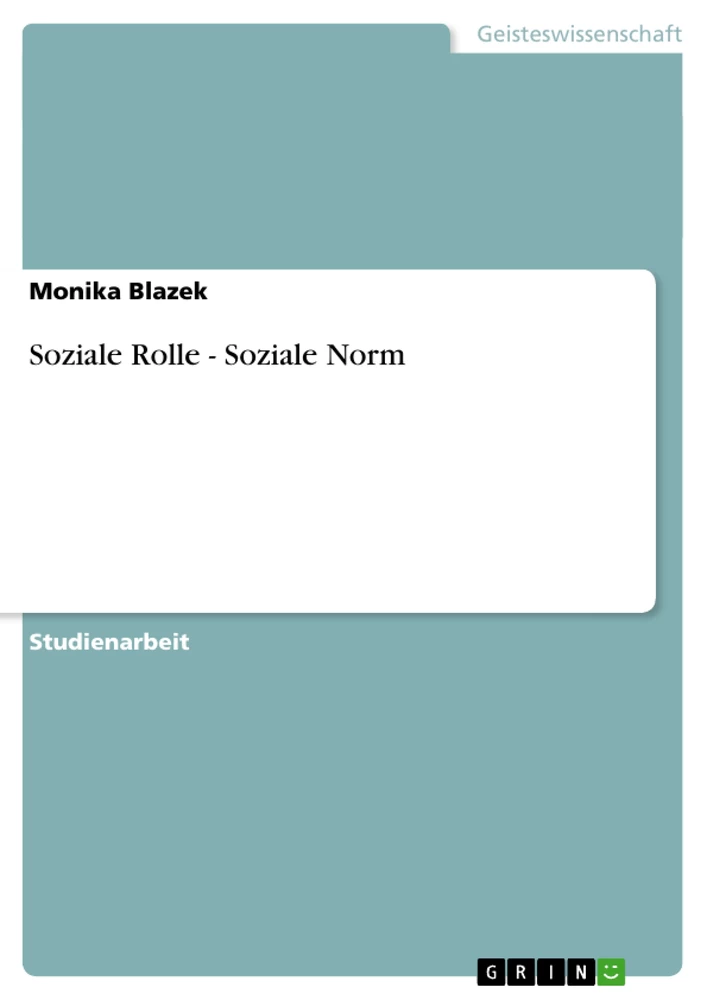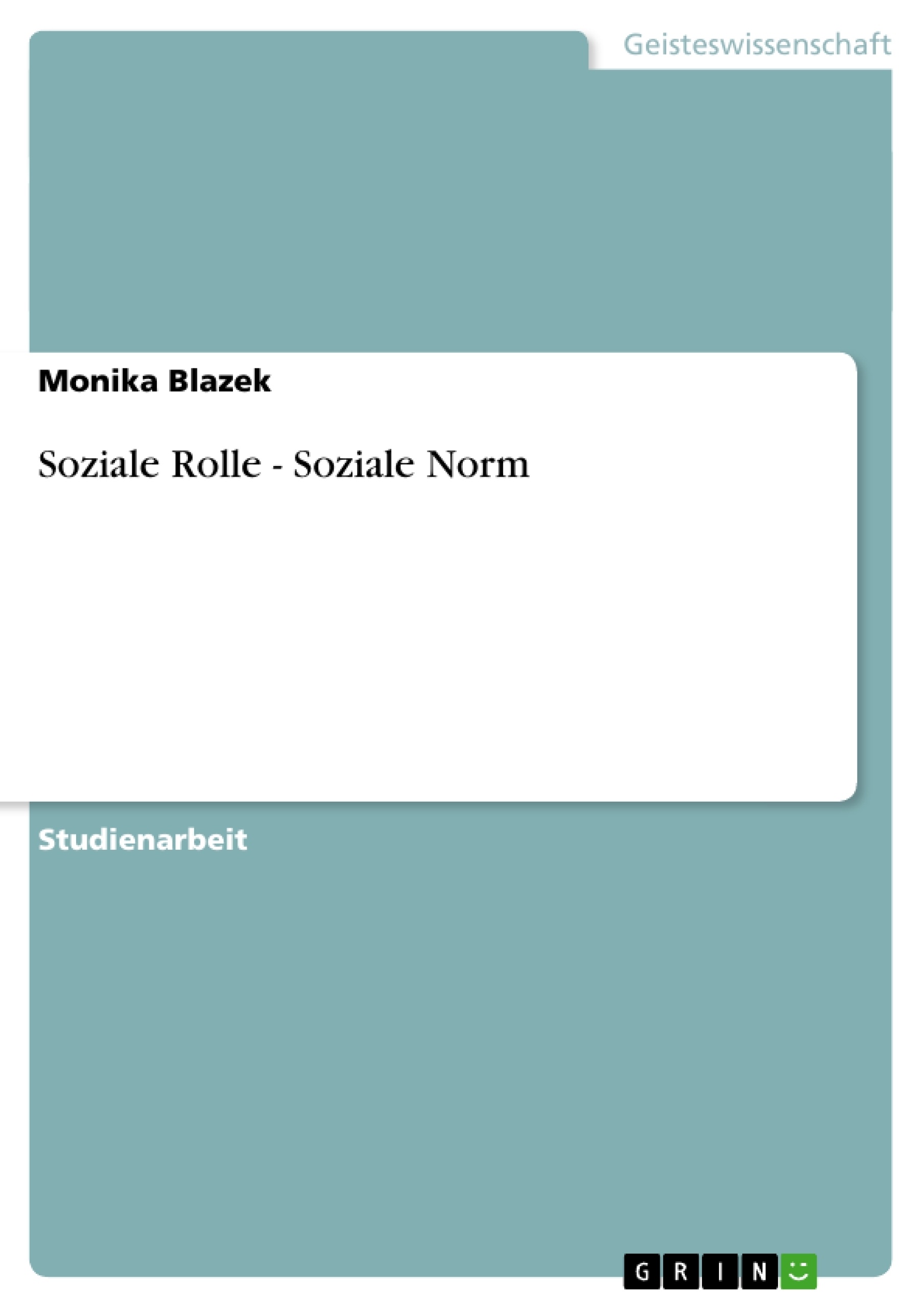Einführung
Das soziale Zusammenleben der Menschen untereinander wird von zwei Regulationsfaktoren „soziale Rolle“ und „soziale Norm“ geordnet. Voraussetzung für ein friedliches Zusammen- leben ist die Bestimmung dieser Normen und deren Einhaltung. Erklären kann man dies an dem Beispiel der Spielregeln: Gebe es sie nicht, könnte ein geregeltes Spiel nicht stattfinden, de jeder das Spiel nach seiner Auffassung spielen würde. Daraus kann man schließen, dass es nur zur Kooperation kommen kann, wenn sich eine Person den Erwartungen der Mitmenschen nach, also gemäß seiner Rolle, verhält. In dieser Abhandlung soll erklärt werden, wie soziale Interaktion, sei es durch Bestimmung von Normen und Rollen oder durch die Kontrolle des Verhaltens eines Menschen mittels der Normen, bzw. Rollen funktioniert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Begriffserklärung
- 2.1. Soziale Rolle
- 2.2. Soziale Norm
- 3. Darstellung und Kritik der wichtigsten rollentheoretischen Konzeptionen
- 3.1. Dahrendorf
- 3.1.1. Homo sociologicus
- 3.1.2. Kritik an Dahrendorf
- 3.2. Opp
- 3.2.1. Allgemeine Verhaltenstheorie
- 3.2.2. Verhältnis zur Rollentheorie
- 3.3. Parsons
- 3.3.1. Rollenbegriff bei Parsons
- 3.3.2. Parsons Problematik
- 3.4. Mead
- 3.4.1. Rolle und Symbol
- 3.4.2. Folgerungen
- 3.4.3. Grenzen des symbolischen Interaktionismus
- 3.1. Dahrendorf
- 4. Die Analyse von Rollen
- 4.1. Individualpsychologische Faktoren adäquaten Rollenverhaltens
- 4.2. Gestaltungsspielraum einer Rolle
- 4.3. Stellung der Rolle im Rollensystem
- 4.4. Ziel der Rollenanalyse
- 5. Die normativ bestimmten Verhaltensbereiche
- 5.1. Der Bereich der Tabus
- 5.2. Der Bereich der Konventionen
- 5.3. Der Bereich der Moden
- 6. Die nicht normativ bestimmten Verhaltensbereiche
- 6.1. Der Bereich der Selbstverständlichkeiten
- 6.2. Der Bereich der individuellen Freiheit
- 7. Struktur und Entstehung der Norm
- 7.1. Das Spektrum innerhalb jeder Norm
- 7.2. Die Entstehung von Normen
- 8. Übersicht über Normtypologien
- 8.1. Die Typologie von Sumner
- 8.2. Die Typologie von Morris
- 8.3. Die Typologie von Gibbs
- 9. Bestimmen von Normsender, Normempfänger und Sanktionssubjekt
- 9.1. Bestimmung von Normsender (Alter)
- 9.2. Bestimmung von Normempfänger (Ego)
- 9.3. Bestimmung von Sanktionssubjekt
- 10. Die Kontrolle normativen und rollengemäßen Verhaltens
- 10.1. Kontrolle durch negative Sanktionen
- 10.2. Kontrolle durch positiven Anreiz
- 10.3. Kontrolle durch Einsicht in sachliche Notwendigkeit
- 10.4. Kontrolle durch Einschränken von Handlungsalternativen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Grundlagen sozialer Ordnung, indem sie die Konzepte „soziale Rolle“ und „soziale Norm“ untersucht. Ziel ist es, die Mechanismen sozialer Interaktion zu erklären und zu analysieren, wie Normen und Rollen das Verhalten von Individuen steuern und wie diese Kontrolle funktioniert. Die Arbeit analysiert verschiedene rollentheoretische Ansätze und deren Kritik.
- Soziale Rollen und deren Bedeutung für soziales Handeln
- Definition und Typologisierung sozialer Normen
- Analyse verschiedener rollentheoretischer Konzeptionen (Dahrendorf, Opp, Parsons, Mead)
- Mechanismen der Normenkontrolle und -durchsetzung
- Der Einfluss von Sanktionen auf normkonformes Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einführung legt die Grundlage der Arbeit, indem sie die Bedeutung sozialer Rollen und Normen für das soziale Zusammenleben hervorhebt. Sie betont die Notwendigkeit von Regeln und Erwartungen für eine funktionierende Kooperation und kündigt die Analyse der Mechanismen sozialer Interaktion an, welche durch Normen und Rollen bestimmt werden.
2. Begriffserklärung: Dieses Kapitel definiert die Kernbegriffe „soziale Rolle“ und „soziale Norm“. „Soziale Rolle“ wird als dynamischer Aspekt der „sozialen Position“ beschrieben, mit Verhaltenserwartungen, die an Positionsträger herangetragen werden. „Soziale Norm“ wird als gemeinsame Erwartung innerhalb einer Gruppe definiert, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll, mit den Charakteristika der Externalität und des Zwangs, wie von Durkheim beschrieben.
3. Darstellung und Kritik der wichtigsten rollentheoretischen Konzeptionen: Dieses Kapitel präsentiert und kritisiert verschiedene rollentheoretische Ansätze. Dahrendorfs „Homo sociologicus“ wird als Konstrukt vorgestellt, das den Menschen als Rollenträger mit normativen Verhaltenserwartungen beschreibt. Die Kritik an Dahrendorf betont die Schwierigkeit, ein umfassendes soziologisches Menschenbild zu entwickeln. Opps „Allgemeine Verhaltenstheorie“ wird als Ansatz zur Prognose menschlichen Handelns vorgestellt, der jedoch Probleme bei der Integration der Rolle in sein Modell aufweist. Parsons' und Meads Ansätze werden ebenfalls erörtert.
4. Die Analyse von Rollen: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Aspekten der Rollenanalyse. Es untersucht individualpsychologische Faktoren, die adäquates Rollenverhalten beeinflussen, den Gestaltungsspielraum einer Rolle, ihre Stellung im Rollensystem und das Ziel der Rollenanalyse selbst.
5. Die normativ bestimmten Verhaltensbereiche: Hier werden Verhaltensbereiche klassifiziert, die durch Normen bestimmt sind: Tabus, Konventionen und Moden. Der Kapitel untersucht die unterschiedliche Stärke der gesellschaftlichen Sanktionen für das Verstoßen gegen diese Normen.
6. Die nicht normativ bestimmten Verhaltensbereiche: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf Verhaltensbereiche, die nicht primär durch Normen reguliert sind: Selbstverständlichkeiten und individuelle Freiheit. Es wird untersucht, wie diese Bereiche mit normativen Bereichen interagieren und welche Spielräume sie für individuelles Handeln eröffnen.
7. Struktur und Entstehung der Norm: Das Kapitel analysiert die Struktur und Entstehung sozialer Normen. Es betrachtet das Spektrum innerhalb jeder Norm und die Prozesse, durch die Normen entstehen und sich entwickeln. Die Dynamik und der Wandel von Normen in der Gesellschaft werden beleuchtet.
8. Übersicht über Normtypologien: Hier werden verschiedene Normtypologien von Sumner, Morris und Gibbs vorgestellt und verglichen. Die Kapitel beleuchtet die verschiedenen Ansätze zur Klassifizierung von Normen und deren jeweilige Stärken und Schwächen.
9. Bestimmen von Normsender, Normempfänger und Sanktionssubjekt: Dieser Abschnitt behandelt die Akteure im Kontext sozialer Normen: den Normsender (Alter), den Normempfänger (Ego) und das Sanktionssubjekt. Die Rollen und Interaktionen dieser Akteure bei der Durchsetzung von Normen werden analysiert.
10. Die Kontrolle normativen und rollengemäßen Verhaltens: Das Kapitel beschreibt verschiedene Mechanismen der Kontrolle normativen und rollengemäßen Verhaltens: negative Sanktionen, positive Anreize, Einsicht in sachliche Notwendigkeit und die Einschränkung von Handlungsalternativen. Die verschiedenen Kontrollmechanismen werden in ihren Wirkungsweisen und Zusammenhängen erläutert.
Schlüsselwörter
Soziale Rolle, Soziale Norm, Rollentheorie, Normenkontrolle, Sanktionen, Dahrendorf, Opp, Parsons, Mead, Homo sociologicus, Verhaltenstheorie, Inter-Rollenkonflikt, Intra-Rollenkonflikt, Normtypologien, Externalität, Kooperation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Soziale Rollen und Normen
Was ist der Hauptgegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Grundlagen sozialer Ordnung, indem sie die Konzepte „soziale Rolle“ und „soziale Norm“ analysiert. Sie beleuchtet die Mechanismen sozialer Interaktion, die Steuerung des individuellen Verhaltens durch Normen und Rollen und die Funktionsweise der damit verbundenen Kontrolle.
Welche rollentheoretischen Ansätze werden behandelt?
Die Arbeit analysiert verschiedene rollentheoretische Konzeptionen von Dahrendorf (inkl. Kritik am Homo sociologicus), Opp (Allgemeine Verhaltenstheorie und Verhältnis zur Rollentheorie), Parsons (Rollenbegriff und Problematik) und Mead (Rolle und Symbol, symbolischer Interaktionismus und dessen Grenzen).
Wie werden soziale Normen definiert und typologisiert?
Soziale Normen werden als gemeinsame Erwartungen innerhalb einer Gruppe definiert, die beschreiben, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten soll. Die Arbeit untersucht verschiedene Normtypologien von Sumner, Morris und Gibbs und klassifiziert Verhaltensbereiche als normativ bestimmt (Tabus, Konventionen, Moden) und nicht-normativ bestimmt (Selbstverständlichkeiten, individuelle Freiheit).
Welche Aspekte der Rollenanalyse werden betrachtet?
Die Rollenanalyse umfasst individualpsychologische Faktoren für adäquates Rollenverhalten, den Gestaltungsspielraum einer Rolle, ihre Stellung im Rollensystem und das Ziel der Rollenanalyse selbst.
Wie funktioniert die Kontrolle normativen und rollengemäßen Verhaltens?
Die Hausarbeit beschreibt verschiedene Mechanismen der Kontrolle: negative Sanktionen, positive Anreize, Einsicht in sachliche Notwendigkeit und die Einschränkung von Handlungsalternativen. Die Wirkungsweisen und Zusammenhänge dieser Kontrollmechanismen werden erläutert.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselbegriffe sind Soziale Rolle, Soziale Norm, Rollentheorie, Normenkontrolle, Sanktionen, Dahrendorf, Opp, Parsons, Mead, Homo sociologicus, Verhaltenstheorie, Inter-Rollenkonflikt, Intra-Rollenkonflikt, Normtypologien, Externalität und Kooperation.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Hausarbeit enthält eine Einführung, eine Begriffserklärung (soziale Rolle und soziale Norm), die Darstellung und Kritik wichtiger rollentheoretischer Konzeptionen, die Analyse von Rollen, die Betrachtung normativ und nicht-normativ bestimmter Verhaltensbereiche, die Struktur und Entstehung von Normen, eine Übersicht über Normtypologien, die Bestimmung von Normsender, Normempfänger und Sanktionssubjekt sowie die Kontrolle normativen und rollengemäßen Verhaltens.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Ziel der Hausarbeit ist es, die Mechanismen sozialer Interaktion zu erklären und zu analysieren, wie Normen und Rollen das Verhalten von Individuen steuern und wie diese Kontrolle funktioniert. Sie will ein Verständnis der Grundlagen sozialer Ordnung vermitteln.
- Quote paper
- Monika Blazek (Author), 2004, Soziale Rolle - Soziale Norm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37553