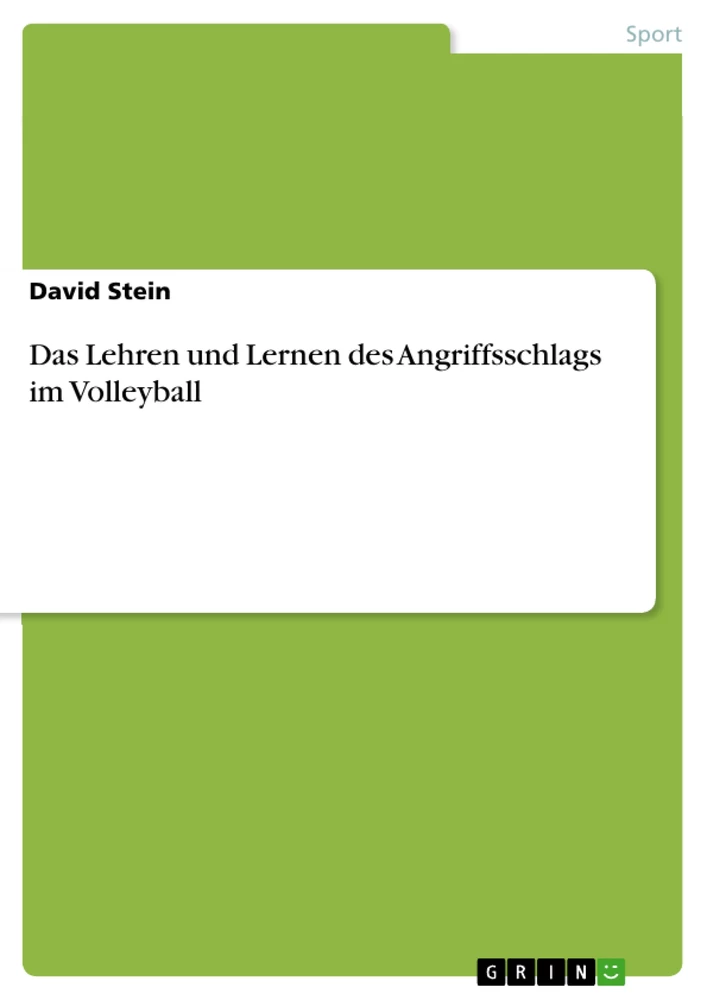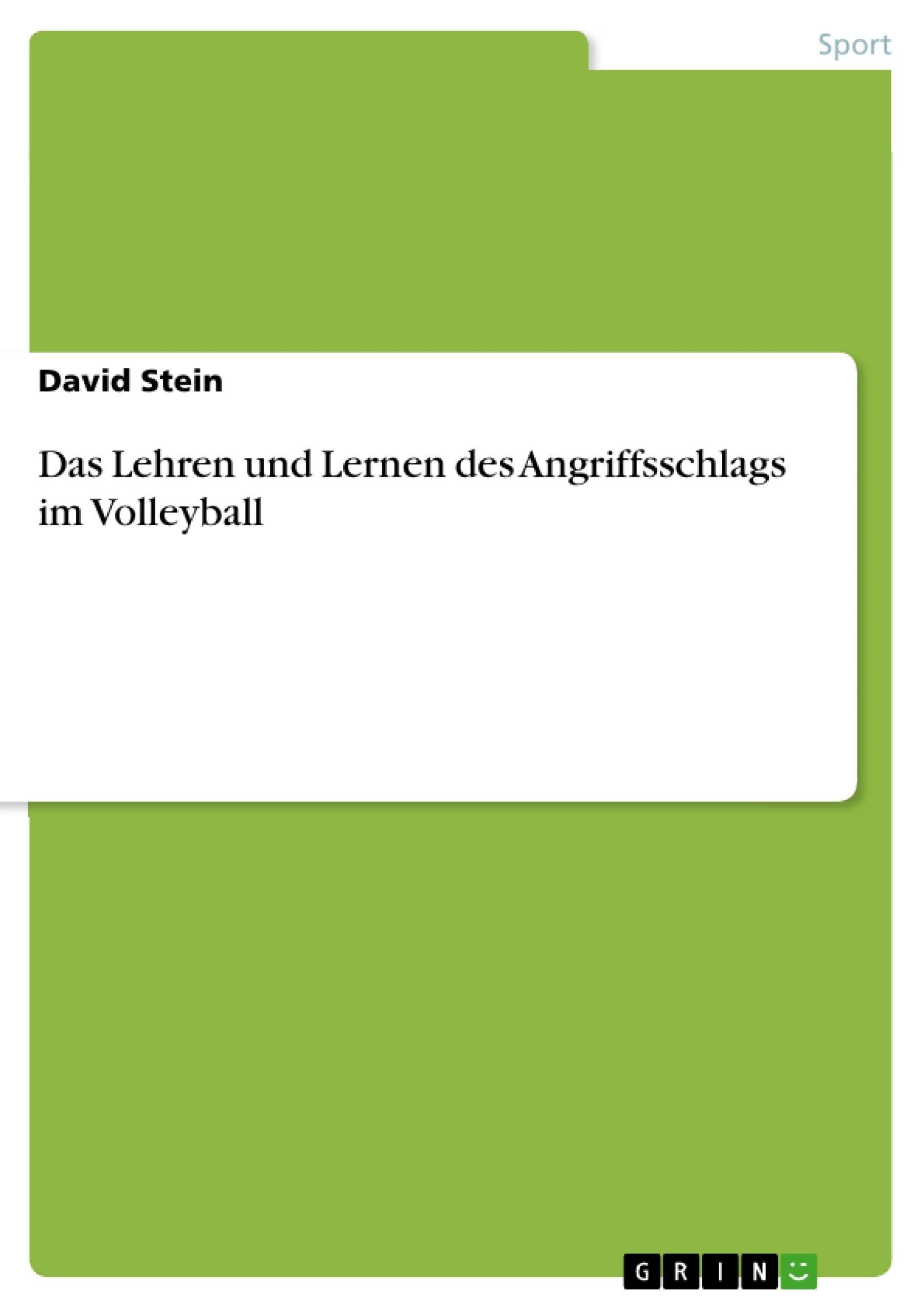In dieser Arbeit wird eine Grundbewegungsform des Volleyballspiels, der Angriffsschlag, anhand seiner Problemstruktur analysiert und ein geeigneter Lehrweg vorgestellt. Direkt unter den Lehrbeispielen erfolgt eine knappe Begründung, welche im Anschluss anhand verschiedener Veröffentlichungen diverser Pädagogen vertieft wird.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, eine sportliche Bewegung zu lehren. Ging es viele Jahrzehnte lang im Sportunterricht meist um klare Bewegungsanweisungen im Sinne der Nachahmung einer Bewegung, welche meist unreflektiert aus dem außerschulischen Kontext gezogen wurde, so änderte sich diese Denkweise in den letzten Jahren grundlegend: Anweisungen bedeuten ein Erlernen einer Technik unabhängig von den individuellen Gegebenheiten des Sportlers bzw. der Sportlerin, was oft dazu führt, dass die Bewegung völlig unfunktional ist und teilweise sogar negative Auswirkungen auf die Leistung hat (vgl. Tiefstart bei Sprint). Diese Sichtweise wurde zugunsten der Bewegungsaufgaben abgelegt. Diese geben vielmehr eine Vorstellung von dem, was gemacht werden soll, überlassen aber die Art der Ausführung jedem Einzelnen (vgl. Laging, 2016b, o.S.). Es geht also um eine selbstständige Auseinandersetzung mit Bewegungsproblemen, was das Lernen auf einer viel tieferen Ebene ermöglicht als schlichte Bewegungsanweisungen.
In diesem Rahmen begann man sich auch die Frage zu stellen, ob entscheidend ist, was die Lehrkraft lehrt oder ob es nicht viel wichtiger ist, zu was der Schüler bzw. die Schülerin schlussendlich in der Lage ist. Es gab somit einen Paradigmenwechsel von der Input- zur Outputsteuerung. Nicht der Sport und die Bewegung steht im Mittelpunkt des Sportunterrichts, sondern der Schüler oder die Schülerin. Daraus entwickelten sich unter anderen die neuen Unterrichtskonzepte Problemorientiertes Lernen, Erfahrungsorientiertes Lernen sowie das genetische Lernen (vgl. Laging, 2016a, o.S.). Diese und weitere finden immer mehr Einzug in den schulischen Sportunterricht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lehrgegenstand und Problemstruktur inklusive funktionaler Bewegungsbeschreibung
- Lehrweg bzw. Sammlung möglicher Aufgaben und Übungen
- Grundübungen für den Angriffsschlag
- Spielformen
- Erweiterung und Variationen
- Didaktische Begründung
- Über die Behinderung von Lernen durch Lehren (Fritsch&Maraun)
- Überlegungen zum Transfer (Scherer und Bietz)
- Effekte und Handlungskontrolle (Scherer und Bietz)
- Variabilität (Scherer und Bietz)
- Ideomotorik-Modelle der Bewegungskontrolle (Müller)
- Modelle der Bewegungskontrolle in der Didaktik (Künzell)
- Problemorientiertes Lernen
- Genetisches Lernen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Angriffsschlag im Volleyball und präsentiert einen geeigneten Lehrweg. Die Zielsetzung ist es, die Problemstruktur des Angriffsschlags zu verstehen und didaktisch fundierte Übungen und Spielformen zu entwickeln, die ein effektives Lehren und Lernen ermöglichen.
- Analyse der Problemstruktur des Volleyball-Angriffsschlags
- Entwicklung eines geeigneten Lehrwegs mit Übungen und Spielformen
- Didaktische Fundierung des Lehrwegs anhand verschiedener pädagogischer Modelle
- Betrachtung der Effekte von Handlungskontrolle und Variabilität
- Integration von problemorientiertem und genetischem Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel im Sportunterricht vom rein instruktiven Ansatz hin zu bewegungsaufgabenorientierten Konzepten. Es wird der Paradigmenwechsel von der Input- zur Outputsteuerung betont, der den Schüler in den Mittelpunkt rückt. Die Arbeit fokussiert auf den Angriffsschlag im Volleyball, dessen Problemstruktur analysiert und ein geeigneter Lehrweg vorgestellt wird. Die didaktische Begründung wird anhand verschiedener pädagogischer Ansätze vertieft.
Lehrgegenstand und Problemstruktur inklusive funktionaler Bewegungsbeschreibung: Dieses Kapitel beschreibt den Angriffsschlag im Volleyball, seine Funktion im Spielkontext und seine funktionalen Voraussetzungen. Es wird erläutert, dass der Angriffsschlag einen schnellen, präzisen und hochsteil fliegenden Ball gewährleisten muss, um die Reaktionszeit des Gegners zu minimieren und einen Punkt zu erzielen. Die funktionale Bewegungsbeschreibung umfasst Anlauf, Stemmschritt, Absprung, Ausholen, Schlag und Landung, wobei individuelle Variationen in Abhängigkeit von Krafteinsatz und Spielsituation berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter
Volleyball, Angriffsschlag, Bewegungslernen, Didaktik, Problemorientiertes Lernen, Genetisches Lernen, Handlungskontrolle, Variabilität, Bewegungsaufgaben, Lehrweg, Bewegungsanalyse.
Volleyball-Angriffsschlag: Lehrweg und Didaktische Fundierung - FAQ
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Volleyball-Angriffsschlag und entwickelt einen didaktisch fundierten Lehrweg. Sie umfasst eine Einleitung, die Beschreibung des Lehrgegenstands und der Problemstruktur, einen detaillierten Lehrweg mit Übungen und Spielformen, eine didaktische Begründung unter Einbezug verschiedener pädagogischer Modelle (z.B. von Fritsch & Maraun, Scherer & Bietz, Müller, Künzell), sowie ein Fazit. Die Arbeit konzentriert sich auf den Paradigmenwechsel im Sportunterricht hin zu bewegungsaufgabenorientierten Konzepten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse der Problemstruktur des Volleyball-Angriffsschlags, die Entwicklung eines geeigneten Lehrwegs mit Übungen und Spielformen, die didaktische Fundierung des Lehrwegs anhand verschiedener pädagogischer Modelle, die Betrachtung der Effekte von Handlungskontrolle und Variabilität sowie die Integration von problemorientiertem und genetischem Lernen.
Wie ist der Lehrweg aufgebaut?
Der Lehrweg gliedert sich in Grundübungen für den Angriffsschlag, Spielformen und Erweiterungen/Variationen. Die einzelnen Übungen und Spielformen sind darauf ausgerichtet, die Problemstruktur des Angriffsschlags schrittweise zu bewältigen und die Handlungskompetenz der Lernenden zu verbessern. Der Fokus liegt auf der Outputsteuerung und der Förderung des selbstgesteuerten Lernens.
Welche didaktischen Modelle werden verwendet?
Die didaktische Fundierung der Arbeit basiert auf verschiedenen Modellen, darunter die Überlegungen zur Behinderung von Lernen durch Lehren (Fritsch & Maraun), Überlegungen zum Transfer und zu Effekten und Handlungskontrolle (Scherer & Bietz), Variabilität (Scherer & Bietz), Ideomotorik-Modelle der Bewegungskontrolle (Müller), Modelle der Bewegungskontrolle in der Didaktik (Künzell), problemorientiertes Lernen und genetisches Lernen.
Welche Aspekte der Bewegungskontrolle werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Aspekte der Handlungskontrolle und Variabilität im Bezug auf den Erwerb des Volleyball-Angriffsschlags. Es wird untersucht, wie diese Faktoren das Lernen und den Transfer der erlernten Fertigkeiten beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Volleyball, Angriffsschlag, Bewegungslernen, Didaktik, Problemorientiertes Lernen, Genetisches Lernen, Handlungskontrolle, Variabilität, Bewegungsaufgaben, Lehrweg, Bewegungsanalyse.
Wie wird die Problemstruktur des Angriffsschlags beschrieben?
Die Problemstruktur des Angriffsschlags wird umfassend beschrieben, indem die funktionale Bewegungsbeschreibung (Anlauf, Stemmschritt, Absprung, Ausholen, Schlag, Landung) erläutert und die Notwendigkeit eines schnellen, präzisen und hochsteil fliegenden Balls hervorgehoben wird. Individuelle Variationen in Abhängigkeit von Krafteinsatz und Spielsituation werden berücksichtigt.
Welche Ziele werden mit dieser Arbeit verfolgt?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Problemstruktur des Angriffsschlags zu verstehen und didaktisch fundierte Übungen und Spielformen zu entwickeln, die ein effektives Lehren und Lernen ermöglichen. Es geht darum, einen Lehrweg zu präsentieren, der auf aktuellen didaktischen Modellen basiert und den Lernenden in den Mittelpunkt stellt.
- Quote paper
- David Stein (Author), 2017, Das Lehren und Lernen des Angriffsschlags im Volleyball, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375518