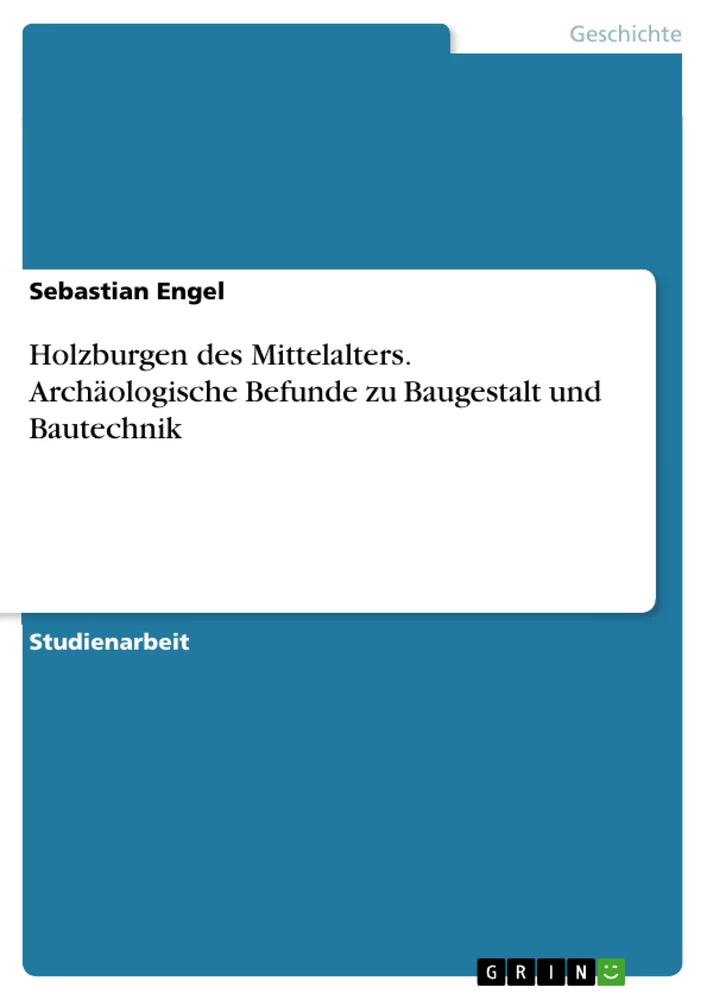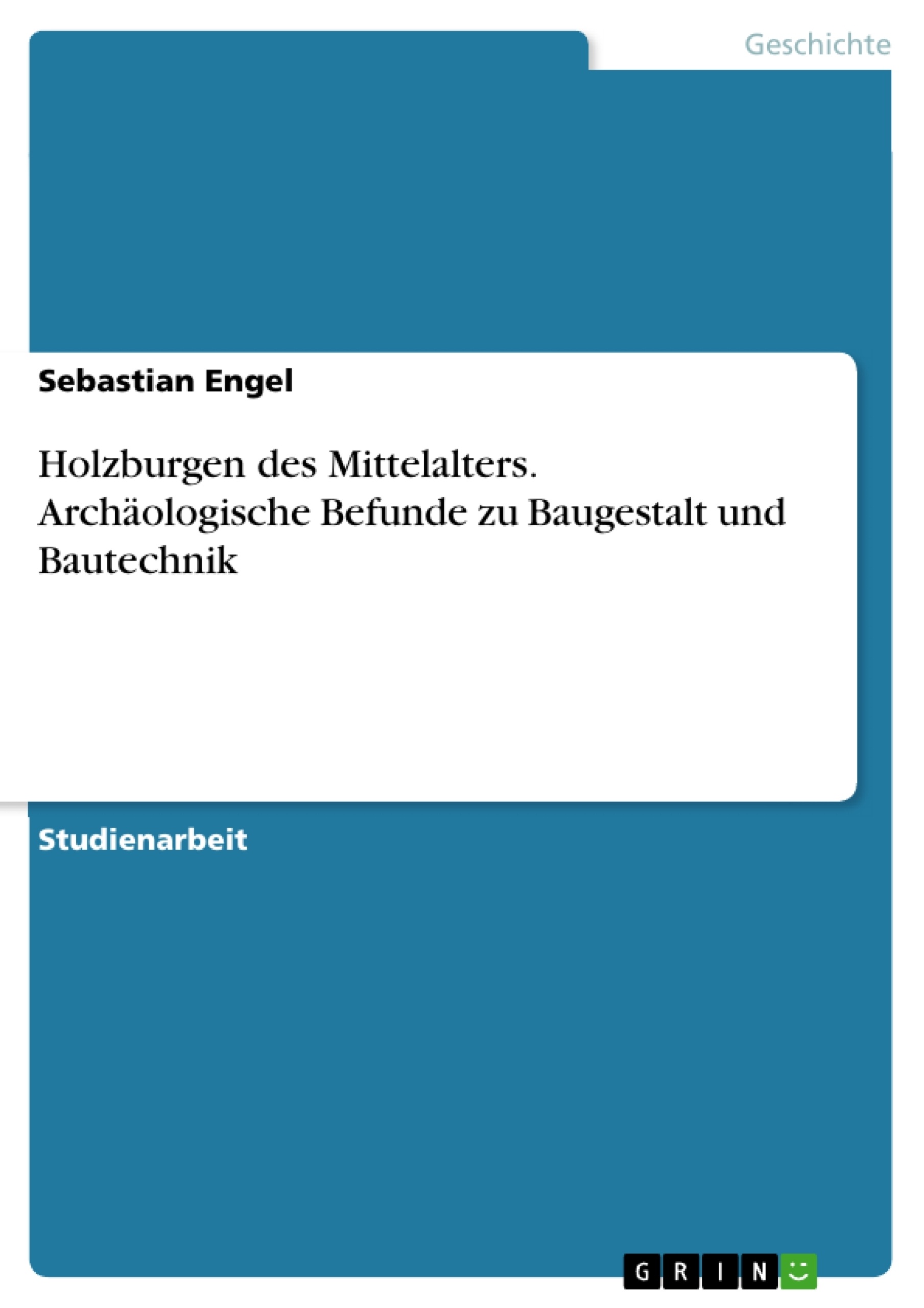In dieser Arbeit wird anhand archäologischen Befunden die Baustruktur und den dazu nötigen Bautechniken der mittelalterlichen Holzburgen nachgegangen. Je nach Burgtyp wurden individuelle Fundorte herausgesucht, um damit einen möglichst breiten Überblick über die verschiedenen Typen veranschaulichen zu können. Um einen möglichst konkreten Überblick zu ermöglichen, wurde die Untersuchung regional auf die heutige Bundesrepublik Deutschland eingegrenzt.
Holzburgen waren ein fortifikatorisches Phänomen, welche laut neuesten Erkenntnissen ab dem 11. Jahrhundert erbaut und genutzt wurden. Im Laufe des Mittelalters entwickelten sich dabei verschiedene Formen der Baugestaltung, die den lokalen geologischen Gegebenheiten angepasst waren. Diese reichen von den typischen Motte- und Turmburgkonstruktionen im flachen oder leicht hügeligen Gelände bis hin zur Wasserburg in seichten Gegenden.
Mit der unterschiedlichen Baugestalt einher ging die ebenso verschiedenartige Nutzung im weiteren Kontext von Holzburgen. Einerseits dienten sie als Wohnstätte des Adels, sprich als Herrenhof samt wehrhaften Turm, wie im Fall der im folgenden besprochenen Burg Husterknupp sehr gut belegt wurde. So ist mittlerweile bekannt, dass das erwähnten Anwesen der mittelalterliche Stammsitz eines Grafengeschlechts von Hochstaden war.
Andererseits können Holzburgen auch zum Schutz eines rein auf Produktion ausgerichteten Wirtschaftskomplexes gedient haben, wie Archäologen im französischen Colletiѐre an den Ufern des Lac de Paladru feststellen konnten. Colletiѐre ist damit ein gutes aber in dieser Arbeit nicht näher besprochenes Beispiel für den hauptsächlich wirtschaftlichen Nutzen einer Siedlung in Verbindung mit einer hölzernen Wehrburg.
Um das eingangs skizzierte Forschungsziel eines Kurzüberblicks zu den vorhandenen Holzburgentypen zu erreichen, werden zuerst im Rahmen eines forschungsgeschichtlichen Überblicks die diesbezüglichen Entwicklungen aufgearbeitet. Darauf folgt ein Vergleich der unterschiedlichen Burgtypen einerseits sowie der wechselhaften baulichen Ausformung dieser Typen anhand mehrerer Fundbeispiele andererseits.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Bedeutende Forscher
- Geographische und historische Einordnung
- Zeitgenössische Darstellungen
- Hölzerne Burgtypen im Vergleich
- Turmhügelburg Elmendorf
- Motte Husterknupp
- Motte Hoverberg
- Wasserburg Haus Horst
- Wohnturm Eschelbronn
- Conclusio
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Abbildungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht anhand archäologischer Befunde die Baustruktur und Bautechniken mittelalterlicher Holzburgen in Deutschland. Sie beleuchtet verschiedene Burgtypen und zeigt, wie sich diese an lokale Gegebenheiten angepasst haben. Die Untersuchung betrachtet die unterschiedliche Nutzung von Holzburgen, sowohl als Wohnstätten des Adels als auch als Schutz für Produktionsstätten. Die Arbeit zielt darauf ab, einen Überblick über die verschiedenen Typen von Holzburgen zu geben und die Entwicklungen ihrer Baustruktur im Laufe des Mittelalters aufzuzeigen.
- Baugestalt und Bautechnik mittelalterlicher Holzburgen
- Anpassung der Bauweise an lokale Gegebenheiten
- Die Nutzung von Holzburgen als Wohnstätten und Schutz für Produktionsstätten
- Die Entwicklung der Baustruktur von Holzburgen im Laufe des Mittelalters
- Die Bedeutung der dendrochronologischen Datierungsmethode für die Holzburgenforschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Forschungsziel vor, einen Überblick über die verschiedenen Typen von Holzburgen in Deutschland zu bieten. Sie hebt die Bedeutung der dendrochronologischen Datierungsmethode hervor und erläutert den Fokus auf die Entwicklung der Baustruktur im Laufe des Mittelalters.
- Forschungsstand: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der Holzburgenforschung aufgrund der Vergänglichkeit von Holz als Baumaterial. Es diskutiert die Bedeutung der dendrochronologischen Datierungsmethode und die Erweiterung des Forschungsstandes durch Ausgrabungen wie die der Motte Husterknupp.
- Bedeutende Forscher: Dieses Kapitel stellt die Forscher vor, die maßgeblich an den Ausgrabungen der in dieser Arbeit erläuterten Beispielburgen beteiligt waren, wie Adolf Herrnbrodt und Karl Dieter Zoller.
- Geographische und historische Einordnung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Verbreitung von Holzburgen in Mittel- und Westeuropa und diskutiert die zeitliche Einordnung durch den deutschen Archäologen Horst Wolfgang Böhme.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf Holzburgen, mittelalterliche Architektur, Baugestalt, Bautechnik, dendrochronologische Datierungsmethode, Motten, Turmburgen, Wasserburgen, Wohnstätten, Produktionsstätten, archäologische Befunde und Forschungstand.
- Quote paper
- Sebastian Engel (Author), 2017, Holzburgen des Mittelalters. Archäologische Befunde zu Baugestalt und Bautechnik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/375502