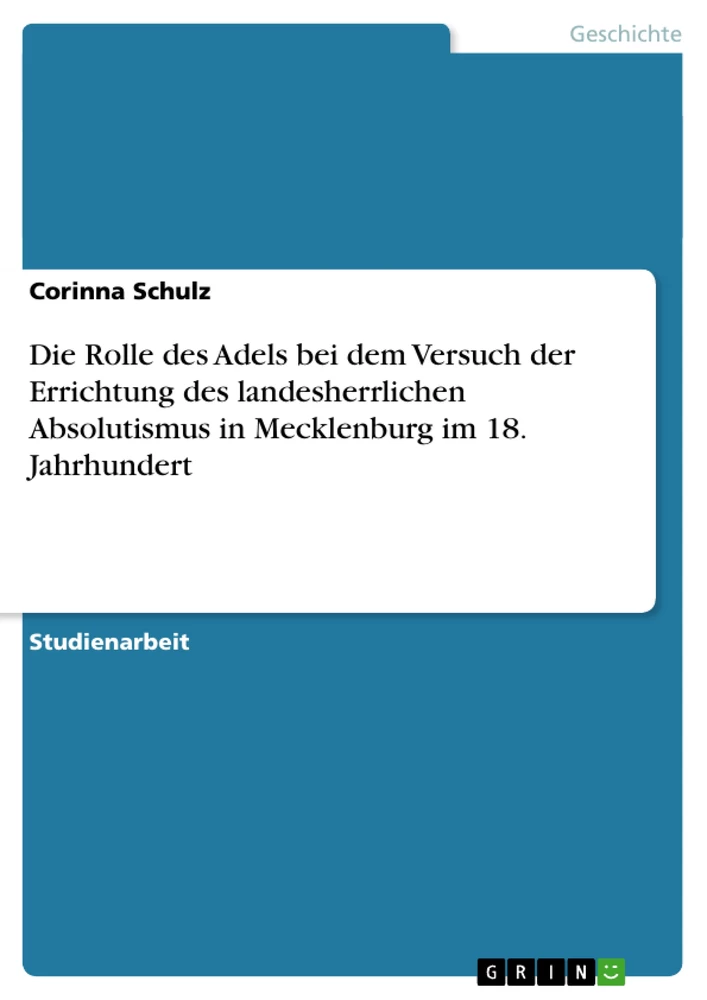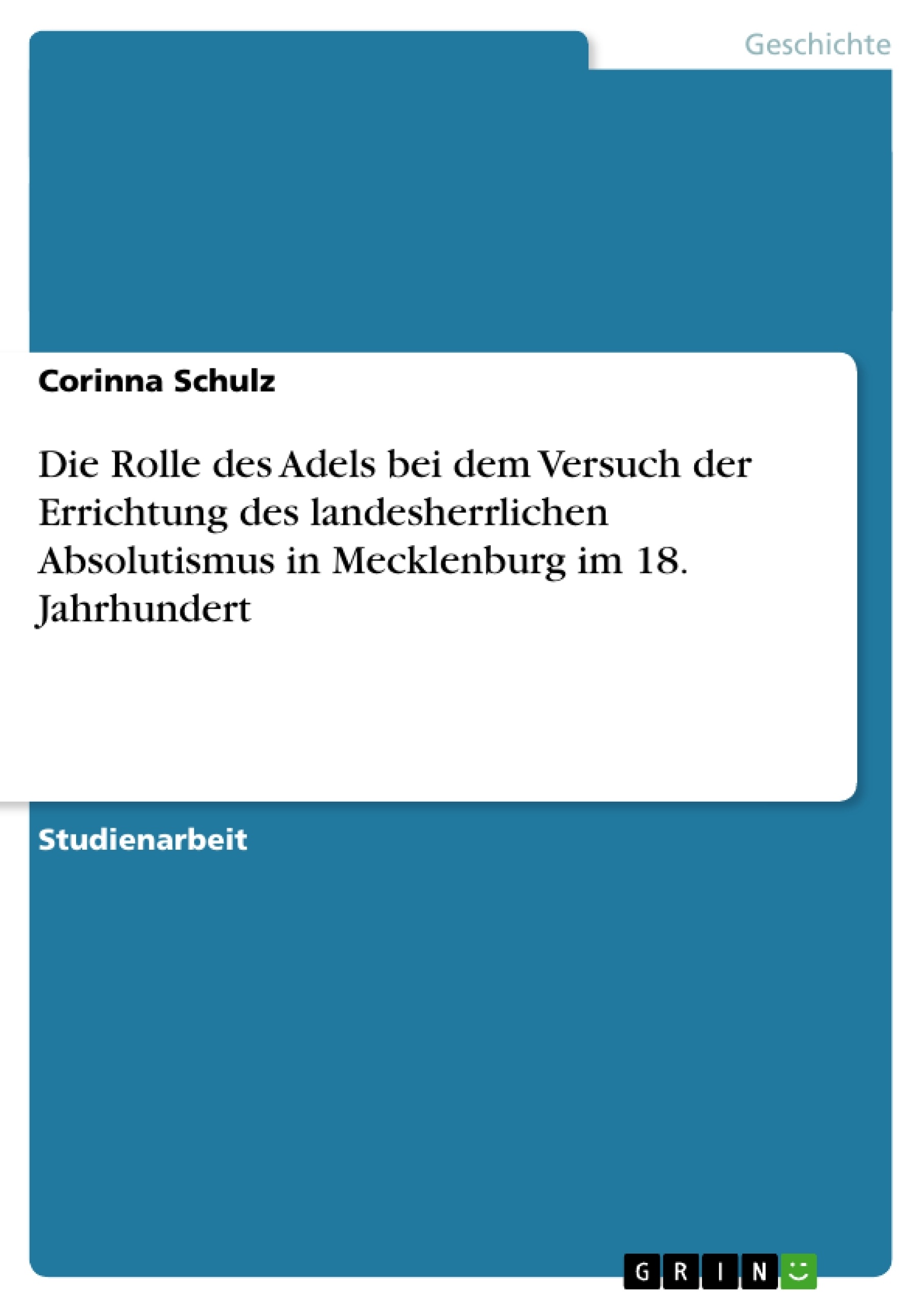Einleitung
Der großgrundbesitzende, ritterschaftliche Adel dominierte über die Jahrhunderte hinweg die Herrschaftsverhältnisse im heutigen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Mitunter findet der Begriff der norddeutschen „Adelsrepublik“ Eingang in die historischen Untersuchungen über den Einfluss der Ritterschaft auf die Geschichte Mecklenburgs.1 Zumeist bewertete die Forschung, insbesondere zu sozialistischen Zeiten, die Ritterschaft als Befürworter eines „fortschrittshemmenden ständisch-monarchischen Dualismus“, die durch den Landesgrundgesetzlichen Erbvergleich (LGGEV) jede progressive Entwicklung für die nächste Zeit hinaus verhinderte.2
Durch die Unterzeichnung des Vergleiches am 18. April 1755 entschieden die Stände einen mehr als zweihundert Jahre andauernden Machtkampf mit dem Landesherrn für sich. Mit der schriftlichen Fixierung des Ständestaates, die vorherige Verträge mit aufnahm, festigten die zumeist adligen Mitglieder der Ritterschaft ihre wirtschaftlich und politisch dominierende Rolle. Der Versuch, den territorialstaatlichen Absolutismus in den mecklenburgischen Landen zu errichten, war endgültig gescheitert.3 Zuvor hatte sich der Kampf in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter dem Schweriner Herzog Karl Leopold (1678-1747) empfindlich zugespitzt. Er mündete in einer Reichsexekution gegen Mecklenburg-Schwerin und letztendlich in der Suspendierung des Landesherrn 1728. Der Kampf Stände gegen den Schweriner Herzog stürzte die mecklenburgischen Lande ins Chaos und in den finanziellen Ruin.
Was aber waren die Gründe für das Scheitern des Landesherrn beim Versuch, seine absoluten Machtansprüche zu verwirklichen? Lag es allein an der Stärke der adligen Ritterschaft in Mecklenburg – wenn ja, worin lag sie begründet - oder spielten auch die Nachbarterritorien, das Reich sowie die europäischen Großmächte beim innermecklenburgischen Konflikt eine Rolle? Bei dieser Frage rückt besonders Hannover mit seinem mächtigen Minister Bernstorff, ein mecklenburgischer Adliger, in den Vordergrund. Um diese Fragen zu erläutern, beginnt die vorliegende Hausarbeit mit der Betrachtung der politischen Verhältnisse Mecklenburgs im 18. Jahrhundert, einer kurzen Einführung zum Mecklenburger Adel sowie einer Darstellung der Situation Mecklenburgs, geprägt durch die drei Landesteilungen und dem Verhältnis des Landesherrn zu den Ständen...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung des Konflikts zwischen Adel und Landesherrn in Mecklenburg bis zum Herzog Karl Leopold
- Der Adel in Mecklenburg zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts
- Die Ritterschaft in Mecklenburg – Mitgliedschaft und Struktur
- Die Entwicklung der Rechte und Privilegien der Ritterschaft
- Erste Versuche der Errichtung einer absoluten Herrschaft in Mecklenburg
- Die missglückte Errichtung einer absolutistischen Herrschaft durch Karl Leopold
- Auseinandersetzung des Herzogs Karl Leopold mit der Ritterschaft
- Die Durchführung der Reichsexekution in Mecklenburg – Das Ende absolutistischer Wunschträume
- Der „Landesgrundgesetzliche Erbvergleich“ vom 18. April 1755 – die Festigung der Ständeherrschaft
- Bilanz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Rolle des Adels bei dem Versuch der Errichtung des landesherrlichen Absolutismus in Mecklenburg im 18. Jahrhundert. Sie untersucht die Gründe für das Scheitern des Landesherrn, seine absoluten Machtansprüche durchzusetzen, und analysiert die Bedeutung der Ritterschaft in Mecklenburg bei diesem Prozess.
- Der Einfluss des Adels auf die Machtverhältnisse in Mecklenburg im 18. Jahrhundert
- Der Konflikt zwischen dem Landesherrn und der Ritterschaft, insbesondere unter Herzog Karl Leopold
- Die Rolle des Landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs (LGGEV) von 1755 und seine Auswirkungen auf den mecklenburgischen Adel
- Die Bedeutung der Reichsexekution gegen Mecklenburg und die Folgen für Land und Adel
- Der Einfluss von Nachbarterritorien, dem Reich und europäischen Großmächten auf den innermecklenburgischen Konflikt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die politische Situation Mecklenburgs im 18. Jahrhundert, die Rolle des Adels in der Region und die Entwicklung des Konflikts zwischen Landesherrn und Ritterschaft. Das zweite Kapitel untersucht den Aufstieg des Adels in Mecklenburg im 18. Jahrhundert und seine Rolle als dominierende Macht. Im dritten Kapitel wird der gescheiterte Versuch von Herzog Karl Leopold beleuchtet, eine absolute Herrschaft in Mecklenburg zu errichten. Das vierte Kapitel analysiert die Folgen der Reichsexekution gegen Mecklenburg und die Festigung der Ständeherrschaft durch den Landesgrundgesetzlichen Erbvergleich.
Schlüsselwörter
Mecklenburg, Adel, Ritterschaft, Absolutismus, Landesherr, Stände, Landesgrundgesetzlicher Erbvergleich (LGGEV), Reichsexekution, Bernstorff, Ständeherrschaft, Herzog Karl Leopold.
- Quote paper
- Corinna Schulz (Author), 2004, Die Rolle des Adels bei dem Versuch der Errichtung des landesherrlichen Absolutismus in Mecklenburg im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37533