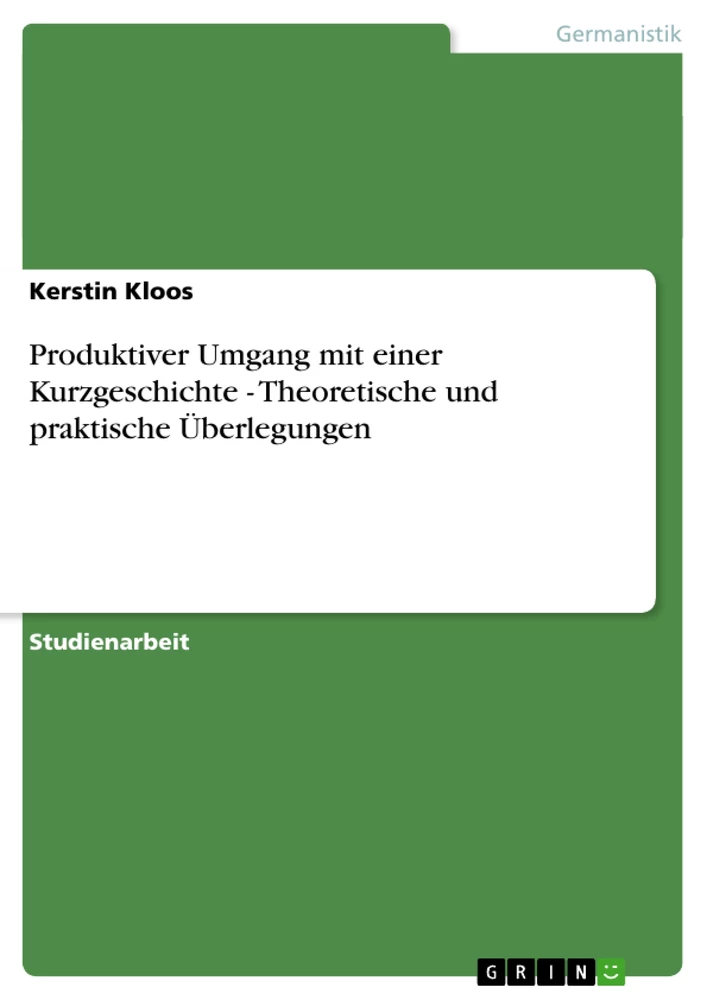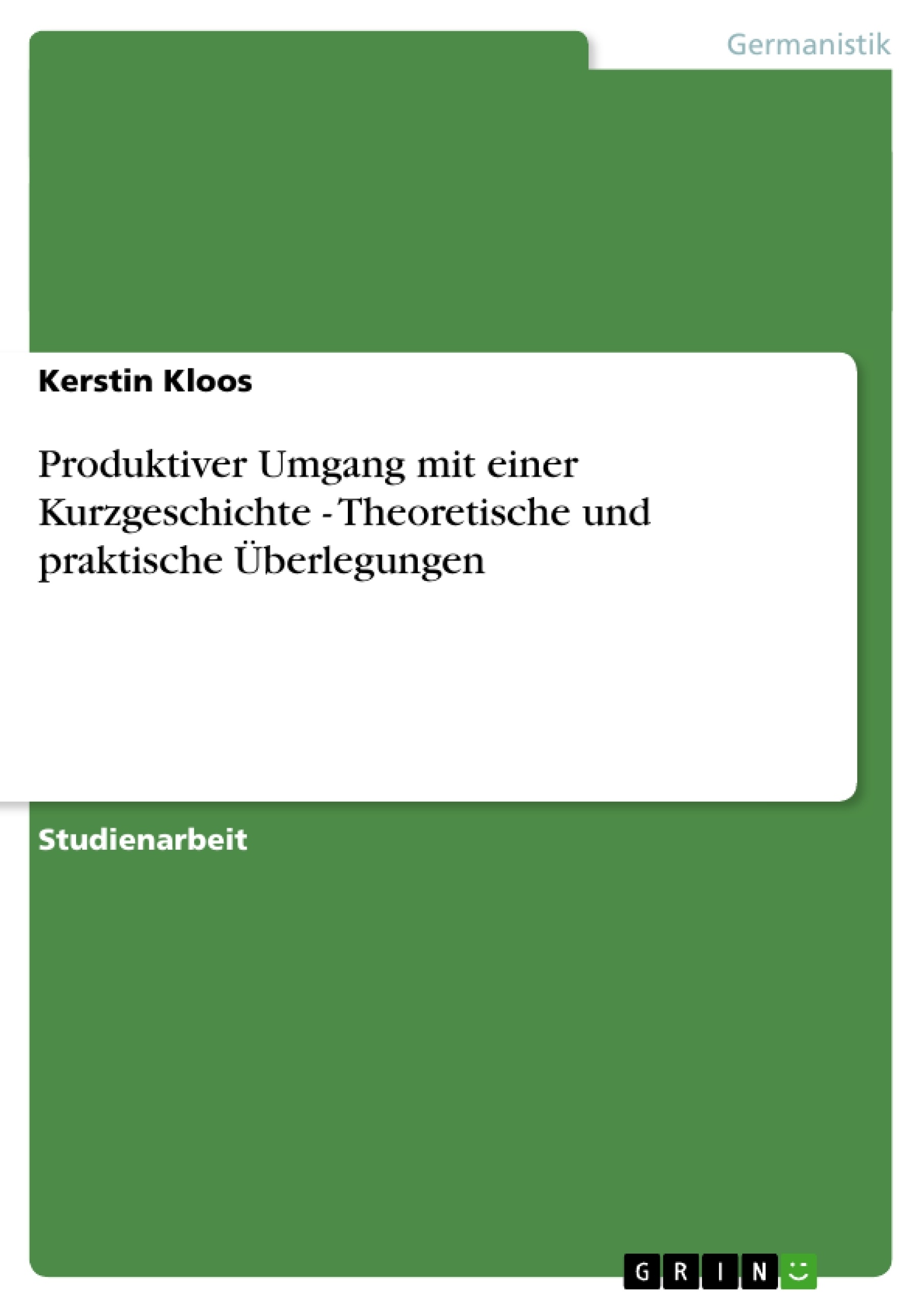Einleitung
Die folgende Hausarbeit stellt eine kleine Ideensammlung für eine Lernsequenz im Deutschunterricht der Klassen 9 oder 10 der Realschule vor. Diese Lernsequenz ist im Bildungsplan im Arbeitsbereich 2: Literatur unter „Produktiver Umgang mit Texten“ einzuordnen. Ziel dieser Einheit ist es, Texte auszugestalten und Texte und Textmuster zu variieren. Dies kann geschehen, indem sowohl Stil als auch Textart und Perspektive einer literarischen Vorlage bearbeitet werden.1 Der produktive Umgang mit Texten ist eine eher freie und kreative Form des Schreibens und führt meist zu neuen literarischen Gebilden, Textergänzungen, Textalternativen oder Textzusätzen.
Andere Ausatzformen wie Textanalyse oder Textinterpretation führen dagegen zu Sachtexten. In der hier vorgestellten Lernsequenz sollen die Schüler die Kurzgeschichte „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ von Heinrich Böll2 im Sinne des Handlungs- und Produktionsorientierten Literaturunterrichts bearbeiten. Seit 1996 ist diese Aufsatzform auch Bestandteil der Realschulabschlussprüfung.3 Der Hauptteil dieser Hausarbeit ist gegliedert in einen Theorie- und einen Praxisteil. Im Theorieteil werden einige Überlegungen zum Aufsatzunterricht aufgeführt, die die gedankliche Basis für die vorgestellte Lernsequenz darstellen. Im Praxisteil wird der Aufgabentyp „Produktiver Umgang mit einer Kurzgeschichte“, die Kurzgeschichte selbst und die dazu gestellten Aufgaben nach den Kriterien der didaktischen Analyse von Klafki4 analysiert. In einer kurzen methodischen Analyse werden dann noch Möglichkeiten zur Gestaltung der Lernsequenz im Unterricht vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Hauptteil
- 2.1 Drei grundlegende Überlegungen zum produktiven Umgang mit Texten
- 2.1.1 Handlungs- und Produktionsorientierter Literaturunterricht
- 2.1.2 Prozessorientierung in der Aufsatzdidaktik
- 2.1.3 Aufsatz: Lerngegenstand oder Lernmedium?
- 2.2 Didaktische Analyse der Lernsequenz
- 2.2.1 Das exemplarische Prinzip
- 2.2.2 Die Gegenwartsbedeutung
- 2.2.3 Die Zukunftsbedeutung
- 2.2.4 Analyse der „Sache“: Die Kurzgeschichte und der produktive Umgang mit dieser Textsorte
- 2.2.5 Die Schreibanlässe
- 2.3 Methodische Überlegungen zur Lernsequenz
- 3.0 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit präsentiert eine Lernsequenz für den Deutschunterricht (Klassen 9/10 Realschule), die sich mit dem produktiven Umgang mit Kurzgeschichten auseinandersetzt, speziell mit Heinrich Bölls „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“. Ziel ist die praktische Anwendung des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts, um kreative Schreibprozesse anzuregen und die Schüler aktiv mit Texten umgehen zu lassen.
- Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht (HuPLi)
- Prozessorientierung im Aufsatzunterricht
- Didaktische Analyse einer Lernsequenz nach Klafki
- Methodische Gestaltungsmöglichkeiten im Unterricht
- Produktive Auseinandersetzung mit Kurzgeschichten
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Lernsequenz für den Deutschunterricht der Klassen 9 und 10 vor. Sie beschreibt den Fokus auf den produktiven Umgang mit Texten im Rahmen des Bildungsplans und benennt die Zielsetzung der Einheit: die Gestaltung und Variation von Texten hinsichtlich Stil, Textart und Perspektive. Die Arbeit kündigt den Aufbau mit Theorie- und Praxisteil an und hebt die Bedeutung der Kurzgeschichte von Heinrich Böll hervor.
2.0 Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in zwei Abschnitte: Zuerst werden theoretische Grundlagen zum produktiven Umgang mit Texten erörtert. Dies umfasst den handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht (HuPLi) mit seinem Fokus auf emotionale und kognitive Intelligenz, die Prozessorientierung im Aufsatzunterricht mit Betonung des Schreibprozesses statt nur des fertigen Produkts, und die Frage nach dem Aufsatz als Lerngegenstand oder Lernmedium. Im zweiten Abschnitt erfolgt eine didaktische Analyse der Lernsequenz anhand der Kriterien von Klafki (exemplarische, Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung) und eine Analyse der ausgewählten Kurzgeschichte von Heinrich Böll. Methodische Überlegungen zur praktischen Umsetzung der Lernsequenz im Unterricht werden ebenfalls angesprochen.
2.1 Drei grundlegende Überlegungen zum produktiven Umgang mit Texten: Dieser Abschnitt legt die theoretischen Grundlagen für die Lernsequenz. Er beschreibt den handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht (HuPLi) als Gegenpol zur traditionellen Literaturdidaktik, der emotionale und kognitive Aspekte verbindet und langsamen Lernenden mehr Möglichkeiten bietet. Der HuPLi betont die aktive Beteiligung des Schülers, seine subjektive Auseinandersetzung mit dem Text und die kreative Gestaltung durch Variation, Modifikation und Ergänzung. Weiterhin wird die Prozessorientierung im Aufsatzunterricht behandelt, die den Fokus auf den gesamten Schreibprozess legt und die verschiedenen Phasen (Motivation, Planung, Formulierung, Überprüfung) betont. Abschließend wird die Frage nach der Rolle des Aufsatzes als Lerngegenstand oder Lernmedium diskutiert.
Schlüsselwörter
Produktive Textgestaltung, Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht (HuPLi), Prozessorientierung, Aufsatzdidaktik, Didaktische Analyse (Klafki), Kurzgeschichte, Heinrich Böll, „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“, Lernsequenz, Deutschunterricht, Realschule.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Lernsequenz zum produktiven Umgang mit Kurzgeschichten
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit präsentiert eine Lernsequenz für den Deutschunterricht in den Klassen 9/10 der Realschule. Der Fokus liegt auf dem produktiven Umgang mit Kurzgeschichten, insbesondere Heinrich Bölls „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“. Ziel ist die Anwendung handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts, um kreative Schreibprozesse anzuregen.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht (HuPLi), Prozessorientierung im Aufsatzunterricht, didaktische Analyse einer Lernsequenz nach Klafki, methodische Gestaltungsmöglichkeiten im Unterricht und die produktive Auseinandersetzung mit Kurzgeschichten.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Hausarbeit stützt sich auf die Theorie des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts (HuPLi), die Prozessorientierung im Aufsatzunterricht und die didaktische Analyse nach Klafki (exemplarische, Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung). Es wird die Rolle des Aufsatzes als Lerngegenstand oder Lernmedium diskutiert.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. Der Hauptteil gliedert sich in Abschnitte zu den theoretischen Grundlagen des produktiven Umgangs mit Texten und einer didaktischen Analyse der Lernsequenz, einschließlich methodischer Überlegungen.
Welche Kurzgeschichte wird analysiert?
Die Hausarbeit analysiert Heinrich Bölls Kurzgeschichte „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ im Kontext der Lernsequenz.
Welche Zielsetzung verfolgt die Lernsequenz?
Die Lernsequenz zielt darauf ab, die Schüler aktiv mit Texten umgehen zu lassen, kreative Schreibprozesse anzuregen und die Gestaltung und Variation von Texten hinsichtlich Stil, Textart und Perspektive zu fördern.
Welche methodischen Überlegungen werden angestellt?
Die Hausarbeit beschreibt methodische Überlegungen zur praktischen Umsetzung der Lernsequenz im Unterricht, die auf dem handlungs- und produktionsorientierten Ansatz basieren.
Für welche Schulform ist die Lernsequenz konzipiert?
Die Lernsequenz ist für die Klassen 9 und 10 der Realschule konzipiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Produktive Textgestaltung, Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht (HuPLi), Prozessorientierung, Aufsatzdidaktik, Didaktische Analyse (Klafki), Kurzgeschichte, Heinrich Böll, „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“, Lernsequenz, Deutschunterricht, Realschule.
- Quote paper
- Kerstin Kloos (Author), 2003, Produktiver Umgang mit einer Kurzgeschichte - Theoretische und praktische Überlegungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37495