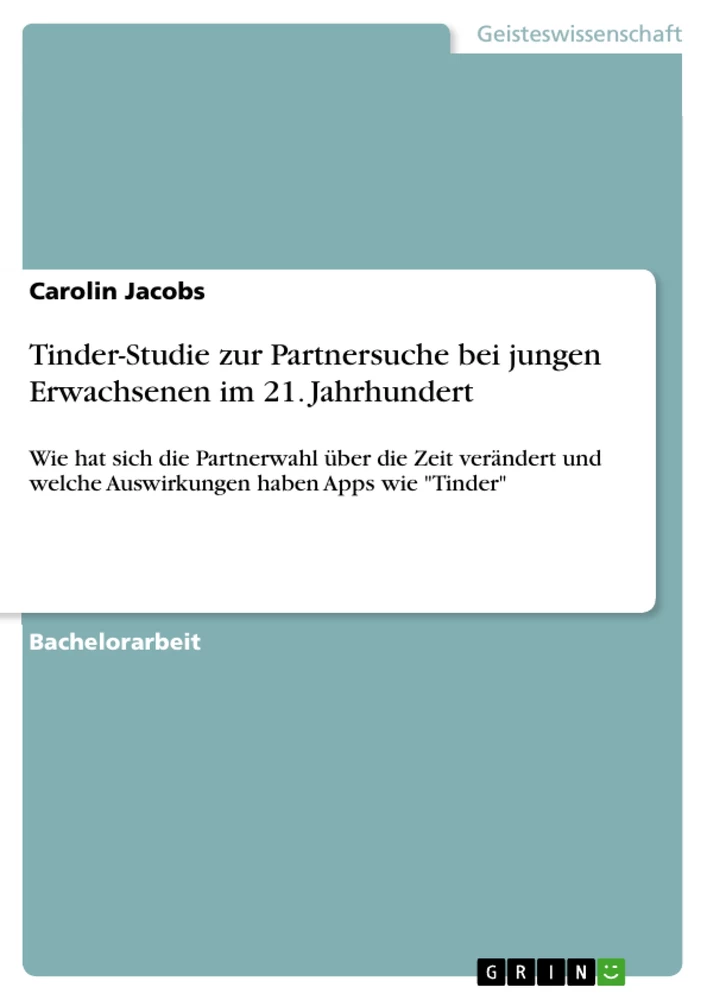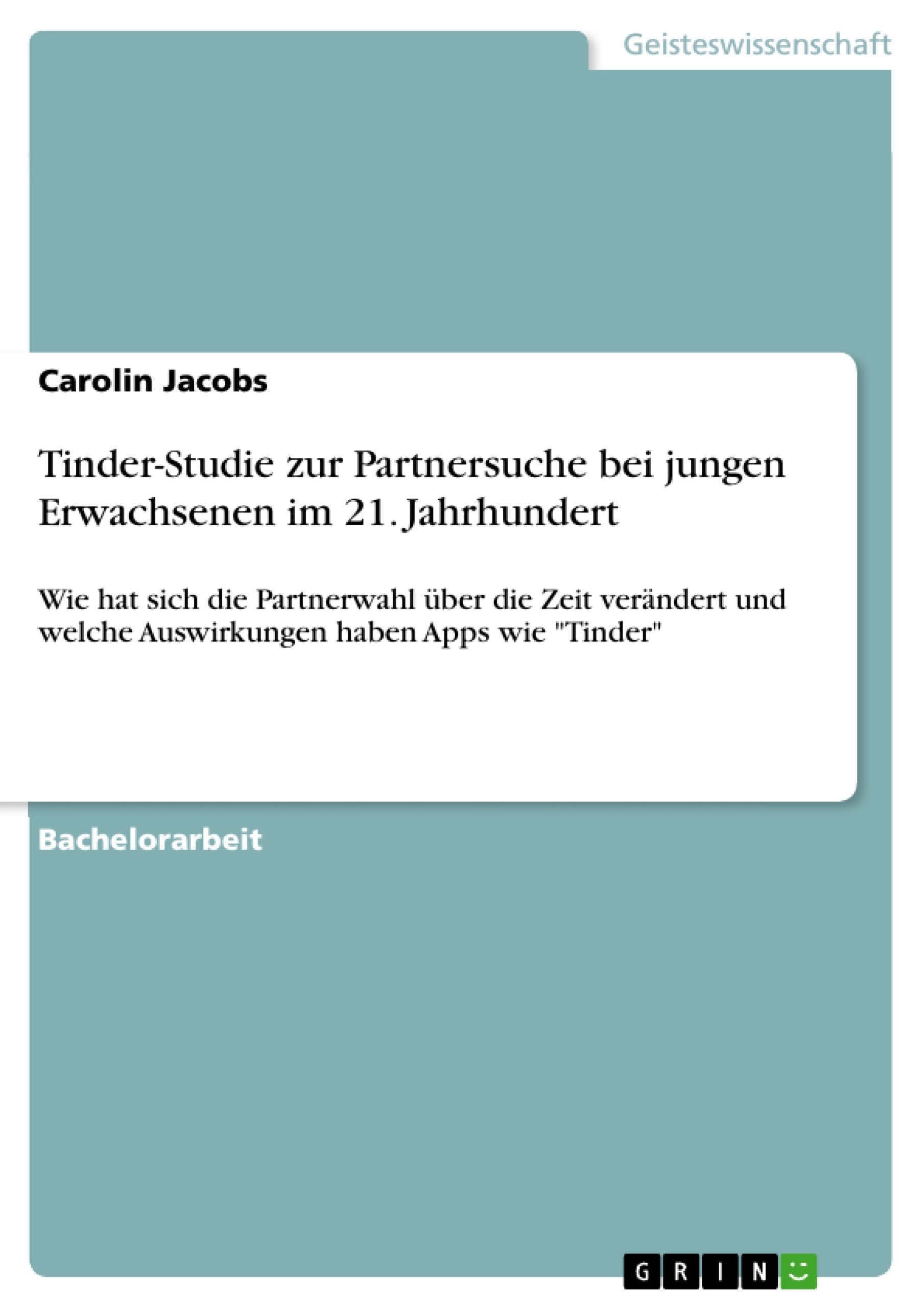Diese Fragebogenstudie im Querschnittsdesign untersucht das Nutzungsverhalten und die dahinterliegenden Motive sowie die Partnerwahlkriterien junger Erwachsener im 21. Jahrhundert als Nutzer der Dating-Applikation Tinder. Die Grundlage dieser empirischen Arbeit besteht in dem Gedanken, dass sich die Nutzungshäufigkeit und -motive sowie die Partnerwahlkriterien hinsichtlich des Geschlechts und des Beziehungsstatus der Nutzer unterscheiden. Darüber hinaus besteht die Annahme, dass den Nutzungsmotiven und Partnerwahlkriterien eine faktorielle Struktur zugewiesen werden kann. Die Stichprobe besteht aus 47 Tinder-Nutzern im Alter von 18–33 Jahren. Die Rekrutierung erfolgte online über das soziale Netzwerk Facebook. Für die Datenerhebung wird ein eigens konzipierter Fragebogen erstellt, der sowohl die Tinder-Nutzung und die dahinterliegenden Motive als auch die Partnerwahlkriterien erfasst. Um mögliche Probanden mit der Neigung zu sozial erwünschten Antworten zu vermeiden, wurde der Fragebogen durch eine Lügenskala auf Basis einer Modifikation der SozialenErwünschtsheitsSkala17 nach Stöber ergänzt. Für die Prüfung der Hypothesen werden t-Tests für unabhängige Stichproben, einfaktorielle Varianzanalysen sowie explorative Faktoranalysen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass signifikante Unterschiede für manche Nutzungsmotive sowie für einige Partnerwahlkriterien im Hinblick auf das Geschlecht und den Beziehungsstatus vorliegen. Den Nutzungsmotiven konnte darüber hinaus eine faktorielle Struktur mit vier Faktoren zugewiesen werden, wobei dies bei den Partnerwahlkriterien nicht möglich war.
Warum suchen die meisten Menschen ihr Leben lang nach einem geeigneten Partner? Die menschliche Natur ist so geschaffen, dass wir nur dann überleben können, wenn sich Mann und Frau vereinigen und sich fortpflanzen. Im Wandel der Zeit und besonders durch die Expansion des Internets hat sich die Partnersuche über die Jahre erheblich verändert. Unabhängig ob iPhone, Android oder Windows Phone; Smartphones bieten heutzutage eine Vielzahl an Möglichkeiten, um sich mit anderen Menschen zu vernetzen. Gerade bei jungen Erwachsenen sind diese Möglichkeiten aus dem alltäglichen Leben nicht mehr weg zu denken.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Partnersuche in der Vergangenheit
- 2.1.1 Evolutionärer Ansatz zur Partnerwahl
- 2.1.2 Partnersuche am Beispiel des 19. und 20. Jahrhunderts
- 2.2 Partnersuche im technologischen Zeitalter
- 2.2.1 Begriffsbestimmung und Definition von Online-Dating
- 2.2.2 Präferenzen bei der Partnerwahl
- 2.2.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Partnerwahl
- 2.2.4 Partnersuche 2.0 - Mobile-Dating
- 2.3 Dating-Applikation Tinder
- 2.3.1 Geschichte und Funktion
- 2.3.2 Nutzungsverhalten und -motive
- 2.3.3 Physische Attraktivität
- 2.4 Risiken und Konsequenzen medialer Partnersuche
- 2.5 Bisherige Forschung
- 2.6 Forschungsfragen und Hypothesen
- 3 Methodik
- 3.1 Untersuchungsdesign und Durchführung der Datenerhebung
- 3.2 Stichprobe
- 3.3 Erhebungsinstrumente
- 3.3.1 Tinder-Nutzung und Nutzungsmotive
- 3.3.2 Partnerwahlkriterien
- 3.3.3 Lügenskala auf Basis der SES-17
- 3.3.4 Demographische Daten
- 3.4 Datenanalyse
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Deskriptive Statistiken
- 4.2 Beantwortung der Forschungshypothesen
- 4.2.1 Ergebnisse der ersten Hypothese
- 4.2.2 Ergebnisse der zweiten Hypothese
- 4.2.3 Ergebnisse der dritten Hypothese
- 4.2.4 Ergebnisse der vierten Hypothese
- 4.2.5 Ergebnisse der fünften Hypothese
- 4.2.6 Ergebnisse der sechsten Hypothese
- 5 Diskussion
- 5.1 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
- 5.2 Limitationen der Studie
- 5.3 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Nutzungsverhalten und die Motive junger Erwachsener bei der Nutzung der Dating-App Tinder. Im Fokus steht die Frage, ob sich die Nutzungshäufigkeit, die Motive und die Partnerwahlkriterien in Abhängigkeit von Geschlecht und Beziehungsstatus unterscheiden. Zusätzlich wird geprüft, ob den Nutzungsmotiven und Partnerwahlkriterien eine faktorielle Struktur zugewiesen werden kann.
- Nutzungsverhalten junger Erwachsener auf Tinder
- Motive für die Tinder-Nutzung
- Partnerwahlkriterien auf Tinder
- Einfluss von Geschlecht und Beziehungsstatus auf Tinder-Nutzung und Partnerwahl
- Faktorielle Struktur von Nutzungsmotiven und Partnerwahlkriterien
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Untersuchung von Partnersuche im digitalen Zeitalter. Es skizziert den Forschungsstand und formuliert die Forschungsfragen und Hypothesen.
2 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen der Arbeit. Es beleuchtet die Geschichte der Partnersuche, von evolutionären Ansätzen bis hin zur modernen Online-Partnersuche. Es definiert Online-Dating, beschreibt präferierte Partnerwahlkriterien und geschlechtsspezifische Unterschiede. Ein Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung der Dating-App Tinder, ihres Nutzungsverhaltens und der damit verbundenen Risiken. Der Abschnitt zu bereits existierenden Forschungsergebnissen bildet die Grundlage für die eigenen Forschungsfragen.
3 Methodik: Hier wird die Methodik der empirischen Studie detailliert beschrieben. Es wird das Untersuchungsdesign (Querschnittsdesign) erläutert, die Stichprobenzusammensetzung (47 Tinder-Nutzer im Alter von 18-33 Jahren, online rekrutiert über Facebook) vorgestellt und die verwendeten Erhebungsinstrumente (eigens entwickelter Fragebogen inklusive Lügenskala basierend auf der SES-17) erklärt. Der Abschnitt beschreibt die statistischen Methoden zur Datenanalyse (t-Tests, Varianzanalysen, explorative Faktoranalysen).
4 Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Analysen präsentiert. Es werden deskriptive Statistiken berichtet und die Ergebnisse im Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen interpretiert. Es wird detailliert dargestellt, ob signifikante Unterschiede in den Nutzungsmotiven und Partnerwahlkriterien in Bezug auf Geschlecht und Beziehungsstatus bestehen und ob eine faktorielle Struktur identifiziert werden konnte.
Schlüsselwörter
Tinder, Online-Dating, Partnersuche, junge Erwachsene, Nutzungsverhalten, Motive, Partnerwahlkriterien, Geschlecht, Beziehungsstatus, Faktoranalyse, empirische Studie, sozial erwünschte Antworten.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Partnersuche auf Tinder
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das Nutzungsverhalten und die Motive junger Erwachsener bei der Nutzung der Dating-App Tinder. Im Fokus steht der Einfluss von Geschlecht und Beziehungsstatus auf die Nutzungshäufigkeit, die Motive und die Partnerwahlkriterien. Zusätzlich wird die faktorielle Struktur von Nutzungsmotiven und Partnerwahlkriterien analysiert.
Welche Themen werden im theoretischen Hintergrund behandelt?
Der theoretische Teil beleuchtet die Geschichte der Partnersuche, von evolutionären Ansätzen bis zur modernen Online-Partnersuche. Es werden Online-Dating, präferierte Partnerwahlkriterien und geschlechtsspezifische Unterschiede beschrieben. Ein Schwerpunkt liegt auf Tinder: Geschichte, Funktion, Nutzungsverhalten, Motive und Risiken. Der Abschnitt zu existierenden Forschungsergebnissen bildet die Grundlage für die eigenen Forschungsfragen.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet ein Querschnittsdesign. Die Stichprobe besteht aus 47 Tinder-Nutzern (18-33 Jahre), online über Facebook rekrutiert. Die Datenerhebung erfolgte mittels eines eigens entwickelten Fragebogens inklusive Lügenskala (basierend auf der SES-17). Die Datenanalyse umfasst t-Tests, Varianzanalysen und explorative Faktoranalysen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Das Kapitel präsentiert deskriptive Statistiken und interpretiert die Ergebnisse im Hinblick auf die aufgestellten Hypothesen. Es wird detailliert dargestellt, ob signifikante Unterschiede in den Nutzungsmotiven und Partnerwahlkriterien in Bezug auf Geschlecht und Beziehungsstatus bestehen und ob eine faktorielle Struktur identifiziert werden konnte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Tinder, Online-Dating, Partnersuche, junge Erwachsene, Nutzungsverhalten, Motive, Partnerwahlkriterien, Geschlecht, Beziehungsstatus, Faktoranalyse, empirische Studie, sozial erwünschte Antworten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Methodik, Ergebnisse und Diskussion. Die Einleitung führt in das Thema ein und formuliert die Forschungsfragen und Hypothesen. Der theoretische Hintergrund liefert den Rahmen, die Methodik beschreibt die empirische Studie, die Ergebnisse präsentieren die Analysen und die Diskussion interpretiert die Ergebnisse, benennt Limitationen und gibt einen Ausblick.
Welche Forschungsfragen und Hypothesen wurden untersucht?
Die Arbeit untersucht, ob sich die Nutzungshäufigkeit, die Motive und die Partnerwahlkriterien auf Tinder in Abhängigkeit von Geschlecht und Beziehungsstatus unterscheiden. Zusätzlich wird geprüft, ob den Nutzungsmotiven und Partnerwahlkriterien eine faktorielle Struktur zugewiesen werden kann. Konkrete Hypothesen werden im Kapitel 2.6 detailliert formuliert.
Welche Limitationen der Studie werden diskutiert?
Die Limitationen der Studie werden im Kapitel 5.2 diskutiert. Diese könnten beispielsweise die Stichprobengröße, die Rekrutierungsmethode oder die spezifischen Eigenschaften der Tinder-Nutzer betreffen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit dem Thema Online-Dating, Partnersuche und dem Nutzungsverhalten von Dating-Apps befassen. Sie bietet Einblicke in die Motivlage und Partnerwahlkriterien junger Erwachsener im Kontext von Tinder und kann für weitere Forschung im Bereich der digitalen Partnersuche genutzt werden.
- Quote paper
- Carolin Jacobs (Author), 2017, Tinder-Studie zur Partnersuche bei jungen Erwachsenen im 21. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374767