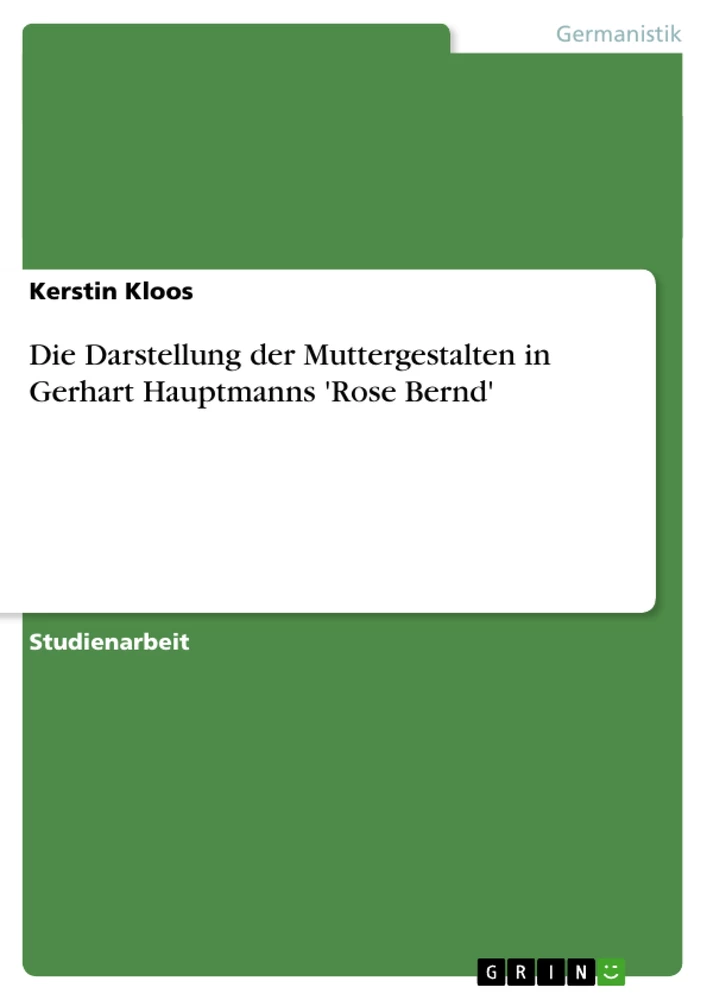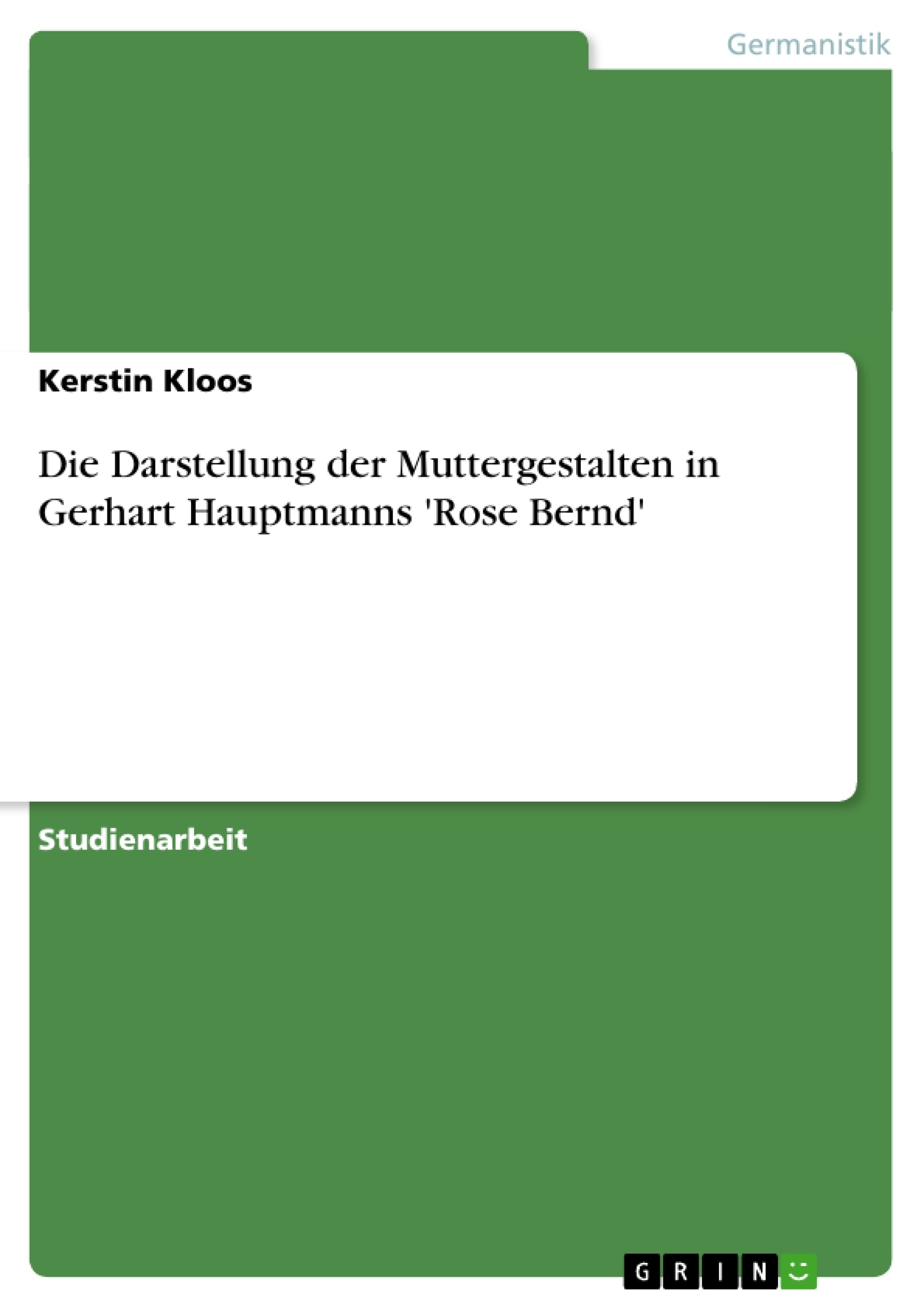Einleitung
„Die Seele selbst der vollkommen glücklichen Frau wird auf die Dauer nicht erfüllt durch den Mann. Auch nicht durch das erwachsene Kind. Ganz erfüllt, ganz reich, wird sie nur durch neue Mutterschaft ... Sie [die Mutter] behält das Bewusstsein davon lange, wenn Missgeschick ihr den Säugling wieder entreißt.“ schreibt Gerhart Hauptmann am 10. Mai 1910, einen Tag nachdem sein zweiter Sohn Gerhart Erasmus zwei Tage nach seiner Geburt gestorben ist. Er drückt damit genau das Phänomen aus, das er schon in seinem 1903 erschienen Werk „Rose Bernd“ beschrieben hat: Glück und Schmerz der Mutterschaft.
In seinem Werk präsentiert er zwei Mutterschicksale, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Auf der einen Seite die junge, schöne Rose, die aufgrund ihrer Sinnlichkeit von den Männern zum Sexualobjekt degradiert wird und schließlich ein uneheliches Kind zur Welt bringt; auf der anderen die ältere, kranke Frau Flamm, die trotz oder gerade aufgrund des frühen Verlusts ihres einzigen Kindes die Mutter schlechthin verkörpert. Detailgetreu beschreibt er Aussehen und Verhalten von Rose und Frau Flamm, die in gewisser Weise dasselbe Schicksal teilen: die Konfrontation mit dem Tod des eigenen Kindes, bei Rose noch in drastischerer Form sogar der Mord am eigenen Kind. Hauptmann ist bekannt dafür, dass viele seiner Muttergestalten starke mütterliche Wärme ausstrahlen, aber auch dafür, dass er das Leid der Mütter kennt und es in seinen schmerzlichsten und erschütterndsten Zügen zu beschreiben vermag. Von Interesse ist, was Gerhart Hauptmann dazu brachte, seine Mütter gerade so zu beschreiben und nicht anders und was seine Intention dabei war. Bei der Beantwortung dieser Fragestellung rücken drei Aspekte in den Vordergrund: Vorkommnisse aus seinem Leben, die er bewusst oder unbewusst in seine Figuren einfließen lässt; mythische Elemente, die ihm zur Objektivierung seiner Darstellungen dienen und schließlich sozialkritische Absichten, die er mit Roses und Frau Flamms Schicksal zu erreichen versucht. Im Folgenden sollen diese Themen ausgeführt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 2.0 Hauptteil
- 2.1 Biografische Aspekte in Hauptmanns Mutterfiguren
- 2.1.1 Die meineidige Kindsmörderin Hedwig Otto als stofflicher Anhaltspunkt für die Figur Rose
- 2.1.2 Frau Flamm: Gemeinsamkeiten mit Hauptmanns Mutter Marie Hauptmann-Straehler
- 2.2 Mythische und religiöse Elemente in beiden Mutterfiguren
- 2.2.1 Rose repräsentiert die fruchtbare, natürliche Mutter
- 2.2.2 Frau Flamm vertritt den Typus der schmerzreichen Mutter (mater dolorosa)
- 2.3 Das Schicksal der Mutterfiguren: Hauptmanns Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen
- 2.3.1 Rose in Konflikt mit dem gesellschaftlichen Wertesystem
- 2.3.2 Frau Flamms und Roses Handeln als Ausdruck von Sozialkritik
- 3.0 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Darstellung der Muttergestalten in Gerhart Hauptmanns „Rose Bernd“ und analysiert die biografischen, mythischen und sozialkritischen Aspekte, die in diesen Figuren zum Ausdruck kommen. Ziel ist es, das komplexe Zusammenspiel von individueller Erfahrung, mythischer Symbolik und gesellschaftlicher Kritik in Hauptmanns Darstellung der Mutterschaft aufzuzeigen.
- Einfluss biografischer Erfahrungen auf die Figuren Rose und Frau Flamm
- Mythische und religiöse Bezüge in der Darstellung der beiden Mutterfiguren
- Sozialkritische Aspekte in Hauptmanns Darstellung des Schicksals der Mütter
- Konflikt zwischen individueller Lebensentfaltung und gesellschaftlichen Normen
- Darstellung der Mutterschaft als Quelle von Glück und Schmerz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und zeigt auf, wie Gerhart Hauptmanns eigenes Leben und Werk durch das Thema der Mutterschaft geprägt wurden. Anschließend wird im Hauptteil zunächst auf die biografischen Aspekte der Mutterfiguren Rose und Frau Flamm eingegangen. Kapitel 2.1.1 untersucht die Verbindung zwischen der Figur Rose und dem Fall der meineidigen Kindsmörderin Hedwig Otto, während Kapitel 2.1.2 Parallelen zwischen Frau Flamm und Hauptmanns eigener Mutter Marie Hauptmann-Straehler beleuchtet.
Im Anschluss widmet sich die Arbeit der mythischen und religiösen Elemente, die in beiden Figuren zum Ausdruck kommen. Rose verkörpert die fruchtbare, natürliche Mutter, während Frau Flamm den Typus der schmerzreichen Mutter (mater dolorosa) repräsentiert.
Im letzten Teil des Hauptteils werden die sozialkritischen Aspekte von Roses und Frau Flamms Schicksal näher betrachtet. Dabei werden die Konflikte der beiden Figuren mit dem gesellschaftlichen Wertesystem und deren Handeln als Ausdruck von Sozialkritik analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Muttergestalten in Gerhart Hauptmanns „Rose Bernd“, wobei insbesondere die Aspekte der Biografie, Mythologie und Sozialkritik beleuchtet werden. Schlüsselbegriffe sind: Gerhart Hauptmann, Rose Bernd, Frau Flamm, Kindsmörderin, mater dolorosa, gesellschaftliche Verhältnisse, sozialkritische Literatur, Mythen, biografische Elemente.
- Quote paper
- Kerstin Kloos (Author), 2001, Die Darstellung der Muttergestalten in Gerhart Hauptmanns 'Rose Bernd', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37474