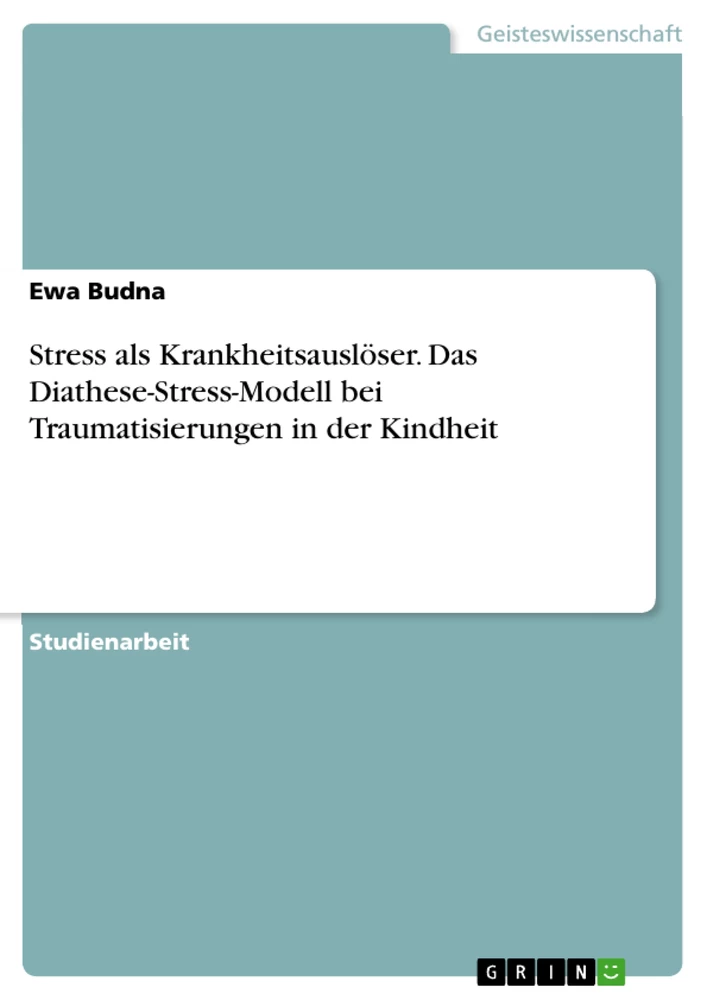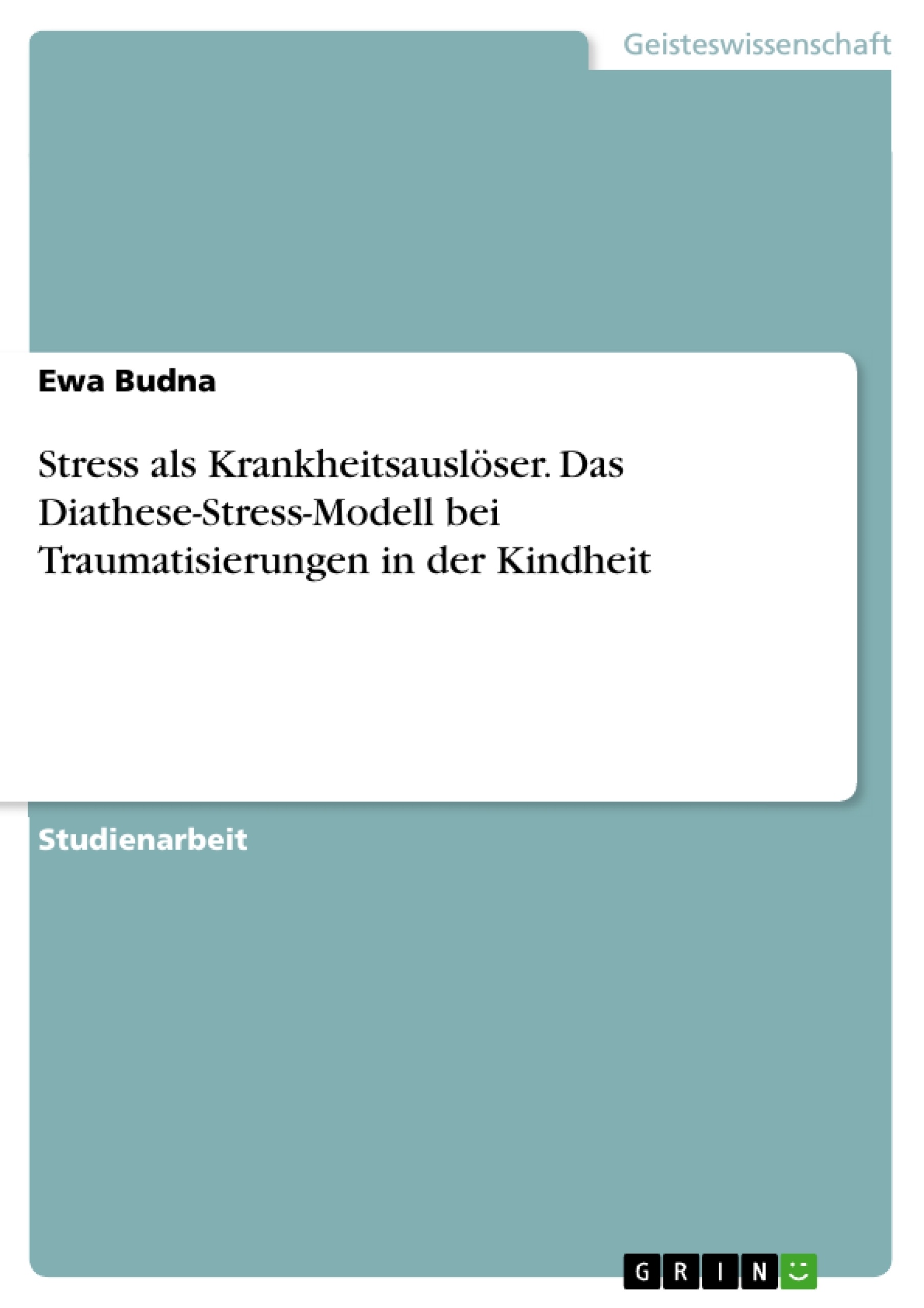Diese Arbeit beleuchtet unter Zuhilfenahme des Diathese-Stress-Modells den Zusammenhang zwischen Stress und Krankheit anhand von Traumatisierungen in der Kindheit. So wie es Straßenkarten, Wetterkarten, geografische Karten gibt, sind auch bei dem Phänomen „Krankheit“ diverse Betrachtungsweisen möglich. Alle heute bekannten Annahmen, die das Phänomen „Krankheit“ betreffen, lassen sich auf sogenannte Paradigmen, das heißt Modellvorstellungen, mit denen ein Teil der Realität beschrieben und erklärt werden kann, zurückführen.
Medizin, Biologie, Physik und andere wissenschaftliche Disziplinen nähern sich ihren Untersuchungsgegenständen mithilfe von Modellen, die so lange eine Daseinsberechtigung haben, wie sie nützlich sind. Da sie keine Glaubenssysteme sind, beziehen sie ihren Wert nicht aus sich selbst, sondern aus ihrer Erklärungskraft. Sie sind Hilfsmittel, die nur einen bestimmten Ausschnitt der Wirklichkeit mit nur bestimmten Aspekten erfassen. Manche Paradigmen verlieren ihre Gültigkeit und es gibt Paradigmenwechsel. Beispiele sind das Ptolemäische Weltbild, die Theorie von der Entstehung der Arten oder die berühmten Urey-Miller-Versuche von 1953.
Die Realität sorgt dafür, dass uns vertraut gewordene Erklärungsmodelle obsolet werden und ihre Tauglichkeit immer wieder aufs Neue beweisen müssen. Es ist wichtig, nicht nur ein bzw. nicht zu viele Modelle in der Arbeit zu benutzten. Ein Modell reduziert die Anzahl der Fälle, mit denen man arbeiten kann. Zu viele Modelle zu kennen, birgt die Gefahr, Beliebigkeit zu schaffen, und schadet damit auch der Professionalität. Man sollte sich bewusst sein, mit welchem Modell man vertraut ist und in welcher Weise man es im konkreten Fall anwendet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung: Erklärungsmodelle und ihre Funktion
- 2 Definition der Krankheit
- 3 Stress und Krankheit
- 3.1 Stress und Angstreaktionen
- 3.2 Hinweise aus der Psychoneuroimmunologie
- 4 Diathese-Stress-Modelle
- 4.1 Stress als Bewertungsprozess
- 4.2 Diathese-Stress-Modelle (Vulnerabilitäts-Stress-Modelle)
- 4.3 Zusammenfassung Diathese-Stress-Modell
- 5 Vom Missbrauch zur Krankheit
- 5.1 Die Spätfolgen einer schweren Kindheit
- 5.2 Eine Fall-Vignette
- 5.3 Die Zusammenhänge zwischen den körperlichen und seelischen Leiden
- 5.3.1 ACE-Studie (Adverse Childhood Experiences)
- 5.3.2 Risikogene für erhöhte Stressanfälligkeit
- 5.3.3 Botenstoffe hinterlassen bleibende Spuren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht verschiedene Modelle zur Erklärung von Krankheit und beleuchtet insbesondere das Diathese-Stress-Modell im Kontext von Kindheitstraumatisierungen. Ziel ist es, das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Stress, Körper und Krankheit zu vertiefen.
- Erklärungsmodelle von Krankheit
- Definition und Verständnis von Krankheit
- Der Einfluss von Stress auf die Entstehung von Krankheiten
- Das Diathese-Stress-Modell und seine Anwendung
- Langzeitfolgen von Kindheitstraumatisierungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Erklärungsmodelle und ihre Funktion: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und erklärt die Notwendigkeit verschiedener Erklärungsmodelle für das Phänomen "Krankheit". Es veranschaulicht, dass Modelle als Werkzeuge zur Beschreibung und Erklärung der Realität dienen, ihre Gültigkeit jedoch je nach Erkenntnisfortschritt verlieren können. Der Text betont die Wichtigkeit eines bewussten Umgangs mit Modellen, um Beliebigkeit zu vermeiden und Professionalität zu gewährleisten.
2 Definition der Krankheit: Das Kapitel befasst sich mit der komplexen und vielschichtigen Definition von Krankheit. Es zeigt die historische Entwicklung des Krankheitsverständnisses auf, beginnend mit dem galenischen Konzept der Homöostase bis hin zur modernen biologisch-somatischen Sichtweise. Die Arbeit verdeutlicht die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition aufgrund der medizinischen, psychologischen, juristischen und soziologischen Aspekte von Krankheit und präsentiert verschiedene aktuelle Definitionen, unter anderem aus dem Versicherungsrecht und der Gesundheitsberichterstattung.
3 Stress und Krankheit: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Stress und Krankheit. Es wird der intuitive Zusammenhang zwischen psychischen und körperlichen Zuständen erläutert und durch empirische Belege, wie die Auswirkungen von Stress auf das Immunsystem bei Medizinstudenten, untermauert. Der Text legt den Fokus auf den nachweisbaren Einfluss von Stress auf die Gesundheit und die Körperfunktionen.
4 Diathese-Stress-Modelle: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Diathese-Stress-Modell (Vulnerabilitäts-Stress-Modell), das die Interaktion zwischen prädisponierenden Faktoren (Diathese) und stressauslösenden Ereignissen als Ursache für die Entstehung von Krankheiten darstellt. Es analysiert den Stress als Bewertungsprozess und die Rolle von Vulnerabilitäten im Hinblick auf die Krankheitsentstehung. Die Zusammenfassung dieses Modells bildet den Kern des Kapitels.
5 Vom Missbrauch zur Krankheit: Dieses Kapitel befasst sich mit den Spätfolgen von schwerwiegenden Kindheitserfahrungen. Es präsentiert eine Fallvignette, um die komplexen Zusammenhänge zwischen körperlichen und seelischen Leiden zu illustrieren. Die ACE-Studie (Adverse Childhood Experiences) wird als Beispiel herangezogen, um die weitreichenden Folgen von Missbrauch und Vernachlässigung aufzuzeigen. Die Rolle von Risikogenen und Botenstoffen in der Entwicklung von Krankheiten wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Krankheitsmodelle, Diathese-Stress-Modell, Stress, Krankheit, Kindheitstraumatisierung, Psychoneuroimmunologie, Vulnerabilität, Spätfolgen, ACE-Studie, Risikogene, Botenstoffe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Erklärungsmodelle von Krankheit und der Einfluss von Kindheitstraumatisierungen
Was ist der Gegenstand des Textes?
Der Text befasst sich mit verschiedenen Erklärungsmodellen für Krankheit und untersucht insbesondere den Zusammenhang zwischen Kindheitstraumatisierungen und der Entstehung von Krankheiten. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Diathese-Stress-Modell.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einführung: Erklärungsmodelle und ihre Funktion; 2. Definition der Krankheit; 3. Stress und Krankheit; 4. Diathese-Stress-Modelle; und 5. Vom Missbrauch zur Krankheit.
Was wird im Kapitel "Einführung: Erklärungsmodelle und ihre Funktion" behandelt?
Dieses Kapitel erläutert die Notwendigkeit verschiedener Erklärungsmodelle für Krankheit, ihre Funktion als Werkzeuge zur Beschreibung der Realität und die Bedeutung eines bewussten Umgangs mit Modellen.
Wie wird Krankheit im Text definiert?
Das Kapitel "Definition der Krankheit" beleuchtet die komplexe und vielschichtige Definition von Krankheit, die historische Entwicklung des Krankheitsverständnisses und die Schwierigkeiten einer eindeutigen Definition aufgrund medizinischer, psychologischer, juristischer und soziologischer Aspekte.
Welchen Zusammenhang zwischen Stress und Krankheit stellt der Text her?
Kapitel 3, "Stress und Krankheit", untersucht den Zusammenhang zwischen Stress und Krankheit, erläutert den intuitiven Zusammenhang zwischen psychischen und körperlichen Zuständen und untermauert diesen durch empirische Belege.
Was ist das Diathese-Stress-Modell?
Kapitel 4 beschreibt detailliert das Diathese-Stress-Modell (Vulnerabilitäts-Stress-Modell), das die Interaktion zwischen prädisponierenden Faktoren (Diathese) und stressauslösenden Ereignissen als Ursache für die Entstehung von Krankheiten darstellt. Es analysiert den Stress als Bewertungsprozess und die Rolle von Vulnerabilitäten.
Wie werden Kindheitstraumatisierungen im Text behandelt?
Kapitel 5, "Vom Missbrauch zur Krankheit", befasst sich mit den Spätfolgen von schwerwiegenden Kindheitserfahrungen. Es verwendet eine Fallvignette und die ACE-Studie (Adverse Childhood Experiences), um die weitreichenden Folgen von Missbrauch und Vernachlässigung aufzuzeigen. Die Rolle von Risikogenen und Botenstoffen wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind im Text relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Krankheitsmodelle, Diathese-Stress-Modell, Stress, Krankheit, Kindheitstraumatisierung, Psychoneuroimmunologie, Vulnerabilität, Spätfolgen, ACE-Studie, Risikogene, Botenstoffe.
Welche Zielsetzung verfolgt der Text?
Der Text zielt darauf ab, das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Stress, Körper und Krankheit zu vertiefen und verschiedene Erklärungsmodelle von Krankheit, insbesondere das Diathese-Stress-Modell im Kontext von Kindheitstraumatisierungen, zu untersuchen.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit den Themen Krankheitserklärung, Stressforschung und den Folgen von Kindheitstraumatisierungen auseinandersetzt. Er eignet sich für Studenten, Wissenschaftler und Fachleute im Gesundheitswesen.
- Quote paper
- Ewa Budna (Author), 2017, Stress als Krankheitsauslöser. Das Diathese-Stress-Modell bei Traumatisierungen in der Kindheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374709