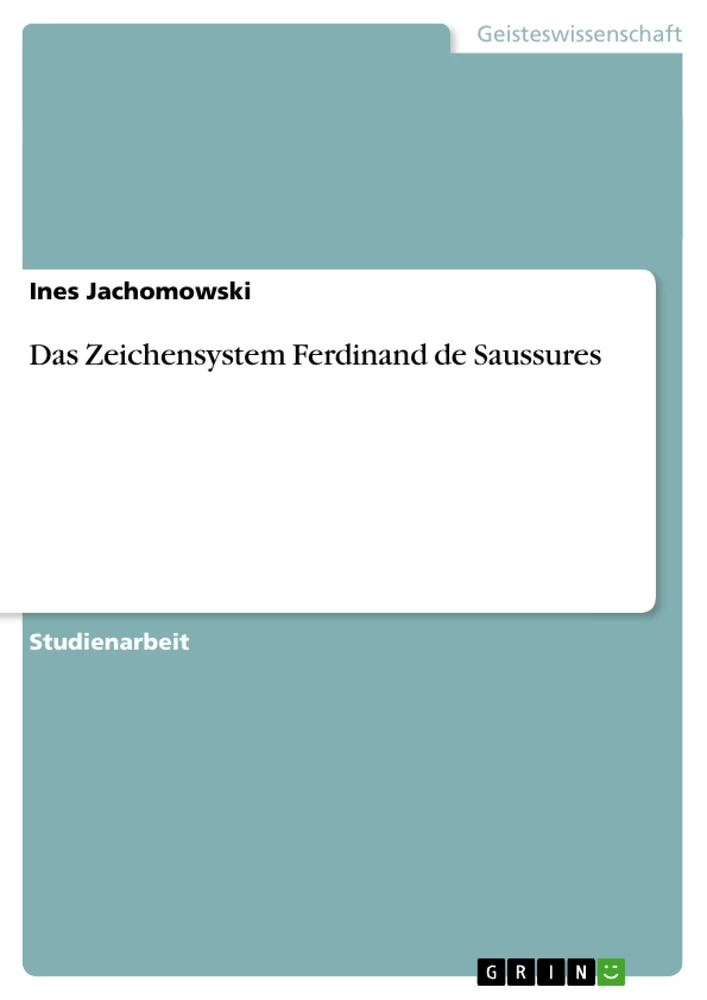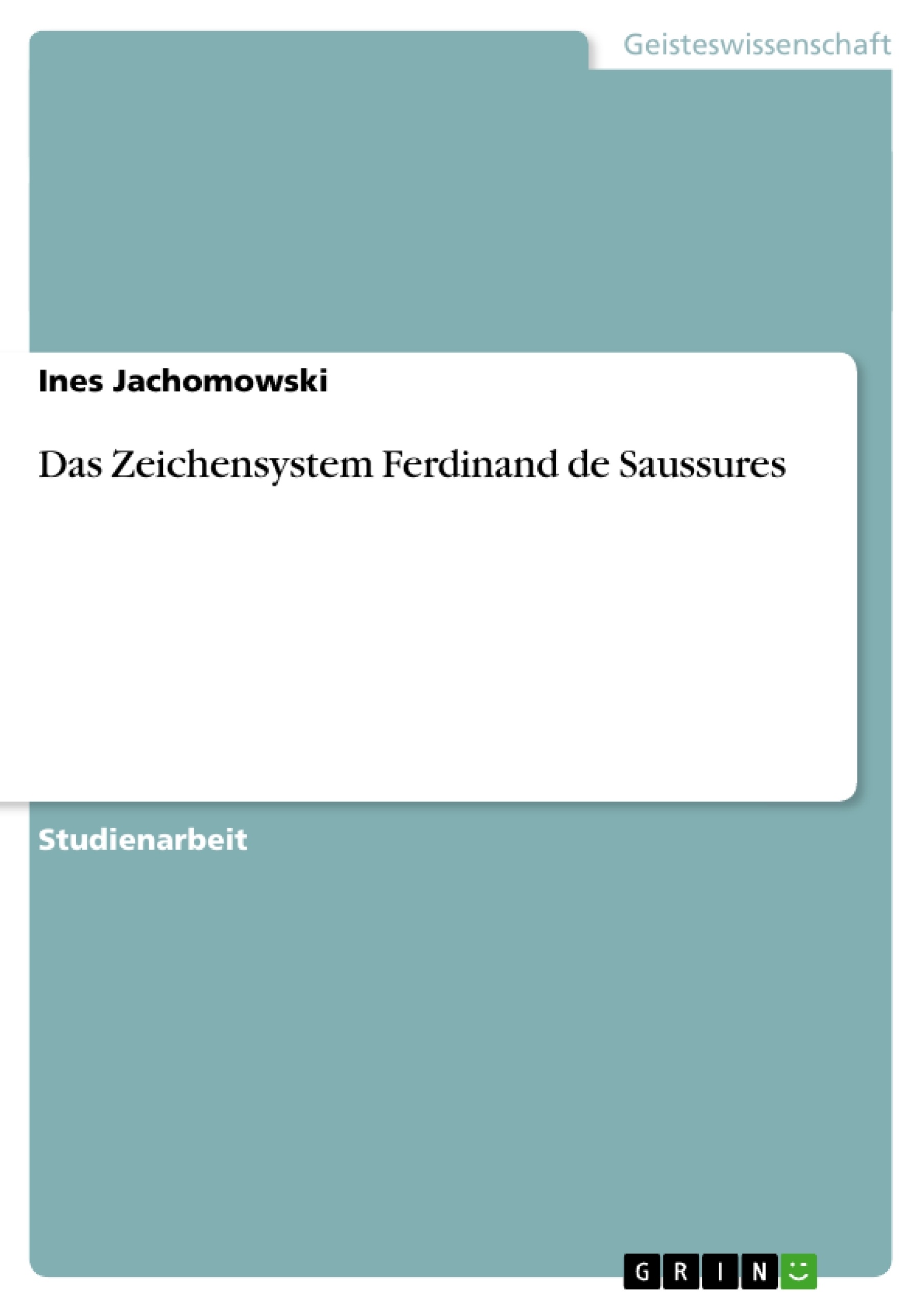Diese Arbeit behandelt die wichtigsten Kategorien der semiotischen Theorie von Ferdinand de Saussure, sowie Kritik an seinem zweiseitigen Zeichenmodell und die logische Weiterentwicklung zum triadischen Zeichenmodell hin, die sich aus dieser Kritik heraus ergab.
Zunächst beschäftigt sie sich mit dem Langue – Parole System der zwei Sprachebenen, um eine Grundlage zu bilden für die Auseinandersetzung mit dem Zeichensystem Saussures. Bei der Beschäftigung mit seinem Zeichenmodell war vor allem die Analyse der Eigenschaften des sprachlichen Zeichens wichtig. In dem letzten Kapitel schließlich wird die Weiterentwicklung des zweiseitigen Zeichenmodelles hin zum triadischen Modell durch Ogden und Richards skizziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zwei Sprachebenen – Langue und Parole
- Sprache als soziale Institution
- Langue vs. Parole
- Das Zeichenmodell
- Formaspekt und inhaltlicher Aspekt
- Die psychische Natur des sprachlichen Zeichens
- Kritik an Saussures Modell
- Eigenschaften des sprachlichen Zeichens
- Bilateralität
- Arbitrarität
- Linearität
- Unveränderlichkeit/Veränderlichkeit
- Weiterentwicklungen des Saussureschen Modells - Das triadische Zeichenmodell am Beispiel von Ogden/Richards
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Kategorien der semiotischen Theorie von Ferdinand de Saussure und analysiert kritisch sein zweiseitiges Zeichenmodell. Darüber hinaus beleuchtet sie die logische Weiterentwicklung zum triadischen Zeichenmodell, die sich aus dieser Kritik heraus ergab.
- Analyse des Langue-Parole-Systems von Ferdinand de Saussure
- Untersuchung der Eigenschaften des sprachlichen Zeichens nach Saussure
- Kritik an Saussures zweiseitigem Zeichenmodell
- Darstellung des triadischen Zeichenmodells von Ogden und Richards
- Veranschaulichung der Bedeutung des Zeichens in Bezug auf außersprachliche Wirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor, die sich mit den zentralen Begriffen der semiotischen Theorie von Ferdinand de Saussure auseinandersetzt. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit dem Langue-Parole-System, dem Saussureschen Zeichenmodell und seiner Kritik sowie der Weiterentwicklung zum triadischen Zeichenmodell beschäftigt.
Zwei Sprachebenen – Langue und Parole
Dieses Kapitel erläutert das Konzept der beiden Sprachebenen Langue und Parole nach Saussure. Es wird betont, dass Sprache als soziale Institution verstanden wird und die Langue den gemeinsamen Zeichenvorrat einer Sprachgemeinschaft repräsentiert. Die Parole hingegen bezeichnet den individuellen Akt des Sprechens.
Sprache als soziale Institution
Hier wird die soziale Dimension von Sprache im Sinne von Saussure erläutert. Langue wird als soziales Faktum (fait social) verstanden, das einen gemeinsamen Zeichenvorrat darstellt, auf dem die individuellen Sprechakte (Parole) basieren.
Langue vs. Parole
Dieser Abschnitt verdeutlicht den Gegensatz und gleichzeitig die Abhängigkeit zwischen Langue und Parole. Saussures Analogie des Papierblattes wird herangezogen, um die wechselseitige Bedingtheit beider Ebenen zu illustrieren.
Das Zeichenmodell
Das Kapitel definiert den Zeichenbegriff nach Saussure. Sein zweiseitiges (dyadisches) Zeichenmodell wird vorgestellt, welches das sprachliche Zeichen aus den beiden Bestandteilen Vorstellung (concept) und Lautbild (image acoustique) zusammensetzt. Die Bedeutung von Formaspekt und inhaltlichem Aspekt des sprachlichen Zeichens wird erläutert.
Formaspekt und inhaltlicher Aspekt
Dieser Abschnitt beschreibt die beiden Bestandteile des sprachlichen Zeichens, die Vorstellung (signifié) als Bezeichnetes und das Lautbild (signifiant) als Bezeichnendes. Es wird darauf hingewiesen, dass die Beziehung zwischen beiden Teilen zwar beliebig ist, aber beide Teile dennoch ein Ganzes bilden.
Die psychische Natur des sprachlichen Zeichens
Hier wird die psychische Natur des sprachlichen Zeichens nach Saussure betont. Das Zeichen ist nicht an einen konkreten Gegenstand gebunden, sondern besteht aus der Vorstellung (concept) von diesem Gegenstand und dem Lautbild (image acoustique). Es wird das Beispiel des Stuhls herangezogen, um die Abstraktheit des Begriffs zu verdeutlichen.
Kritik an Saussures Modell
Dieser Abschnitt beleuchtet die Kritik an Saussures zweiseitigem Zeichenmodell. Es wird darauf hingewiesen, dass das Modell statisch ist und die Bedeutung eines Zeichens nur in der Verwendung durch einen Sprecher, der auf einen außersprachlichen Gegenstand hinweist, erschlossen werden kann. Es wird die Bedeutung des Sprechers und der außersprachlichen Wirklichkeit für die Entstehung von Bedeutung hervorgehoben.
Eigenschaften des sprachlichen Zeichens
Das Kapitel widmet sich den Eigenschaften des sprachlichen Zeichens, die es von anderen Zeichenformen abgrenzen. Es werden die Eigenschaften Bilateralität, Arbitrarität, Linearität und Unveränderlichkeit/Veränderlichkeit erläutert.
Bilateralität
Die Doppelseitigkeit des sprachlichen Zeichens, bestehend aus Vorstellung und Lautbild, wird als eine wesentliche Eigenschaft des Zeichens hervorgehoben.
Arbitrarität
Die Beliebigkeit der Beziehung zwischen Bezeichnetem und Bezeichnenden, die nicht naturgegeben ist, wird als wesentliche Eigenschaft des sprachlichen Zeichens definiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die wichtigsten Kategorien der semiotischen Theorie von Ferdinand de Saussure, insbesondere das Konzept der beiden Sprachebenen Langue und Parole. Es wird sein zweiseitiges Zeichenmodell analysiert und die Kritik daran sowie die Weiterentwicklung zum triadischen Zeichenmodell von Ogden und Richards diskutiert. Die zentralen Themen sind die Eigenschaften des sprachlichen Zeichens, insbesondere Bilateralität und Arbitrarität. Zu den weiteren Schwerpunkten gehören die Bedeutung des Sprechers und die Verbindung des Zeichens zur außersprachlichen Wirklichkeit.
- Quote paper
- Ines Jachomowski (Author), 2003, Das Zeichensystem Ferdinand de Saussures, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37464