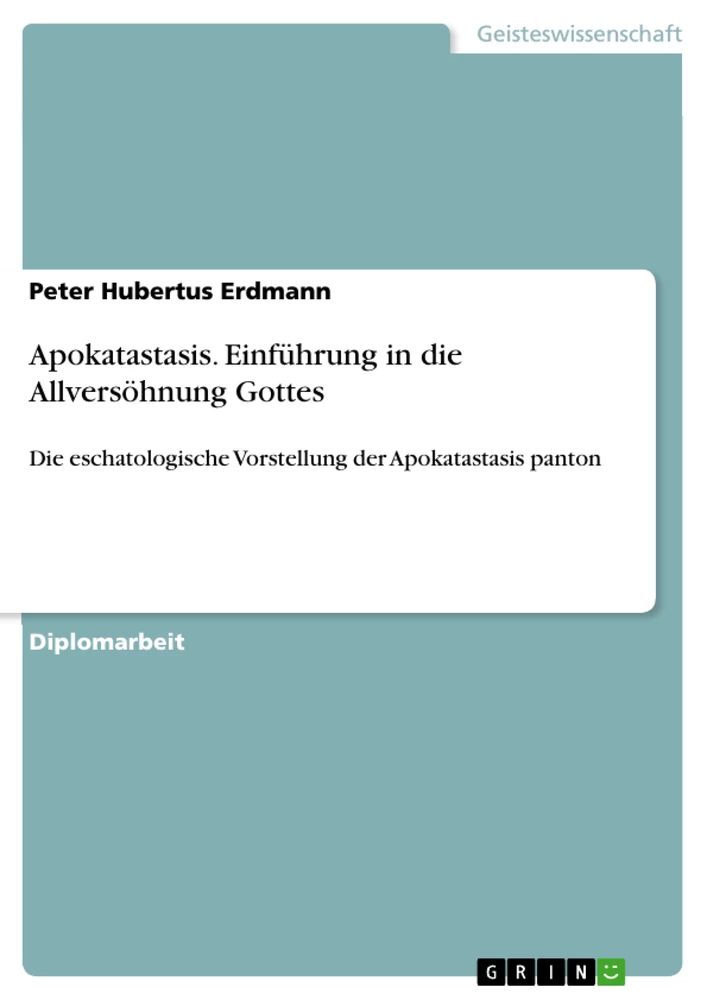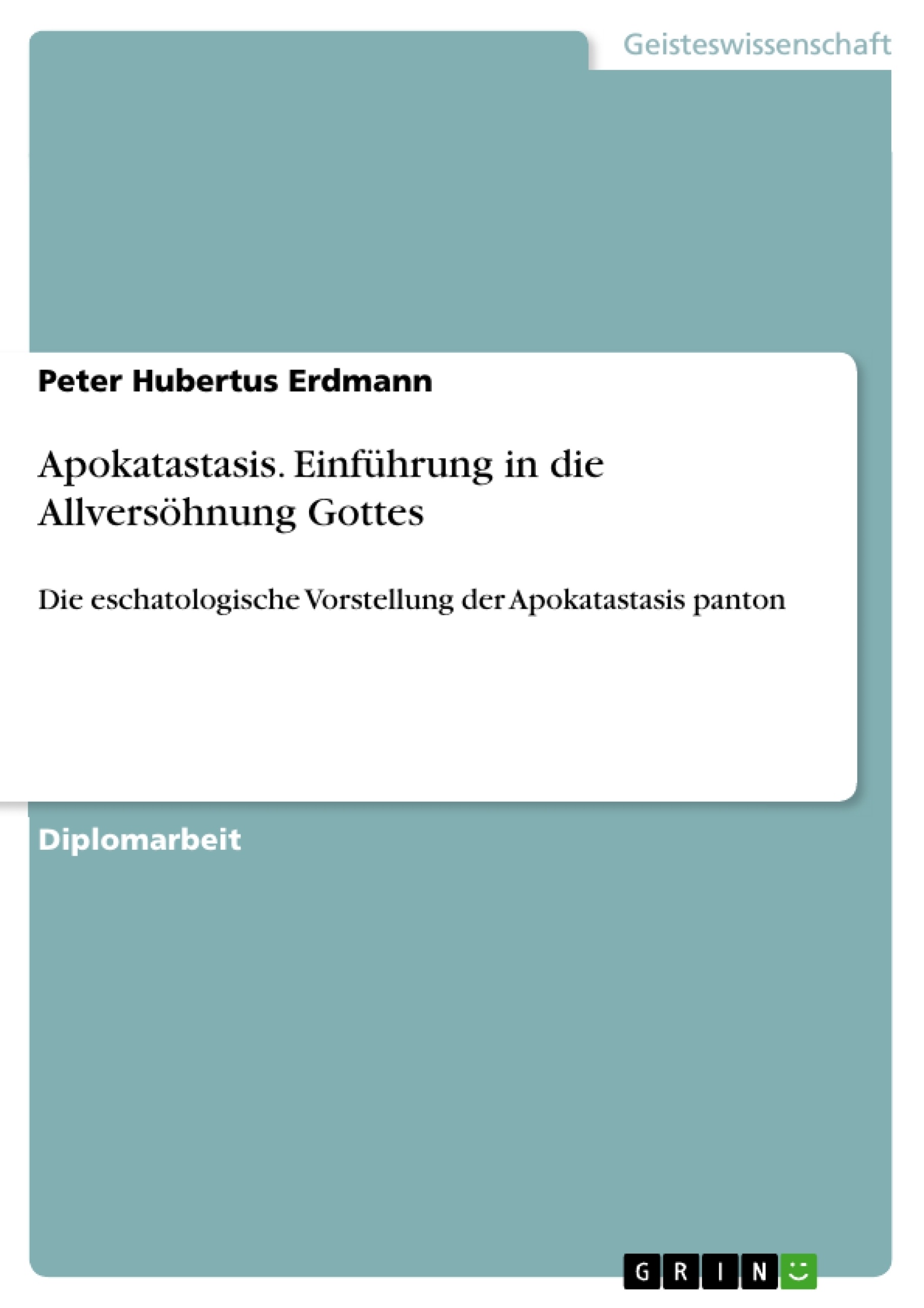Die Aufgabe der vorliegenden Diplomarbeit soll darin bestehen, dem Streit um die eschatologische Vorstellung der Apokatastasis panton nachzugehen und zu einem eigenen Antwortversuch zu gelangen. Muss die Vollendung „zweipolig“ gedacht werden: als Aufteilung der Menschheit in eine Gruppe ewig Glücklicher und in eine andere Gruppe, die auf Grund ihrer Freiheitsentscheidung ewig unglücklich sein wird? Oder gibt es eine übergreifende Perspektive, in der diese Aufteilung noch von einer universalen Hoffnung überholt wird?
Folgt man den Bedingungen für Glaubenswahrheiten im Römischen Katholizismus, so müssen Schrift, Tradition und das Lehramt befragt werden. Aus diesem Grund werden in der Arbeit Teile der Tradition, anschließend der exegetische Befund und schließlich die heutigen lehramtlichen Auffassung Hinzu kommen weitere allgemeine pastorale Argumentationen.
Wie verhält sich die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden und Hoffenden zu all jenen, die nicht glauben und nicht hoffen? Oder anders glauben und hoffen? Oder vielfach die christlichen Gebote gebrochen haben? Können, dürfen Christen diese Unterschiede einfach hinnehmen? Oder gibt es keine Unterschiede zwischen „Nicht-Christen“ und „Christen“? Sind die „Glaubenden“ und „Nicht-Glaubenden“ in einen Zukunftsplan Gottes integriert und bietet sich ihnen eine gemeinsame Perspektive?
Grundsätzlich müssen alle Religionen, die Erlösung versprechen, die Frage beantworten, wer in den Genuss ihrer Verheißungen kommt und wer von ihnen ausgeschlossen wird. Für die einen ist Erlösung an die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk oder Stand gebunden, andere schließen einzelne Geschlechter oder Berufe aus, fast alle verlangen die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, ethischer Qualifikationen, Gesetzesbefolgung oder Tugendübungen.
Eine von diesen Voraussetzungen losgelöste Alternative bietet die altkirchliche Vorstellung der Allversöhnung (griech. Apokatastasis panton). Deren Hauptaussage ist, dass nichts und niemand letzten Endes von Gottes Heil ausgeschlossen bleibe. Dies erscheint für die Allversöhner seit jeher als Konsequenz der Universalität der Erlösung, die Jesus Christus nicht nur seinen Getreuen, sondern „für alle“ gebracht habe.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1. Problemaufriss
- I.2. Begriffsdefinition
- I.3. Der biblische Ursprung
- II. Origenes
- II.1. Sein Umfeld - Altkirchliche Glaubensbekenntnisse
- II.2. Sein Lehrer Clemens von Alexandria
- II.3. Origenes und das Ziel der Schöpfung
- II.4. Origenes und der Prozess hin zum Ziel
- II.5. Seine exegetischen Methoden
- II.6. Seine Gegner - Augustinus
- III. Der exegetische Befund
- III.1. Biblische Stellen contra Allversöhnung am Beispiel von Mt 25, 31-46
- III.2. Die exegetische Sicht der Allversöhner
- III.3. Exkurs: Das Zweite Testament
- III.4. Zusammenfassung des exegetischen Befundes
- IV. Pastorale Gründe
- IV.1. Einleitung
- IV.2. Die Anzweifelung der Sinnhaftigkeit einer ewigen Hölle
- IV.3. Der Sinn einer extensiv-durativ ewigen Strafe
- IV.4. Absolute Straftheorien
- IV.5. Relative Straftheorien
- IV.6. Fazit zu den Straftheorien: Das Gottesbild
- IV.7. Argumente pro Gericht
- IV.8. Probleme der Gerichtsrede
- IV.9. Argumente contra klassisches Gericht: Überwindung des Dualismus
- IV.10. Problem der Unversöhnbarkeit der Menschen?
- V. Die Position des Römisch- Katholischen Lehramtes
- V.1. Einleitung
- V.2. Das Zweite Vatikanum
- V.3. Die Uneindeutigkeit des Zweiten Vatikanums
- V.4. Katholische Kirche heute
- V.5. Papst Benedikt XVI
- V.6. Die lehramtliche Verurteilung
- V.7. Exkurs: Einige evangelische Stimmen
- V.8. Fazit: Die Eschatologie in der heutigen Dogmatik
- VI. Gesamtfazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Vorstellung der Allversöhnung und untersucht deren biblische, theologische und pastorale Implikationen. Sie verfolgt das Ziel, ein grundlegendes Verständnis dieser eschatologischen Vorstellung zu vermitteln und ihre Relevanz für die heutige Kirche zu beleuchten.
- Der biblische Ursprung der Allversöhnung
- Die Position Origenes' und seine exegetischen Methoden
- Die Kritik an der Allversöhnung im Kontext der biblischen Exegese
- Die pastorale Relevanz der Allversöhnung
- Die Haltung des römisch-katholischen Lehramtes zur Allversöhnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Allversöhnung vor und erläutert die Begriffsdefinition sowie deren biblischen Ursprung. Kapitel II widmet sich Origenes, einem der prominentesten Vertreter der Allversöhnung in der Kirchengeschichte. Hier werden sein Umfeld, seine Lehrer und seine exegetischen Methoden beleuchtet.
Kapitel III untersucht den exegetischen Befund zur Allversöhnung, wobei die relevanten biblischen Stellen und die jeweiligen Argumentationslinien der Befürworter und Gegner der Allversöhnung dargelegt werden.
In Kapitel IV werden pastorale Gründe für und gegen die Allversöhnung diskutiert, wobei verschiedene Straftheorien und deren Kritikpunkte beleuchtet werden.
Kapitel V schließlich beschäftigt sich mit der Haltung des römisch-katholischen Lehramtes zur Allversöhnung und beleuchtet die Relevanz der Thematik in der heutigen Dogmatik.
Schlüsselwörter
Allversöhnung, Apokatastasis panton, Origenes, Eschatologie, biblische Exegese, pastorale Theologie, römisch-katholisches Lehramt, Gottesbild, Gericht, Heil, Erlösung.
- Citar trabajo
- Peter Hubertus Erdmann (Autor), 2009, Apokatastasis. Einführung in die Allversöhnung Gottes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374499