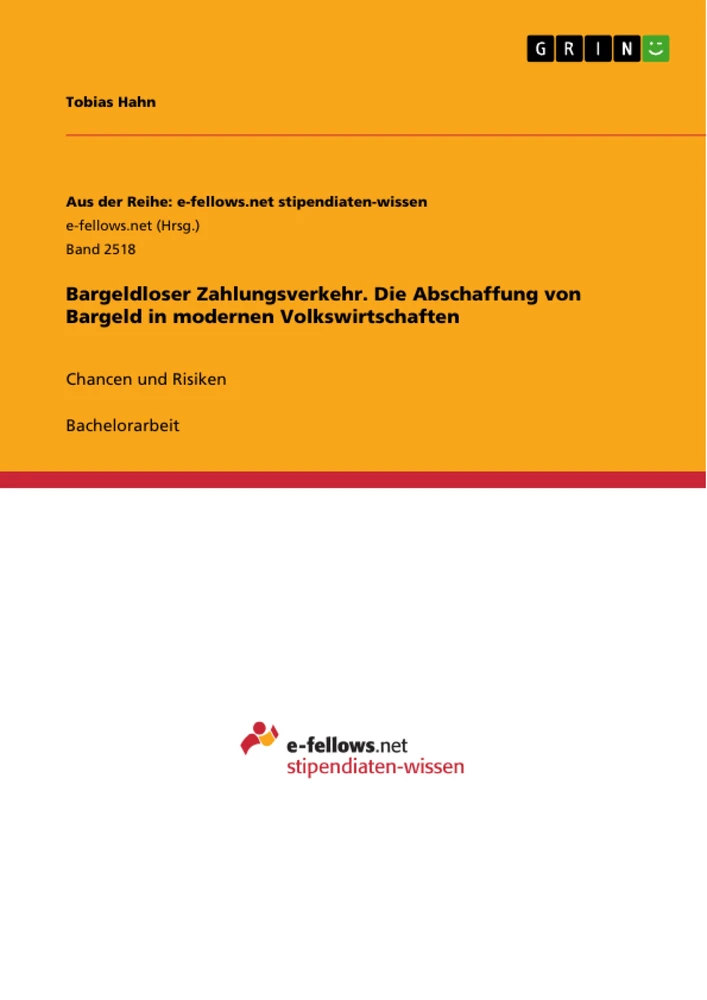Diese Arbeit setzt sich mit den Chancen und Risiken eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs in modernen Volkswirtschaften auseinander. In der breiten Öffentlichkeit werden als Argumente fast ausschließlich die politischen Gründe der Kriminalitätsbekämpfung genannt. Jedoch existieren weit mehr Motive, Bargeld abzuschaffen. Zugleich gibt es negative Aspekte, die mit einer Bargeldabschaffung einhergehen. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Thema ist notwendig, da eine Bargeldabschaffung weit mehr Folgen hat, als die Politik meist vorgibt. Gerade vor dem Hintergrund innovativer Zahlungsinstrumente, welche die Möglichkeiten an elektronischen Zahlungen erweitern, ist es notwendig, die Vor- und Nachteile eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs zu analysieren.
Mit der Verkündung der Europäischen Zentralbank, die Herstellung und Ausgabe der 500-Euro-Banknote gegen Ende des Jahres 2018 dauerhaft einzustellen, ist die Diskussion um eine mögliche Abschaffung von Bargeld endgültig in der Euro-Zone angekommen. Das Bundesministerium der Finanzen hat in einem seiner Monatsberichte eine gesetzliche Begrenzung von Bargeldzahlungen empfohlen, mit der Begründung, das Risiko der Geldwäsche zu minimieren. Diesbezüglich wurde bereits ein Prüfauftrag des Finanzministerrats der EU an die EU-Kommission erteilt, ob ein EU-weit einheitlicher Höchstbetrag für Bargeldzahlungen notwendig ist. Kritiker der Beschränkungen von Bargeldzahlungen sehen dies bereits als den Beginn einer vollständigen Bargeldabschaffung im Euro-Währungsraum an.
Ein verändertes Kauf- und Zahlungsverhalten befeuert die Forderungen nach einer Bargeldabschaffung. Der technologische Fortschritt der jüngsten Zeit hat diverse Zahlungsinnovationen hervorgebracht. Große Internetkonzerne, wie Apple, Google, Amazon, Facebook oder Paypal, wollen den privaten Zahlungsverkehr der Zukunft bestimmen. Deren Ziel ist es, bestehende Zahlungsmittel durch mobile Zahlungssysteme, die das Bezahlen per Smartphone ermöglichen, zu ersetzen. Doch nicht nur innovative Zahlungsdienstleister, Banken oder Politiker treten für eine Bargeldabschaffung ein. Auch Ökonomen, wie Peter Bofinger, Kenneth Rogoff oder Larry Summers appellieren an die Regierungen westlicher Industrienationen, das Bargeld abzuschaffen. Neben dem oft angeführten Argument der Bekämpfung von Kriminalität und Drogenhandel bringen die Ökonomen auch andere Gründe hervor, wie z. B. Vereinfachungen im Zahlungsverkehr sowie eine noch effektivere expansive Geldpolitik.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Geldtheoretische Grundlagen
- 2.1 Funktionen des Geldes
- 2.2 Bargeld und Giralgeld
- 2.3 Geldschöpfungsprozess
- 2.4 Die Theorie der Zentralbanken
- 2.5 Der Transmissionsmechanismus einer geldpolitischen Maßnahme
- 2.6 Bargeldlose Zahlungsmittel und Bargeldnutzung im internationalen Vergleich
- 3. Chancen eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs
- 3.1 Kostensenkungspotenzial
- 3.2 Bekämpfung der Schattenwirtschaft und des illegalen Zahlungsverkehrs
- 3.3 Reduzierung des Risikos eines Bankensturms
- 3.4 Realisierung negativer Zinsen als geldpolitisches Instrument
- 4. Risiken eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs
- 4.1 Pain of Paying
- 4.2 Arme und alte Menschen als Leidtragende
- 4.3 Alternative Zahlungsmittel als unzureichendes Substitut für Bargeld
- 4.4 Bargeldabschaffung als Eingriff in die freiheitliche Grundordnung
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Chancen und Risiken die Abschaffung von Bargeld in modernen Volkswirtschaften mit sich bringt. Im Fokus steht dabei die Analyse des bargeldlosen Zahlungsverkehrs, die Auswirkungen auf die Geldpolitik und die potenziellen Folgen für verschiedene Bevölkerungsgruppen.
- Die Funktionen des Geldes und die Unterschiede zwischen Bargeld und Giralgeld
- Der Geldschöpfungsprozess und die Rolle der Zentralbanken
- Die Vorteile eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs, wie Kostensenkung, Bekämpfung der Schattenwirtschaft und Realisierung negativer Zinsen
- Die potenziellen Risiken eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs, wie der „Pain of Paying“, die Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen und die Einschränkung der individuellen Freiheit
- Die Bedeutung von Bargeld als Ausdruck der Freiheit und die Notwendigkeit einer ausgewogenen Balance zwischen Bargeld und digitalen Zahlungsmitteln
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit definiert. Anschließend werden die geldtheoretischen Grundlagen beleuchtet, einschließlich der Funktionen des Geldes, der Unterschiede zwischen Bargeld und Giralgeld sowie des Geldschöpfungsprozesses.
Im dritten Kapitel werden die Chancen eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs beleuchtet, wie Kostensenkungspotenziale, Bekämpfung der Schattenwirtschaft, Reduzierung des Bankensturmrisikos und die Möglichkeit der Realisierung negativer Zinsen.
Das vierte Kapitel widmet sich den Risiken eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs, darunter der „Pain of Paying“, die potenzielle Benachteiligung armer und älterer Menschen, die unzureichende Substituierbarkeit von Bargeld durch alternative Zahlungsmittel und die potenzielle Einschränkung der individuellen Freiheit durch eine Bargeldabschaffung.
Schlüsselwörter
Bargeld, bargeldloser Zahlungsverkehr, Geldpolitik, Zentralbanken, Schattenwirtschaft, Kosten, Risiken, Freiheit, Pain of Paying, Benachteiligung, alternative Zahlungsmittel, digitale Währungen.
- Quote paper
- Tobias Hahn (Author), 2017, Bargeldloser Zahlungsverkehr. Die Abschaffung von Bargeld in modernen Volkswirtschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374489