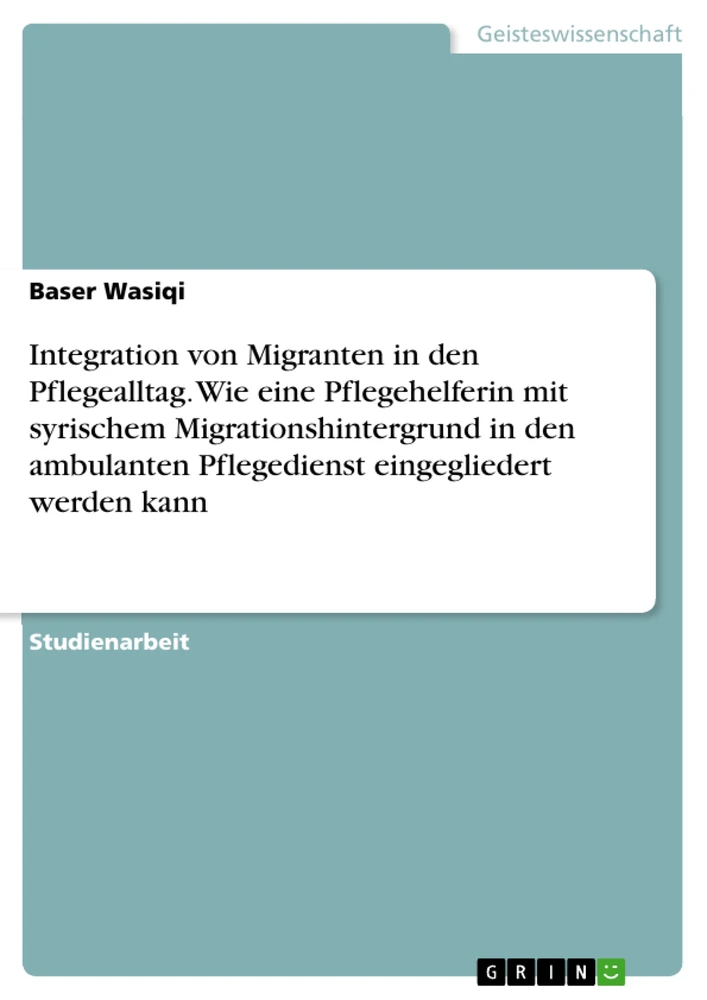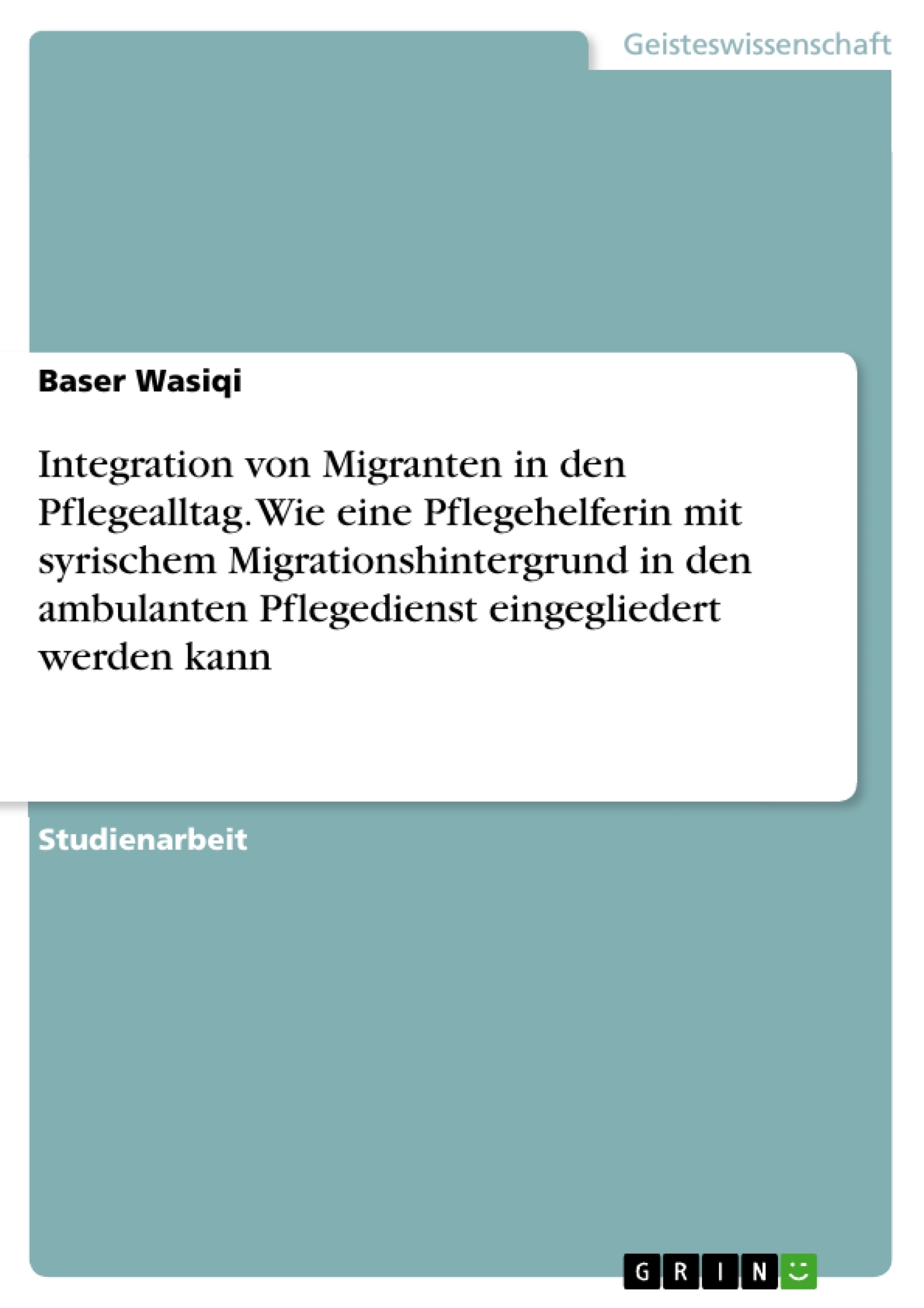In dieser Arbeit wird versucht zu skizzieren, wie es gelingen kann, Migranten in die Pflege zu integrieren, sowohl als Pflegekräfte als auch als zu Behandelnde. Dabei dient als Beispiel ein ambulanter Pflegedienst und eine Pflegekraft syrischer Herkunft. Diskutiert werden fachliche und rechtliche Aspekte; verschiedene konkrete Maßnahmen werden als Vorschläge gegeben.
Die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland werden immer älter und leben deutlich länger als die Bevölkerung vorangegangener Generationen. Dieser Anstieg von Menschen im höheren Alter lässt auch den Pflegebedarf ansteigen.
Gleichzeitig wird auch für die Gruppe der älteren Migranten in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Pflegebedarf gerechnet. Der erwartete höhere Pflegebedarf wird zum einen mit der rein demographisch bedingten Zunahme der Menschen in dieser Gruppe und zum anderen mit den gesundheitlichen Belastungen, die diese Gruppe in ihrem Arbeitsleben ausgesetzt war, begründet. Die Vorstellungen der älteren Migranten über ihre pflegerische Versorgung im Alter unterscheiden sich nur unwesentlich von den Vorstellungen älterer Menschen ohne Migrationshintergrund. Ältere Menschen mit Migrationshintergrund erwarten überwiegend Hilfe von ihren Verwandten und Kindern. Es ist aber zunehmend zu beobachten, dass nicht alle älteren Migranten Verwandte in Deutschland haben, die diese Aufgabe übernehmen können und auch wollen. Insgesamt sind ambulante und stationäre Angebote der Pflege bei älteren Migranten wenig bekannt. Gründe hierfür sind vor allem Sprachprobleme, Vorbehalte gegenüber Pflegeinstitutionen, das Vertrauen auf Pflege durch Kinder und Verwandte, die Unübersichtlichkeit des Pflegesystems sowie das Aufschieben einer möglichen Rückkehroption.
Die Migration wirkt dabei beidseitig: Einerseits beeinflusst die Migration die Gruppe der Pflegebedürftigen, andererseits ist es auch im Pflegesektor, insbesondere beim Pflegepersonal mit teilweise erheblichen Veränderungen verbunden. Bei der Beurteilung des Personals ist der Parameter „mit Migrationshintergrund“ sicherlich der sinnvollste, denn er ist denkbar weit gefasst und berücksichtigt sämtliche Merkmale, wie zum Beispiel die Muttersprache, den Geburtsort, die Ethnie und kulturelle Eigenschaften der Person. Etwa zwei Drittel der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ist im Ausland geboren und selbst nach Deutschland migriert. Sie haben mithin die Einwanderung in ein fremdes Land persönlich erfahren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Einführung
- 1.2. Das Unternehmen
- 1.3. Die Pflegekraft - F
- 1.4. Begründung der Themenwahl
- 2. Theorie
- 2.1. Fachliche Aspekte
- 2.2. Rechtliche Aspekte - Drittstaatsangehörigkeit
- 2.3. Anerkennung ausländischer Abschlüsse
- 3. Beispiel
- 3.1. Beispiel aus der Praxis
- 3.2. Ausgangssituation
- 3.3. Ressourcen
- 3.4. Was kann F?
- 4. Was muss F lernen? Ziel
- 5. Maßnahmenplan
- 5.1. Konkrete Maßnahmen (Beispiele)
- 1. Ruhiger sprechen...
- 5.2. Gemeinsame Lösungsfindung
- 5.3. Nonverbale Kommunikation
- 5.4. Zuhören
- 6. Ergebnis
- 7. Fazit
- 7.1. Was habe ich gelernt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Integration von Pflegekräften mit Migrationshintergrund in den ambulanten Pflegedienst. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen aufzuzeigen, die mit der Einstellung einer Pflegekraft mit syrischem Migrationshintergrund verbunden sind. Dabei wird die spezifische Situation der Pflegekraft F beleuchtet und ein Maßnahmenplan zur erfolgreichen Integration erarbeitet.
- Der Fachkräftemangel im deutschen Pflegesektor
- Die Bedeutung der Integration von Pflegekräften mit Migrationshintergrund
- Herausforderungen und Chancen der interkulturellen Zusammenarbeit in der Pflege
- Entwicklung eines Maßnahmenplans zur erfolgreichen Integration einer Pflegekraft mit Migrationshintergrund
- Die Rolle der interkulturellen Kompetenz im ambulanten Pflegedienst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Bedarf an Pflegekräften im deutschen Pflegesektor dar und beleuchtet die Herausforderungen, die durch den demografischen Wandel entstehen. Die wachsende Zahl von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland wird dabei als Chance zur Rekrutierung neuer Pflegekräfte beschrieben.
Im Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen der Integration von Pflegekräften mit Migrationshintergrund beleuchtet. Neben fachlichen Aspekten werden auch rechtliche Rahmenbedingungen im Bezug auf Drittstaatsangehörigkeit und die Anerkennung ausländischer Abschlüsse betrachtet.
Im Kapitel 3 wird ein Praxisbeispiel vorgestellt, das die Situation der Pflegekraft F mit syrischem Migrationshintergrund im ambulanten Pflegedienst beleuchtet. Die Ausgangssituation und die Ressourcen von F werden analysiert, um ihre Stärken und Schwächen zu erkennen.
Kapitel 4 definiert das Ziel, die Integrationsmaßnahmen für F zu entwickeln, um ihre Kompetenzen zu erweitern und sie erfolgreich im Pflegedienst einzusetzen.
Kapitel 5 stellt einen detaillierten Maßnahmenplan zur Integration von F vor. Konkrete Maßnahmen, wie z. B. ruhiges Sprechen, gemeinsame Lösungsfindung, nonverbale Kommunikation und Zuhören, werden vorgestellt, um F in die Arbeitswelt des ambulanten Pflegedienstes einzuführen.
Schlüsselwörter
Pflege, Migration, Integration, interkulturelle Kompetenz, ambulante Pflege, Drittstaatsangehörigkeit, Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Fachkräftemangel, Demografischer Wandel, Maßnahmenplan, interkulturelle Kommunikation
- Quote paper
- Baser Wasiqi (Author), 2017, Integration von Migranten in den Pflegealltag. Wie eine Pflegehelferin mit syrischem Migrationshintergrund in den ambulanten Pflegedienst eingegliedert werden kann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/374435