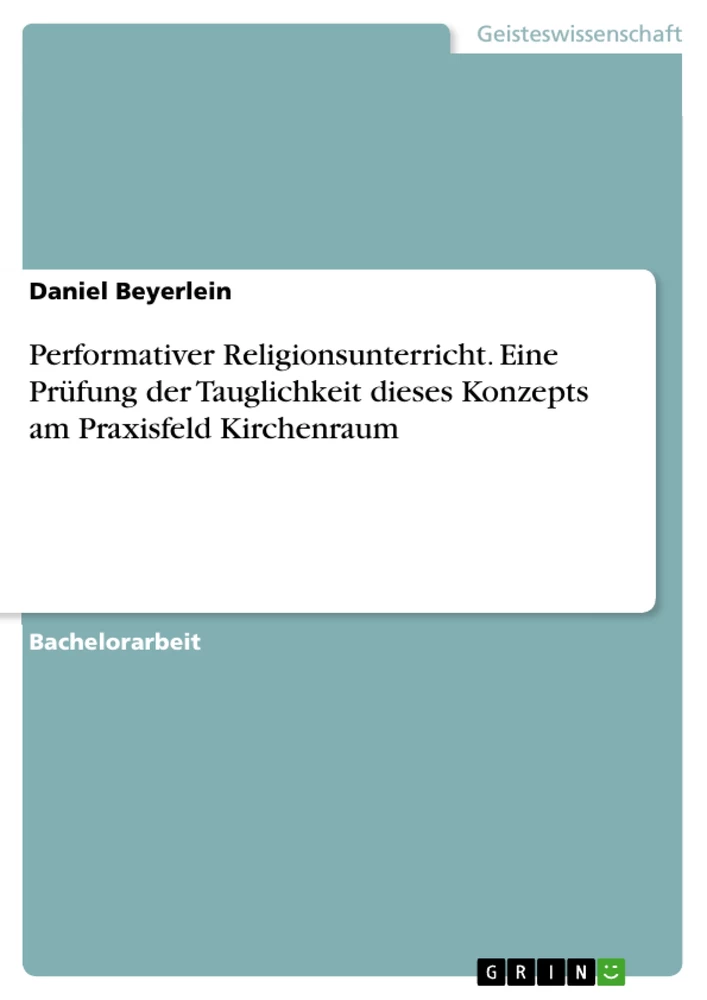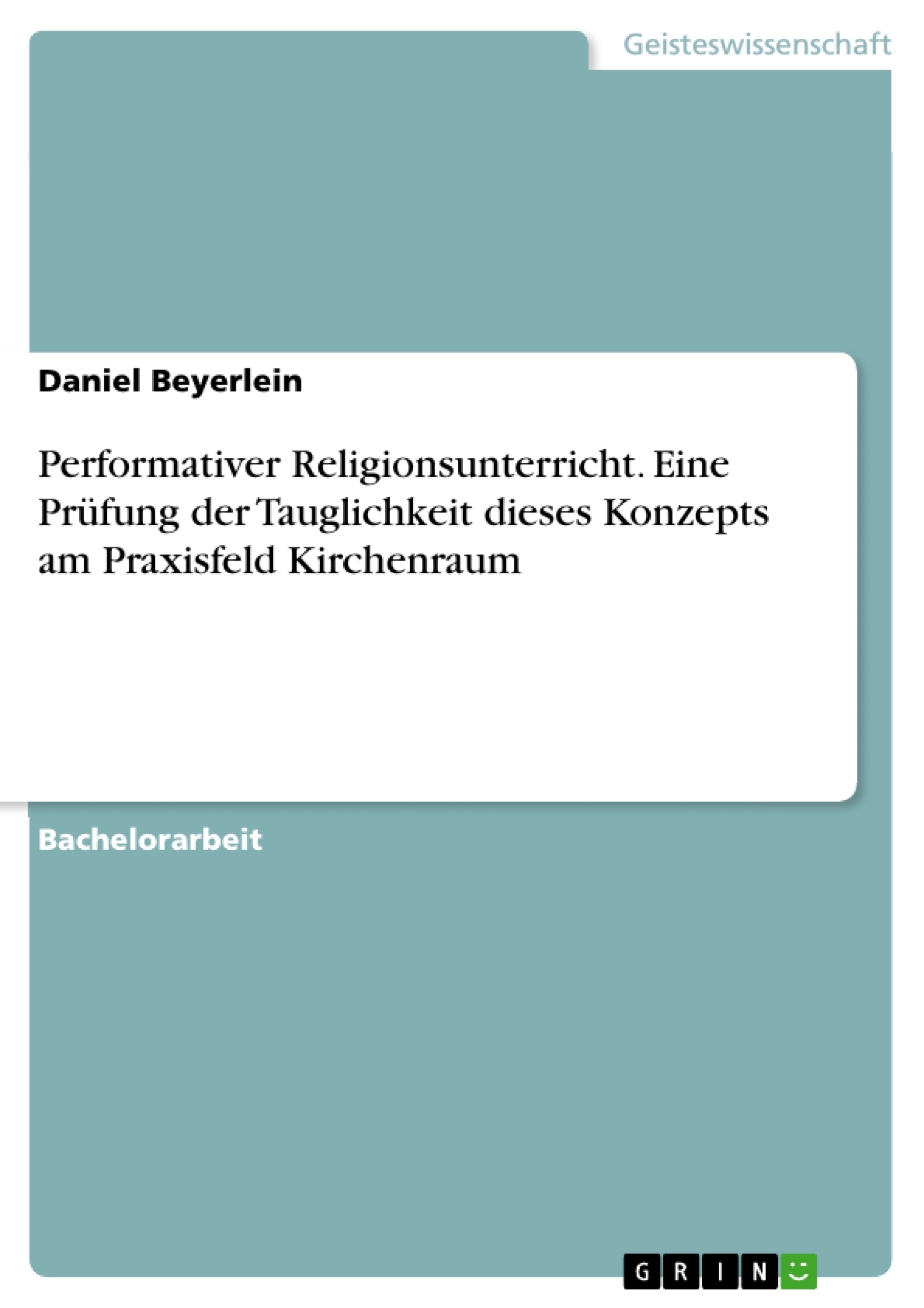Das Bestreben dieser Arbeit liegt darin, das Konzept des performativen Religionsunterrichts auf seine Tauglichkeit hin zu überprüfen, unterstrichen durch einen praktisch ausgeführten Unterrichtsversuch an dem konkreten Handlungsfeld Kirchenraum. In diesem soll Religion für die Schülerinnen und Schüler erlebbar werden, gemäß auch der Verlautbarung des Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz 2005 und der darin enthaltenen Textpassage: „Der Religionsunterricht macht mit Formen gelebten Glaubens vertraut und ermöglicht Erfahrungen mit Glaube und Kirche“. Allerdings ist es unabdingbar zur Umsetzung dieses Vorhabens, gleichermaßen zur Klärung nachfolgender Kontroversen, vorerst eine begriffliche Klärung zu vollziehen, was unter performativen Religionsunterricht verstanden werden kann.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Zum Terminus Performativen Religionsunterrichts.
- 2.1 Performativität…............
- 2.2 Performance..\n
- 2.3 Die Polstellung von Performativität und Performance
- 3. Begründungsmomente für einen performativen Religionsunterricht
- 3.1 Entwicklungslinien............
- 3.2 Wandel der religiösen Situation von Schülerinnen und Schüler..........\n
- 3.3 Der Drang nach Teilhabe .........
- 3.4 Die Notwendigkeit der Darstellung..\n
- 4. Erfahrungen
- 4.1 Zum Terminus der Erfahrung
- 4.2 Der Nutzwert von Erfahrung......
- 4.3 Das,,Nutzbarermachen“ von Erfahrungen.......
- 5. Anforderungen an die Lehrkraft im performativen Religionsunterricht
- 5.1 Beheimatung in der eigenen Religion
- 5.2 Ambiguitätstoleranz
- 5.3 Spiritualität und liturgische Kompetenz
- 5.4 Die Beziehungsfähigkeit.………………………..\n
- 6. Kritische Sichtweisen ......
- 7. Performative Religionsdidaktik am Handlungsfeld Kirchenraum
- 7.1 Kirchenraum – Ort gelebten Glaubens.........
- 7.1.1 Annäherung an das Heilige.\n
- 7.1.2 Darstellung und Begegnung des Heiligen\n
- 7.1.3 Das Heilige reflektieren.\n
- 7.2 Prinzipien der Kirchenraumpädagogik...........
- 8. Vom Kirchenraum zum Erfahrungsraum – eine praktische Umsetzung.
- 8.1 Rahmenbedingungen.…………………………….\n
- 8.2 Organisatorische Maßnahmen.....
- 8.3 Konzeption der Kirchenraumerkundung im Sinne des performativen\nReligionsunterrichts
- 8.3.1 Die Phase der Annäherung....
- 8.3.2 Die Phase der Darstellung ..
- 8.3.3 Die Phase der Reflexion
- 9. Durchführung der Untersuchung.
- 10. Darstellung der Ergebnisse......
- 10.1 Begründungsmomente
- 10.2 Lehrerkompetenzen.....
- 10.3 Erfahrungs- und Urteilsbildung..\n
- 10.4 Kritik....\n
- 11. Würdigung......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept des performativen Religionsunterrichts und dessen Tauglichkeit im Praxisfeld Kirchenraum. Die zentrale Zielsetzung besteht darin, die Konzeption des performativen Religionsunterrichts im Kontext der aktuellen religiösen Situation von Schülerinnen und Schülern zu beleuchten und seine Potenziale für die Vermittlung von religiösen Erfahrungen zu untersuchen. Dabei wird insbesondere auf die Notwendigkeit der Darstellung und Begegnung mit dem Heiligen im Kirchenraum eingegangen.
- Performativer Religionsunterricht als pädagogischer Ansatz
- Der Kirchenraum als Handlungsfeld für Religionsunterricht
- Das Erlebnis von Religiosität und die Bedeutung von Erfahrungen
- Die Rolle der Lehrkraft im performativen Religionsunterricht
- Kritische Betrachtung des Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Problematik des performativen Religionsunterrichts ein und beleuchtet die Bedeutung von religiösen Erfahrungen in Zeiten des "Traditionsabbruchs". Kapitel 2 widmet sich der begrifflichen Klärung des Terminus "performativer Religionsunterricht" und betrachtet dabei die beiden Pole der Performance und der Performativität. Kapitel 3 beleuchtet die Begründungsmomente für einen performativen Religionsunterricht, wobei Entwicklungen in der Religionspädagogik, der Wandel der religiösen Situation von Schülerinnen und Schülern, der Drang nach Teilhabe sowie die Notwendigkeit der Darstellung im Vordergrund stehen.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Konzept der Erfahrung, wobei der Terminus der Erfahrung, der Nutzwert von Erfahrung und das "Nutzbarermachen" von Erfahrungen im Detail erläutert werden. Kapitel 5 geht auf die Anforderungen an die Lehrkraft im performativen Religionsunterricht ein. Hier werden Themen wie die Beheimatung in der eigenen Religion, Ambiguitätstoleranz, Spiritualität, liturgische Kompetenz und die Beziehungsfähigkeit behandelt.
Kapitel 6 befasst sich mit kritischen Sichtweisen auf den performativen Religionsunterricht. In Kapitel 7 wird der performative Religionsunterricht im Handlungsfeld Kirchenraum betrachtet. Dabei wird der Kirchenraum als Ort gelebten Glaubens, die Annäherung an das Heilige, die Darstellung und Begegnung des Heiligen sowie die Reflexion des Heiligen beleuchtet.
Kapitel 8 widmet sich der praktischen Umsetzung eines performativen Religionsunterrichts im Kirchenraum. Hier werden Rahmenbedingungen, organisatorische Maßnahmen und die Konzeption der Kirchenraumerkundung im Sinne des performativen Religionsunterrichts vorgestellt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Performativer Religionsunterricht, Kirchenraum, religiöse Erfahrungen, religiöse Bildung, Erfahrung, Performance, Performativität, Handlungsfeld, Lehrerkompetenz, Beheimatung, Ambiguitätstoleranz, Spiritualität, liturgische Kompetenz, Beziehungsfähigkeit, Kritik.
- Quote paper
- Daniel Beyerlein (Author), 2015, Performativer Religionsunterricht. Eine Prüfung der Tauglichkeit dieses Konzepts am Praxisfeld Kirchenraum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373923