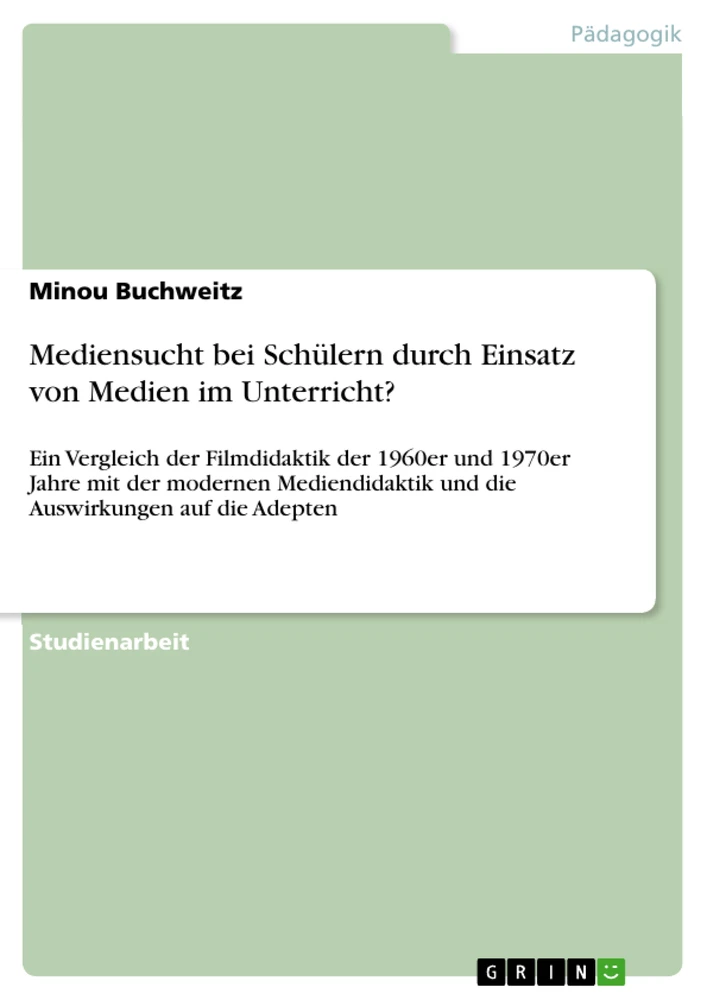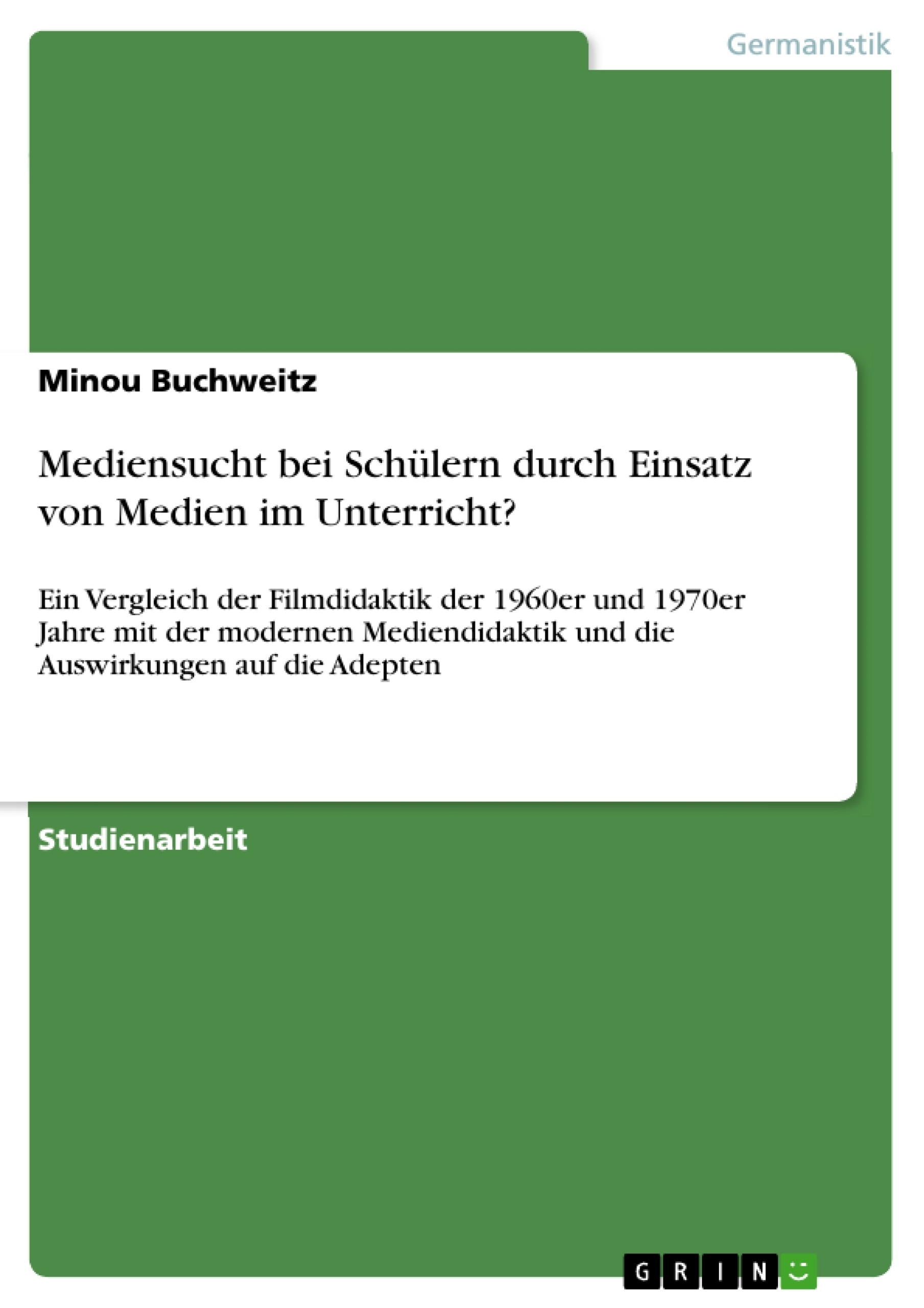Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob der Einsatz von Medien im Un- terricht die Mediensucht bei Schülern fördert oder bedingt. Dazu wird die Filmdidaktik der 1960er-Jahre der modernen Mediendidaktik gegenübergestellt, um Gemeinsamkei- ten und Unterschiede dieser Methoden zu verdeutlichen. Diese dienen als Basis für po- tenzielle Lösungsansätze für einen differenzierteren und modifiziert effizienteren Ein- satz von Medien im Unterricht, die in dieser Arbeit nachfolgend beschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Filmdidaktik und -ästhetik der 1960er-/1970er-Jahre
- 2.1 Der Farbfilm als technische Neuheit der 1960er-Jahre
- 2.2 Der Film als Novum im Deutschunterricht
- 2.3 Effekte der Filmdidaktik im Deutschunterricht
- 3. Moderne Mediendidaktik
- 3.1 Moderne Medien - Definition
- 3.2 Moderne Medien im Deutschunterricht: Omnipräsent = omnipotent?
- 3.3 Effekte moderner Mediendidaktik
- 4. Vergleich Filmdidaktik und moderne Mediendidaktik im Deutschunterricht
- 5. Medienkompetenz
- 6. Die Zukunft moderner Mediendidaktik – Ausblick
- 6.1 Das virtuelle Klassenzimmer – Definition
- 6.2 Effekte der Digitalisierung – Mediensucht
- 7. Fazit/Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Medien im Unterricht auf die Entstehung von Mediensucht bei Schülern. Durch einen Vergleich der Filmdidaktik der 1960er/70er Jahre mit der modernen Mediendidaktik werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt und mögliche Ansätze für einen effektiveren Medieneinsatz entwickelt.
- Vergleich der Filmdidaktik der 1960er/70er Jahre und der modernen Mediendidaktik.
- Analyse der Auswirkungen verschiedener didaktischer Ansätze auf Schüler.
- Die Rolle der Medienkompetenz im Umgang mit Medien im Unterricht.
- Der Einfluss der Digitalisierung auf den Unterricht und das Phänomen der Mediensucht.
- Entwicklung von Lösungsansätzen für einen differenzierten und effizienten Medieneinsatz.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Medieneinsatz im Unterricht und Mediensucht bei Schülern. Sie vergleicht die Filmdidaktik der 1960er/70er Jahre mit der modernen Mediendidaktik, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und daraus Lösungsansätze für einen effektiveren Medieneinsatz abzuleiten. Der Begriff "Medien" wird als Sammelbegriff für audiovisuelle Kommunikationsmittel definiert und die "Digital Natives" als Generation, die mit diesen Technologien aufgewachsen ist, eingeführt. Die Omnipräsenz moderner Medien und das Phänomen der Mediensucht werden als zentrale Aspekte thematisiert, wobei die "Orientierungsreaktion" nach Pawlow als evolutionäre Grundlage der Medienattraktivität erläutert wird.
2. Filmdidaktik und -ästhetik der 1960er-/1970er-Jahre: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung des Farbfilms und seine Einführung in den Deutschunterricht als Novum. Es beschreibt die technischen Fortschritte der Farbfilmtechnologie, die Entstehung des Fernsehens und die Rolle des Fernsehens im gesellschaftlichen Kontext. Der Fokus liegt auf der Integration des Films in den Unterricht zur Vermittlung verschiedener Kompetenzen und der verfolgten kognitiven, affektiven und konativen Ziele. Die Kapitel 2.1 und 2.2 legen den Fokus auf die technischen Entwicklungen und den Eintritt des Films in den Unterricht, während 2.3 die Wirkung der Filmdidaktik im Unterricht behandelt.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Einfluss von Medien im Unterricht auf die Entstehung von Mediensucht bei Schülern"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Medien im Unterricht auf die Entstehung von Mediensucht bei Schülern. Sie vergleicht die Filmdidaktik der 1960er/70er Jahre mit der modernen Mediendidaktik, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und daraus Lösungsansätze für einen effektiveren Medieneinsatz abzuleiten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Vergleich der Filmdidaktik der 1960er/70er Jahre und der modernen Mediendidaktik; Analyse der Auswirkungen verschiedener didaktischer Ansätze auf Schüler; die Rolle der Medienkompetenz im Umgang mit Medien im Unterricht; der Einfluss der Digitalisierung auf den Unterricht und das Phänomen der Mediensucht; Entwicklung von Lösungsansätzen für einen differenzierten und effizienten Medieneinsatz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Filmdidaktik und -ästhetik der 1960er/70er-Jahre (inkl. Unterkapitel zu Farbfilm, Film im Deutschunterricht und Effekten der Filmdidaktik), Moderne Mediendidaktik (inkl. Definition moderner Medien, deren Rolle im Unterricht und Effekten der modernen Mediendidaktik), Vergleich Filmdidaktik und moderne Mediendidaktik, Medienkompetenz, Die Zukunft moderner Mediendidaktik – Ausblick (inkl. virtuelles Klassenzimmer und Effekte der Digitalisierung – Mediensucht) und Fazit/Schlussbemerkung.
Was wird unter "Moderne Mediendidaktik" verstanden?
Die Arbeit definiert "Moderne Mediendidaktik" im Kontext des Einsatzes digitaler Medien im Unterricht. Es wird die Omnipräsenz dieser Medien und deren potenzieller Einfluss auf die Entstehung von Mediensucht thematisiert. Der Begriff "Medien" wird dabei als Sammelbegriff für audiovisuelle Kommunikationsmittel verwendet.
Wie wird die Filmdidaktik der 1960er/70er Jahre behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Einführung des Farbfilms und des Fernsehens in den Deutschunterricht. Es beschreibt die technischen Fortschritte der Farbfilmtechnologie und die Rolle des Fernsehens im gesellschaftlichen Kontext. Der Fokus liegt auf der Integration des Films in den Unterricht und den damit verfolgten didaktischen Zielen (kognitiv, affektiv, konativ).
Welche Rolle spielt Medienkompetenz?
Die Rolle der Medienkompetenz im Umgang mit Medien im Unterricht ist ein zentraler Aspekt der Arbeit. Es wird untersucht, wie Medienkompetenz dazu beitragen kann, einen effektiveren und verantwortungsvollen Medieneinsatz zu gewährleisten und der Entstehung von Mediensucht entgegenzuwirken.
Wie wird das Phänomen der Mediensucht betrachtet?
Die Arbeit betrachtet Mediensucht als ein zentrales Problem im Kontext der zunehmenden Digitalisierung und Omnipräsenz von Medien im Leben von Schülern. Der Einfluss der Digitalisierung auf den Unterricht und die Entstehung von Mediensucht werden analysiert, und es werden Lösungsansätze für einen differenzierten und effizienten Medieneinsatz entwickelt.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die Ergebnisse des Vergleichs zwischen der Filmdidaktik der 1960er/70er Jahre und der modernen Mediendidaktik zusammen. Es werden Schlussfolgerungen über den effektiven und verantwortungsvollen Einsatz von Medien im Unterricht gezogen und Lösungsansätze zur Prävention von Mediensucht vorgeschlagen.
- Citation du texte
- Minou Buchweitz (Auteur), 2016, Mediensucht bei Schülern durch Einsatz von Medien im Unterricht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373593