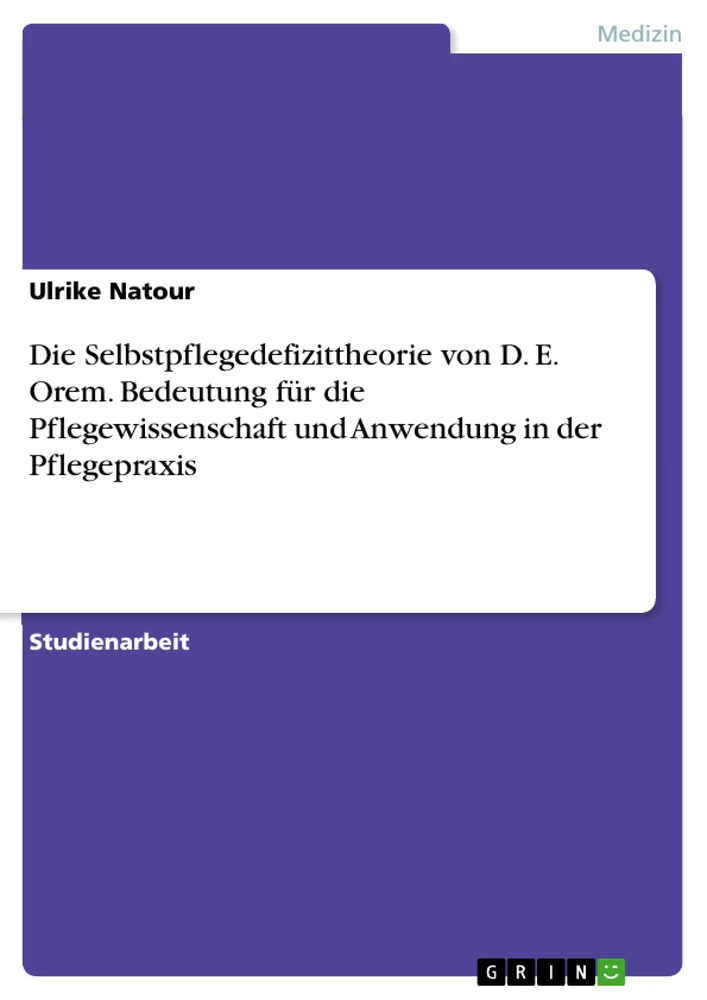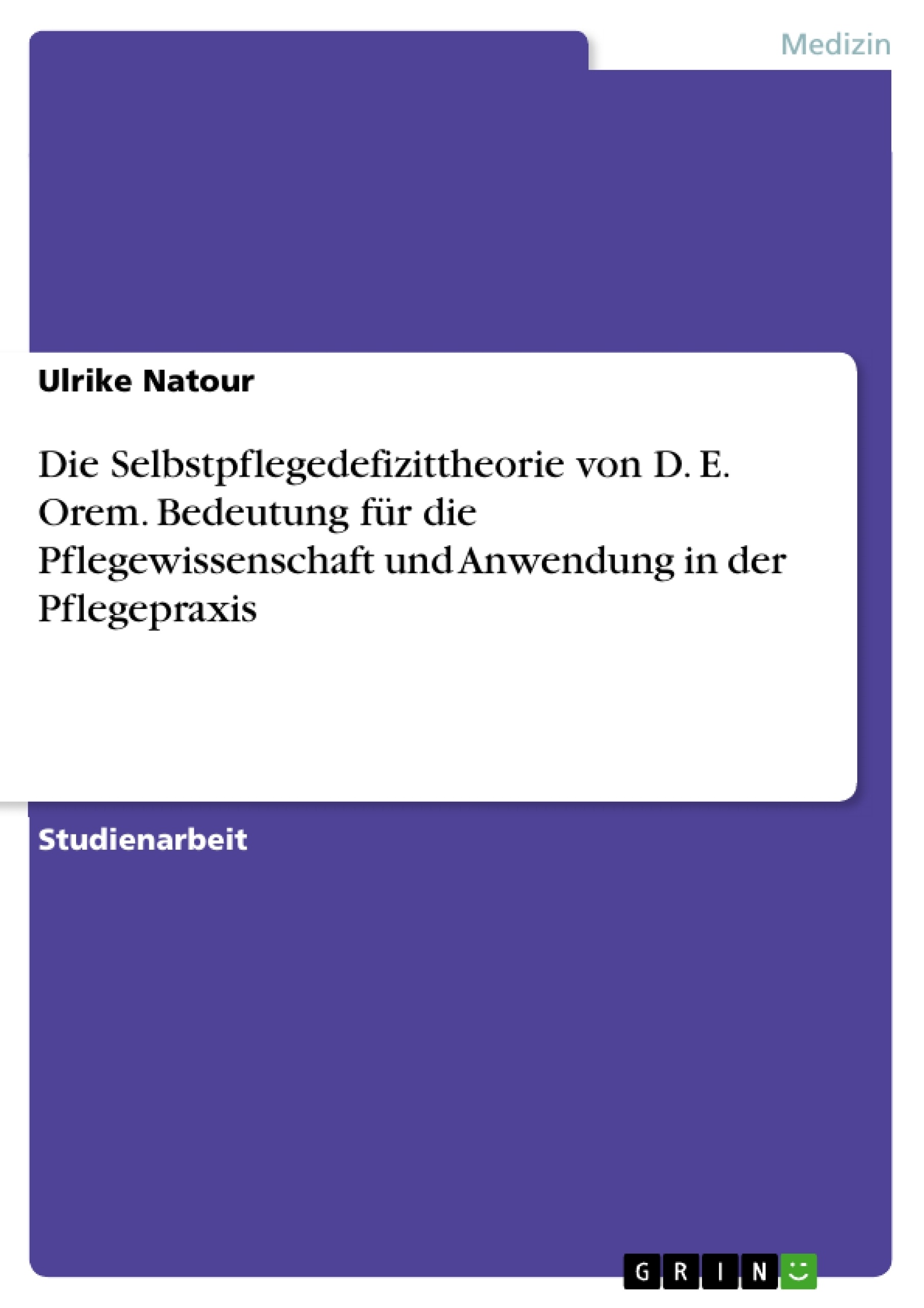Im Gegensatz zu den USA und vielen europäischen Ländern steckt die Entwicklung der Pflegewissenschaft in Deutschland noch in den Anfängen. Die Entwicklung von Pflegetheorien hat in den USA schon eine längere Tradition und Pflegestudiengänge sind an den Universitäten etabliert.
Der Prozess der Professionalisierung und der Verwissenschaftlichung von Pflege hat in Deutschland gerade erst begonnen. Die Etablierung von Pflegestudiengängen hauptsächlich an Fachhochschulen, aber auch Universitäten ist in den letzten Jahren einen weiten Schritt vorangegangen. Damit ist die Grundlage für den wissenschaftlichen Diskurs geschaffen. Die Diskussion über die Nützlichkeit und Anwendbarkeit amerikanischer Pflegetheorien für die deutsche Pflege stellt einen aktuellen Diskussionsgegenstand dar.
Die Selbstpflegedefizittheorie von Orem ist in den USA, Belgien und Niederlanden und anderen Ländern weit verbreitet.
Die Bedeutung der Theorie für die deutsche Pflegewissenschaft und inwieweit sie in der Pflegepraxis angewendet wird, ist ein Thema dieser Arbeit.
In dieser Arbeit werden nach einem kurzen Abriss des beruflichen Werdegangs der Theoretikerin die Konzepte der Theorie vorgestellt. Der Pflegeprozess als wichtige, systematische Methode zur Problemlösung wird in einem eigenen Abschnitt behandelt. Die Einordnung in Typologien durch die Metatheoretikerinnen Fawcett und Meleis sind für die Analyse der Theorie von Bedeutung und werden deshalb ebenso behandelt.
Die Anwendung in Ausbildung, Praxis und Forschung spiegeln die Möglichkeiten eines Einsatzes der Selbstpflegdefizittheorie wieder und dokumentieren ihre Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit.
Die abschließende Zusammenfassung der Bedeutung und der diskutierten Kritikpunkte repräsentiert einen kleinen Ausschnitt aus dem derzeitigen Diskussionsstand.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Beruflicher Werdegang der Theoretikerin
- 2.2 Elemente der Selbstpflegedefizittheorie
- 2.2.1 Theorie der Selbstpflege/Abhängigenpflege
- 2.2.2 Theorie des Selbstpflegedefizits
- 2.2.3 Theorie der Pflegesysteme
- 2.3 Der Pflegeprozess
- 2.4 Typologisierung der Selbstpflegedefizittheorie
- 2.4.1 Das Metaparadigma der Pflege nach Fawcett
- 2.4.2 Die Denkschulen nach Meleis
- 2.5 Die Anwendung der Selbstpflegedefizittheorie
- 2.5.1 Die Anwendung in der Ausbildung
- 2.5.2 Die Anwendung in der Praxis
- 2.5.3 Pflegeforschung
- 2.6 Bedeutung und Kritik
- 3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Selbstpflegedefizit-Theorie von Dorothea Orem. Ziel ist es, die Theorie in ihren zentralen Elementen darzustellen und ihre Bedeutung für die deutsche Pflegewissenschaft und -praxis zu beleuchten. Die Arbeit berücksichtigt dabei den beruflichen Werdegang Orems, die Anwendung der Theorie in der Ausbildung und Praxis sowie die aktuelle Diskussion um ihre Nützlichkeit und Anwendbarkeit im deutschen Kontext.
- Dorothea Orems beruflicher Werdegang und seine Einflüsse auf ihre Theoriebildung
- Die drei zentralen Elemente der Selbstpflegedefizit-Theorie: Selbstpflege, Selbstpflegedefizit und Pflegesysteme
- Der Pflegeprozess nach Orem und seine Anwendung in der Praxis
- Einordnung der Theorie in bestehende Typologien der Pflegewissenschaft
- Bedeutung und Kritikpunkte der Selbstpflegedefizit-Theorie im deutschen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Entwicklung der Pflegewissenschaft in Deutschland im Vergleich zu den USA, wobei der Fokus auf die zunehmende Bedeutung von Pflegetheorien und deren Anwendung in der Praxis liegt. Sie führt die Selbstpflegedefizit-Theorie von Orem als zentralen Gegenstand der Arbeit ein und skizziert den Aufbau der Untersuchung, der sich mit dem beruflichen Werdegang Orems, den Elementen ihrer Theorie, dem Pflegeprozess und der Anwendung in Ausbildung, Praxis und Forschung auseinandersetzt. Die Arbeit untersucht die Relevanz der Theorie für die deutsche Pflege und analysiert aktuelle Diskussionspunkte.
2 Hauptteil: Dieser Abschnitt bietet eine umfassende Darstellung der Selbstpflegedefizit-Theorie. Zunächst wird der berufliche Werdegang der Entwicklerin, Dorothea Orem, skizziert, der ihre theoretischen Konzepte maßgeblich beeinflusst hat. Im Anschluss werden die drei zentralen Elemente der Theorie – die Theorie der Selbstpflege, die Theorie des Selbstpflegedefizits und die Theorie der Pflegesysteme – detailliert erklärt und in ihren Zusammenhängen dargestellt. Der Pflegeprozess als systematische Methode zur Problemlösung wird als wichtiger Bestandteil der Theorie behandelt. Die Einordnung der Theorie in bestehende Typologien, insbesondere die von Fawcett und Meleis, wird vorgenommen. Schließlich wird die Anwendung der Selbstpflegedefizit-Theorie in Ausbildung, Praxis und Forschung analysiert, um ihre Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit zu belegen.
2.1 Beruflicher Werdegang der Theoretikerin: Dieser Abschnitt zeichnet den beruflichen Werdegang Dorothea Orems nach, von ihrer Krankenpflegeausbildung in den 1930er Jahren bis hin zu ihrer Professur und der Entwicklung ihrer Theorie. Es wird gezeigt, wie ihre verschiedenen beruflichen Stationen, einschließlich ihrer Tätigkeit als Beraterin und ihre Arbeit an Curricula, ihre theoretischen Ansätze geprägt haben. Die Entwicklung und Veröffentlichung ihres grundlegenden Werks "Nursing: Concepts of Practice" wird als Höhepunkt ihres beruflichen Lebens und als Grundlage für die Selbstpflegedefizit-Theorie hervorgehoben.
2.2 Elemente der Selbstpflegedefizittheorie: Hier werden die drei zentralen Komponenten der Theorie Orems detailliert analysiert. Der Abschnitt beginnt mit der Theorie der Selbstpflege, in der Orems Definition von Selbstpflege und Abhängigenpflege erläutert wird, einschließlich der Bedeutung des therapeutischen Selbstpflegebedarfs. Es folgt eine umfassende Beschreibung der Theorie des Selbstpflegedefizits, die die Bedingungen für das Auftreten eines Defizits beschreibt und den Pflegebedarf begründet. Abschließend wird die Theorie der Pflegesysteme im Detail dargelegt, wobei die verschiedenen Pflegesysteme und ihre Anwendung in Abhängigkeit vom Ausmaß des Selbstpflegedefizits erläutert werden. Der Fokus liegt auf der Darstellung des theoretischen Rahmens und der Interdependenz der drei Teiltheorien.
2.3 Der Pflegeprozess: Dieser Teil beschreibt den Pflegeprozess als eine systematische Methode der Problemlösung innerhalb der Selbstpflegedefizit-Theorie. Der Abschnitt beleuchtet die einzelnen Phasen des Pflegeprozesses und wie diese im Kontext von Orems Theorie angewendet werden, um den individuellen Selbstpflegebedarf zu ermitteln und zu unterstützen. Die Bedeutung des Pflegeprozesses für die zielgerichtete und effiziente Pflege wird hervorgehoben.
2.4 Typologisierung der Selbstpflegedefizittheorie: Die Einordnung der Theorie Orems in bestehende Typologien der Pflegewissenschaft wird hier analysiert. Der Abschnitt vergleicht und kontrastiert die Selbstpflegedefizit-Theorie mit anderen Ansätzen, wobei insbesondere das Metaparadigma nach Fawcett und die Denkschulen nach Meleis betrachtet werden. Diese Analyse dient dazu, die Theorie einzuordnen und ihre Position innerhalb des größeren Felds der Pflegewissenschaft zu verdeutlichen.
2.5 Die Anwendung der Selbstpflegedefizittheorie: Dieser Abschnitt untersucht die praktische Anwendung der Selbstpflegedefizit-Theorie in der Ausbildung, Praxis und Forschung. Es wird gezeigt, wie die Theorie in der Ausbildung von Pflegekräften eingesetzt wird und welche Rolle sie in der praktischen Pflege spielt. Darüber hinaus wird ihre Bedeutung für die Pflegeforschung und die Weiterentwicklung des Fachgebiets hervorgehoben. Konkrete Beispiele für die Anwendung in verschiedenen Kontexten verdeutlichen die Praktikabilität und den Nutzen der Theorie.
Schlüsselwörter
Selbstpflegedefizit-Theorie, Dorothea Orem, Pflegewissenschaft, Pflegeprozess, Selbstpflege, Abhängige Pflege, Pflegesysteme, Professionalisierung der Pflege, Pflegeforschung, Pflegepraxis, Pflegepädagogik, Metaparadigma, Typologisierung.
Häufig gestellte Fragen zur Selbstpflegedefizit-Theorie von Dorothea Orem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit der Selbstpflegedefizit-Theorie der Pflegewissenschaftlerin Dorothea Orem. Sie untersucht die zentralen Elemente der Theorie, ihre Bedeutung für die deutsche Pflegepraxis und -wissenschaft und analysiert ihre Anwendung in Ausbildung, Praxis und Forschung.
Welche Aspekte der Selbstpflegedefizit-Theorie werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den beruflichen Werdegang Dorothea Orems und dessen Einfluss auf ihre Theoriebildung. Im Detail werden die drei Kernelemente der Theorie erklärt: die Theorie der Selbstpflege, die Theorie des Selbstpflegedefizits und die Theorie der Pflegesysteme. Der Pflegeprozess nach Orem und seine praktische Anwendung werden ebenso behandelt wie die Einordnung der Theorie in bestehende Typologien der Pflegewissenschaft (Fawcett und Meleis). Schließlich werden Bedeutung und Kritikpunkte der Theorie im deutschen Kontext diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und ein Fazit. Der Hauptteil umfasst detaillierte Analysen der drei Kernelemente der Selbstpflegedefizit-Theorie, des Pflegeprozesses, der Einordnung in bestehende Typologien und der Anwendung der Theorie in Ausbildung, Praxis und Forschung. Die Einleitung liefert einen Überblick über die Entwicklung der Pflegewissenschaft und die Bedeutung von Pflegetheorien. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Was sind die zentralen Elemente der Selbstpflegedefizit-Theorie?
Die drei zentralen Elemente sind die Theorie der Selbstpflege (inkl. Abhängiger Pflege und therapeutischem Selbstpflegebedarf), die Theorie des Selbstpflegedefizits (Bedingungen für das Auftreten eines Defizits und Begründung des Pflegebedarfs) und die Theorie der Pflegesysteme (verschiedene Pflegesysteme und deren Anwendung abhängig vom Selbstpflegedefizit).
Wie wird der Pflegeprozess in der Selbstpflegedefizit-Theorie dargestellt?
Der Pflegeprozess wird als systematische Methode der Problemlösung beschrieben, die die einzelnen Phasen zur Ermittlung und Unterstützung des individuellen Selbstpflegebedarfs beleuchtet. Seine Bedeutung für eine zielgerichtete und effiziente Pflege wird hervorgehoben.
Welche Typologien der Pflegewissenschaft werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Einordnung der Selbstpflegedefizit-Theorie in bestehende Typologien, insbesondere das Metaparadigma nach Fawcett und die Denkschulen nach Meleis. Dies dient der Einordnung der Theorie im größeren Feld der Pflegewissenschaft.
Wie wird die Anwendung der Theorie in der Praxis beschrieben?
Die Arbeit untersucht die Anwendung der Selbstpflegedefizit-Theorie in der Ausbildung von Pflegekräften, in der praktischen Pflege und in der Pflegeforschung. Konkrete Beispiele verdeutlichen die Praktikabilität und den Nutzen der Theorie.
Welche Bedeutung und Kritikpunkte der Theorie werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert die Bedeutung und die Kritikpunkte der Selbstpflegedefizit-Theorie im deutschen Kontext, beleuchtet ihre Relevanz für die deutsche Pflege und diskutiert aktuelle Diskussionspunkte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Selbstpflegedefizit-Theorie, Dorothea Orem, Pflegewissenschaft, Pflegeprozess, Selbstpflege, Abhängige Pflege, Pflegesysteme, Professionalisierung der Pflege, Pflegeforschung, Pflegepraxis, Pflegepädagogik, Metaparadigma, Typologisierung.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text (inkl. detaillierter Kapitelzusammenfassungen und Inhaltsverzeichnis) ist in der Originalquelle verfügbar (Quelle nicht angegeben im Prompt).
- Quote paper
- Ulrike Natour (Author), 2005, Die Selbstpflegedefizittheorie von D. E. Orem. Bedeutung für die Pflegewissenschaft und Anwendung in der Pflegepraxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37337