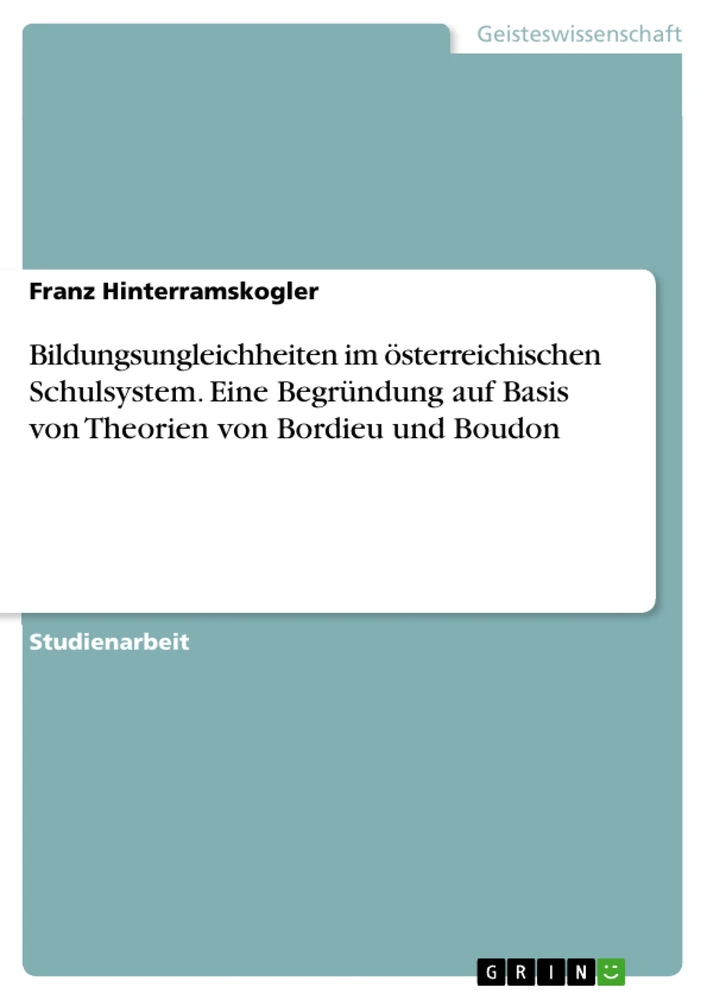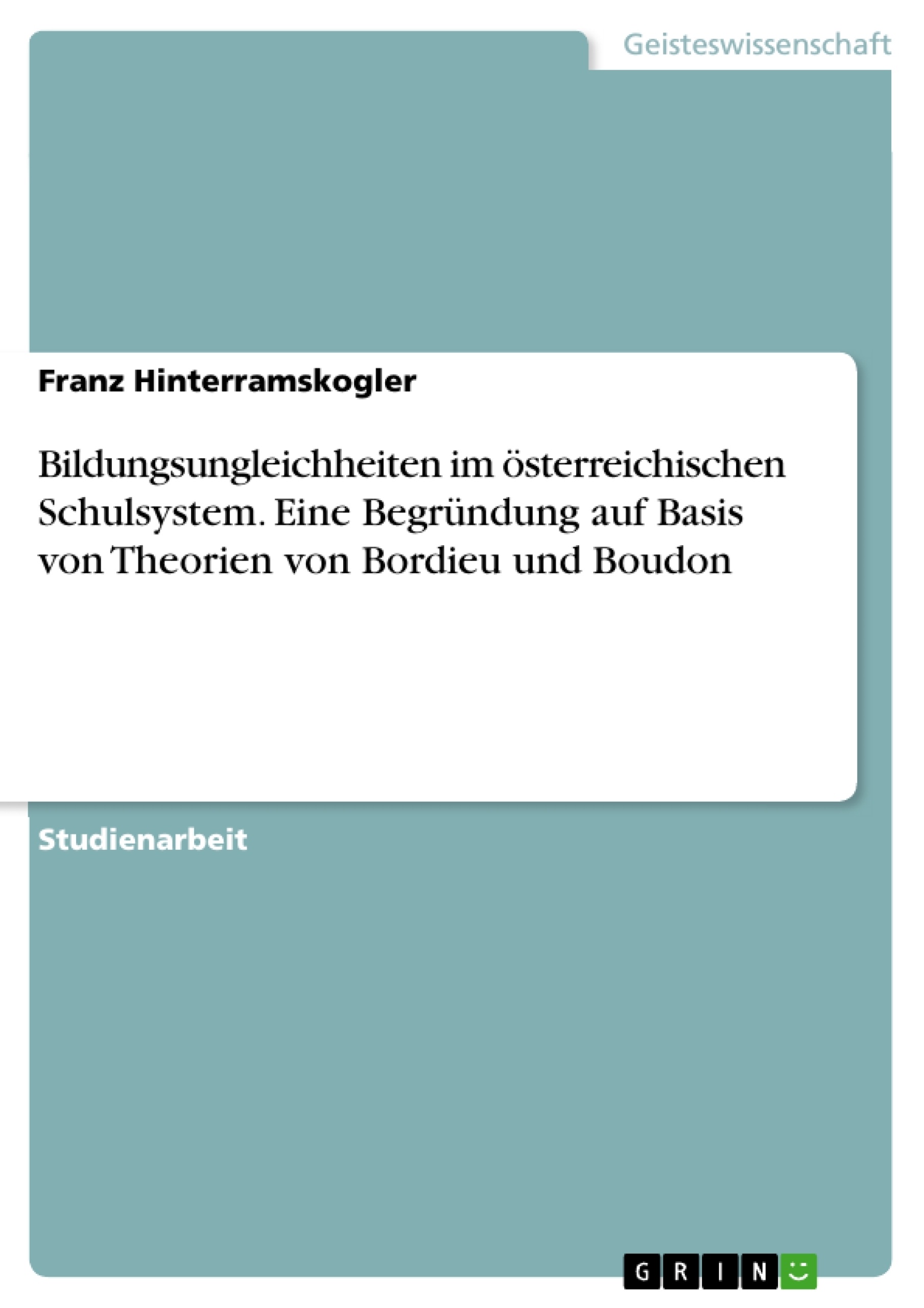Verschiedene Studien der letzten Jahre, wie etwa die PISA-Studien, waren eigentlich ein Glück für das deutsche Bildungssystem und ebenso für das österreichische, da ihre Ergebnisse die Diskussion über Bildungsungleichheiten auf wissenschaftlicher und politischer Ebene wiederbelebt haben. Betrachtet man die österreichische Schulpolitik der letzten Jahrzehnte, so kommen Zweifel auf, ob die Ergebnisse dieser Studien und die daraus entwickelten Maßnahmen gegen Bildungsungleichheit im österreichischen Schulsystem von der Politik auch umgesetzt werden können und vor allem wollen.
Die Diskussion über das österreichische Schul- und Bildungssystem ist extrem ideologisch und parteipolitisch geprägt. Bildung ist ein Spielball der politischen Parteien, für politischen Hickhack missbraucht, von parteipolitischen Überlegungen bestimmt und nicht von wissenschaftlichen Überlegungen geleitet. Bildungspolitische Entscheidungen für zukünftige Generationen werden von Menschen gefällt, die ihre politische Position nicht aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation, sondern wegen ihres politischen Standvermögens und ihrer politischen Verbindungen und Vernetzungen innehaben.
Die in dieser Arbeit aufgezählten Bildungsungleichheiten sind seit vielen Jahren bekannt, ebenso wie Maßnahmen dagegen. Allerdings ist in den letzten Jahrzehnten nichts passiert und wenn, dann waren es nur Alibihandlungen, nicht aber weitreichende und tiefgreifende Änderungen. Die Neue Mittelschule ist das beste Beispiel für diesen Schwindel. Solange das bildungspolitische Denken der Menschen, die für Entscheidungen in der Schulpolitik verantwortlich sind, nicht über den fünfjährigen Zeitraum einer Legislaturperiode hinausgeht, wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Es darf bezweifelt werden, ob die verantwortlichen Politiker die Tragweite ihrer Entscheidungen für die Zukunft junger Menschen überhaupt verstehen. Damit entscheidende Schritte in der Bildungspolitik gesetzt werden, müssten endlich Experten, die es in Österreich gibt und die sich gelegentlich, auch über Parteigrenzen hinweg, zu Wort melden, das Sagen haben. Wenn das der Fall ist, werden Bildungsungleichheiten im österreichischen Schulsystem abgebaut und das österreichische Schulsystem wird von Grund auf erneuert werden. Damit würden alle Schüler eine faire Bildungschance erhalten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsdefinition Bildungsungleichheit
- 3 Das österreichische Schulsystem
- 3.1 Primarstufe
- 3.2 Sekundarstufe I
- 3.3 Sekundarstufe II
- 3.4 Postsekundar- und Tertiärstufe
- 3.5 Schnittstellenproblematik des österreichischen Schulsystems
- 4 Theoretische Begründung nach Bourdieu und Boudon
- 4.1 Bourdieus Ansätze zur Erklärung von Bildungsungleichheit
- 4.2 Primäre und sekundäre Herkunftseffekte nach Boudon
- 5 Stand der Forschung
- 6 Bildungsungleichheit im österreichischen Schulsystem
- 6.1 Bildungsungleichheit nach der sozialen Herkunft
- 6.2 Bildungsungleichheit und Migrationshintergrund
- 6.3 Bildungsungleichheit zwischen den Geschlechtern
- 6.4 Bildungsungleichheit und Wohnort
- 7 Lösungsstrategien zur Beseitigung von Bildungsungleichheit
- 8 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bildungsungleichheiten im österreichischen Schulsystem und mögliche Lösungsansätze. Das Ziel ist, die Auswirkungen sozialer Kriterien auf die Bildungsungleichheit aufzuzeigen und zu analysieren.
- Definition von Bildungsungleichheit und deren verschiedenen Facetten.
- Struktur und Problematik des österreichischen Schulsystems.
- Theoretische Erklärungen von Bildungsungleichheit nach Bourdieu und Boudon.
- Analyse der Bildungsungleichheit nach sozialen Merkmalen (soziale Herkunft, Migrationshintergrund, Geschlecht, Wohnort).
- Präsentation von Lösungsstrategien zur Reduzierung von Bildungsungleichheit.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung hebt die Bedeutung von Bildung für individuelle Lebenschancen und gesellschaftliches Wohl hervor und stellt die Problematik von Bildungsungleichheit in Österreich dar. Sie führt in die Forschungsfrage ein: Welchen Effekt haben soziale Kriterien auf die Bildungsungleichheit des österreichischen Schulsystems? Die Arbeit untersucht die Bildungsungleichheiten nach sozialer Herkunft, Migrationshintergrund, Geschlecht und Wohnort und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2 Begriffsdefinition Bildungsungleichheit: (Anmerkung: Der Text bricht hier ab. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann erst nach Lieferung des vollständigen Textes erstellt werden.)
3 Das österreichische Schulsystem: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das österreichische Schulsystem, von der Primarstufe bis zur Tertiärstufe. Es analysiert die Struktur des Systems und fokussiert sich insbesondere auf die Schnittstellenproblematik, die als bedeutender Punkt für Selektionsprozesse und ihre weitreichenden Folgen für den weiteren Bildungsweg hervorgehoben wird. Die verschiedenen Stufen des Systems und deren Übergänge werden detailliert beschrieben und kritisch beleuchtet im Hinblick auf ihre Rolle bei der Entstehung von Bildungsungleichheit.
4 Theoretische Begründung nach Bourdieu und Boudon: Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es erläutert die Ansätze von Bourdieu zur Erklärung von Bildungsungleichheit und die Konzepte der primären und sekundären Herkunftseffekte nach Boudon. Die Kapitel verbindet die theoretischen Modelle mit der empirischen Realität des österreichischen Schulsystems, und legt die theoretischen Fundamente für die Analyse der Bildungsungleichheit.
5 Stand der Forschung: (Anmerkung: Der Text bricht hier ab. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann erst nach Lieferung des vollständigen Textes erstellt werden.)
6 Bildungsungleichheit im österreichischen Schulsystem: Dieses Kapitel bildet den Schwerpunkt der Arbeit. Es analysiert detailliert die Bildungsungleichheiten im österreichischen Schulsystem, unterteilt nach sozialen Herkunft, Migrationshintergrund, Geschlecht und Wohnort. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Einflusses dieser sozialen Faktoren auf den Bildungserfolg. Die verschiedenen Unterkapitel liefern detaillierte Einblicke in die jeweiligen Zusammenhänge und belegen diese mit empirischen Daten und Forschungsergebnissen.
7 Lösungsstrategien zur Beseitigung von Bildungsungleichheit: (Anmerkung: Der Text bricht hier ab. Eine Zusammenfassung dieses Kapitels kann erst nach Lieferung des vollständigen Textes erstellt werden.)
Schlüsselwörter
Bildungsungleichheit, Österreich, Schulsystem, soziale Herkunft, Migrationshintergrund, Geschlecht, Wohnort, Bourdieu, Boudon, Bildungschancen, soziale Selektivität, Lösungsstrategien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bildungsungleichheit im österreichischen Schulsystem
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Bildungsungleichheiten im österreichischen Schulsystem und untersucht die Auswirkungen sozialer Faktoren wie soziale Herkunft, Migrationshintergrund, Geschlecht und Wohnort auf den Bildungserfolg. Sie beleuchtet die Struktur des österreichischen Schulsystems, relevante Theorien (Bourdieu, Boudon) und präsentiert mögliche Lösungsstrategien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinition Bildungsungleichheit, Das österreichische Schulsystem, Theoretische Begründung nach Bourdieu und Boudon, Stand der Forschung, Bildungsungleichheit im österreichischen Schulsystem (unterteilt nach sozialen Merkmalen), Lösungsstrategien zur Beseitigung von Bildungsungleichheit und Fazit.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Pierre Bourdieu (u.a. Habitus, Kapital) und Raymond Boudon (primäre und sekundäre Herkunftseffekte), um Bildungsungleichheiten zu erklären. Diese theoretischen Modelle werden auf das österreichische Schulsystem angewendet.
Welche Aspekte der Bildungsungleichheit werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Bildungsungleichheit im Detail, differenziert nach sozialer Herkunft, Migrationshintergrund, Geschlecht und Wohnort. Dabei wird der Einfluss dieser Faktoren auf den Bildungserfolg analysiert.
Wie ist das österreichische Schulsystem im Kontext der Arbeit dargestellt?
Das österreichische Schulsystem wird von der Primarstufe bis zur Tertiärstufe beschrieben. Besonderes Augenmerk liegt auf der Schnittstellenproblematik und deren Rolle bei der Entstehung von Bildungsungleichheit. Die verschiedenen Stufen und Übergänge werden detailliert analysiert.
Welche Lösungsstrategien werden diskutiert?
(Anmerkung: Aufgrund unvollständiger Daten kann zu diesem Punkt keine detaillierte Antwort gegeben werden. Die vollständige Arbeit enthält diesen Abschnitt.)
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen sozialer Kriterien auf die Bildungsungleichheit im österreichischen Schulsystem aufzuzeigen und zu analysieren. Sie soll ein besseres Verständnis der Problematik und mögliche Lösungsansätze liefern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bildungsungleichheit, Österreich, Schulsystem, soziale Herkunft, Migrationshintergrund, Geschlecht, Wohnort, Bourdieu, Boudon, Bildungschancen, soziale Selektivität, Lösungsstrategien.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die HTML-Datei enthält Zusammenfassungen der Kapitel 1, 3, 4 und 6. Die Zusammenfassungen der Kapitel 2, 5 und 7 sind aufgrund unvollständiger Daten nicht verfügbar.
Gibt es einen Inhaltsverzeichnis?
Ja, die HTML-Datei enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis aller Kapitel und Unterkapitel.
- Quote paper
- Franz Hinterramskogler (Author), 2015, Bildungsungleichheiten im österreichischen Schulsystem. Eine Begründung auf Basis von Theorien von Bordieu und Boudon, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371945