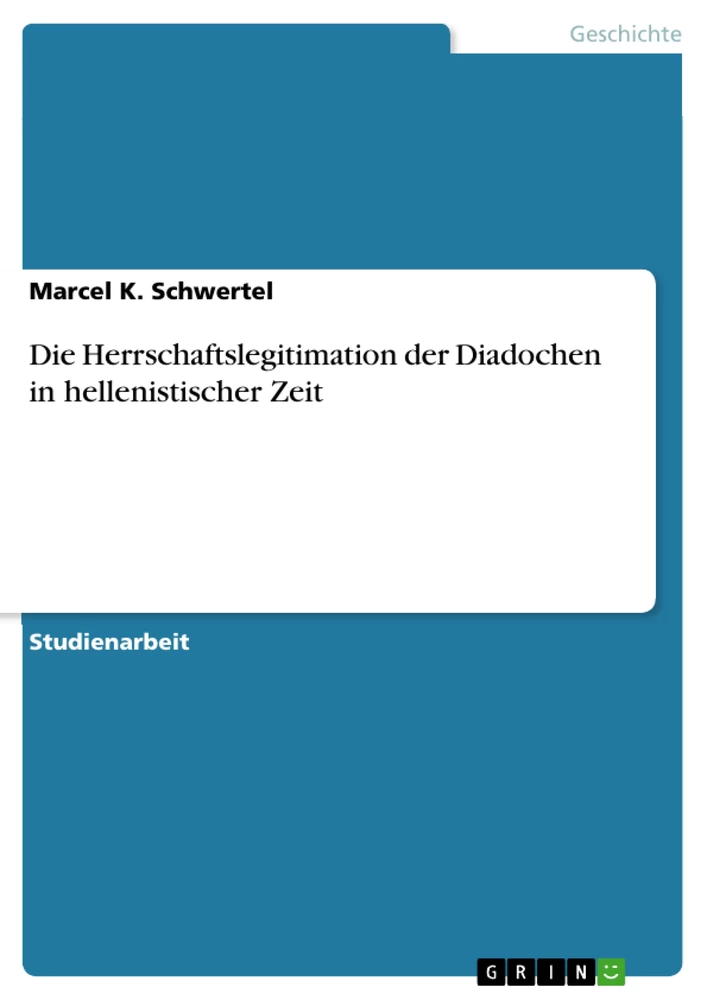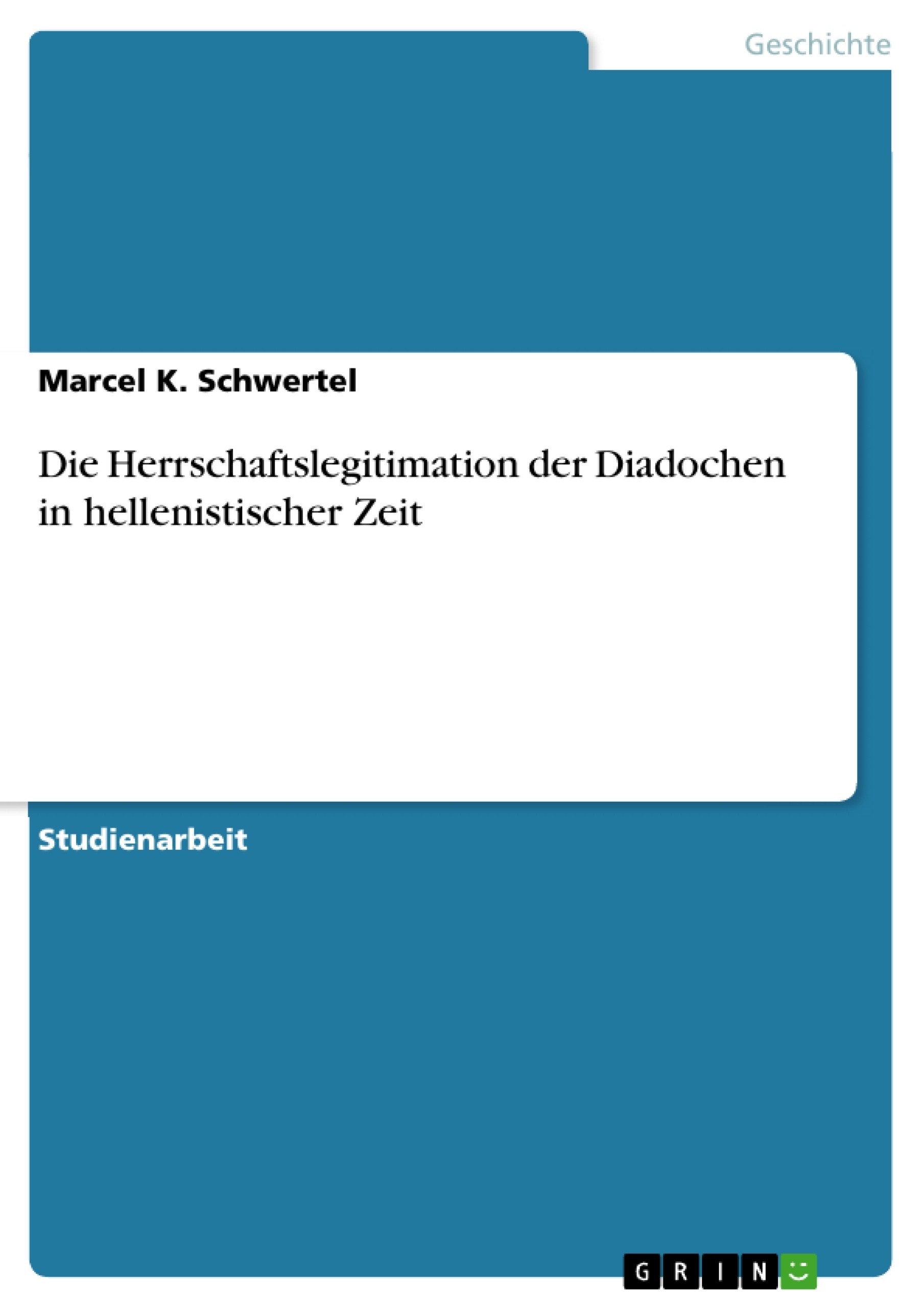«Le roi est mort, vive le roi!»
Dieser Ausruf geht zurück auf die französische Erbmonarchie und die rechtliche Tatsache, dass beim Tode des Königs die Krone sofort in den Besitz des Thronprädentanten übergeht. Somit vermittelt der Ausruf die Kontinuität der Monarchie und der Dynastie. Doch was geschieht, wenn die Nachfolge nicht gesichert ist? Wer hat in diesem Fall den Anspruch und die Legitimität, die Königswürde zu übernehmen?
Genau dieses Problem soll diese Arbeit in Bezug auf die Nachfolge der Diadochen auf Alexander den Großen beleuchten. Mit dessen Tod geriet das Alexanderreich in eine Krise, die durch die Kompromisslösung der Babylonischen Reichsordnung im Jahr 323 v. Chr. keineswegs gelöst war.2 Durch diese wurde mit Philipp III. Arrhidaios zwar formal ein König installiert, doch bildeten die Vereinbarungen und Ämterzuweisungen unter den wichtigsten Generälen Alexanders die Grundlage für die, unter ihnen ausbrechenden, Diadochenkriege und die daraufhin folgende Gründung neuer Reiche und Dynastien durch die Diadochen Antigonos, Kassander, Lysimachos, Ptolemaios und Seleukos.
Hier stellt sich jedoch die Frage, durch welche Mittel es diesen gelingen konnte, sich als Könige zu legitimieren und ob sich eine Wertigkeit in jenen Legitimationsmitteln erkennen lässt?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Thematik
- Historischer Kontext und der Siegelring Alexanders
- Heiratspolitik, Dynastiegründung und erhöhte Genealogie
- Von militärischen Erfolgen und „speergewonnen“ Gebieten
- Weitere Legitimationsmittel der Diadochen
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Herrschaftslegitimation der Diadochen, den Nachfolgern Alexanders des Großen, in hellenistischer Zeit. Sie untersucht, wie diese Generäle Alexanders Anspruch auf Königswürde erhoben und ihre Herrschaft gegenüber den Bewohnern des ehemaligen Alexanderreichs rechtfertigten.
- Legitimationsmittel der Diadochen
- Die Rolle der militärischen Erfolge
- Die Bedeutung der Heiratspolitik und Dynastiegründung
- Die ideelle Anbindung an Alexander den Großen
- Weitere Legitimationsfaktoren wie symbolische Erhöhung der Genealogie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung in die Thematik
Diese Einleitung stellt die Problematik der Nachfolge Alexanders des Großen nach seinem Tod dar und erläutert den Begriff der Legitimation im Kontext der Antike. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, wie die Diadochen ihre Herrschaft rechtfertigten und welche Rolle die militärischen Erfolge dabei spielten.
2. Historischer Kontext und der Siegelring Alexanders
Das Kapitel beleuchtet die politische Situation nach Alexanders Tod und die Rolle des Siegelrings als Symbol der Vollmacht. Es wird diskutiert, ob der Siegelring als Legitimationsmittel betrachtet werden kann und wie seine Bedeutung im Kontext der Thronfolge einzuschätzen ist.
3. Heiratspolitik, Dynastiegründung und erhöhte Genealogie
Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung der Heiratspolitik für die Legitimation der Diadochen. Insbesondere die Heiratspläne um Kleopatra, die Schwester Alexanders, werden analysiert. Die Rolle der Dynastiegründung und der symbolischen Erhöhung der Genealogie als Legitimationsfaktoren werden ebenfalls behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Herrschaftslegitimation, Diadochen, hellenistische Zeit, Alexander der Große, militärische Erfolge, Heiratspolitik, Dynastiegründung, ideelle Anbindung an Alexander, Genealogie, Symbolpolitik. Diese Begriffe repräsentieren die zentralen Elemente des Forschungsfelds, welche im Verlauf der Arbeit näher beleuchtet werden.
- Quote paper
- Marcel K. Schwertel (Author), 2017, Die Herrschaftslegitimation der Diadochen in hellenistischer Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371852