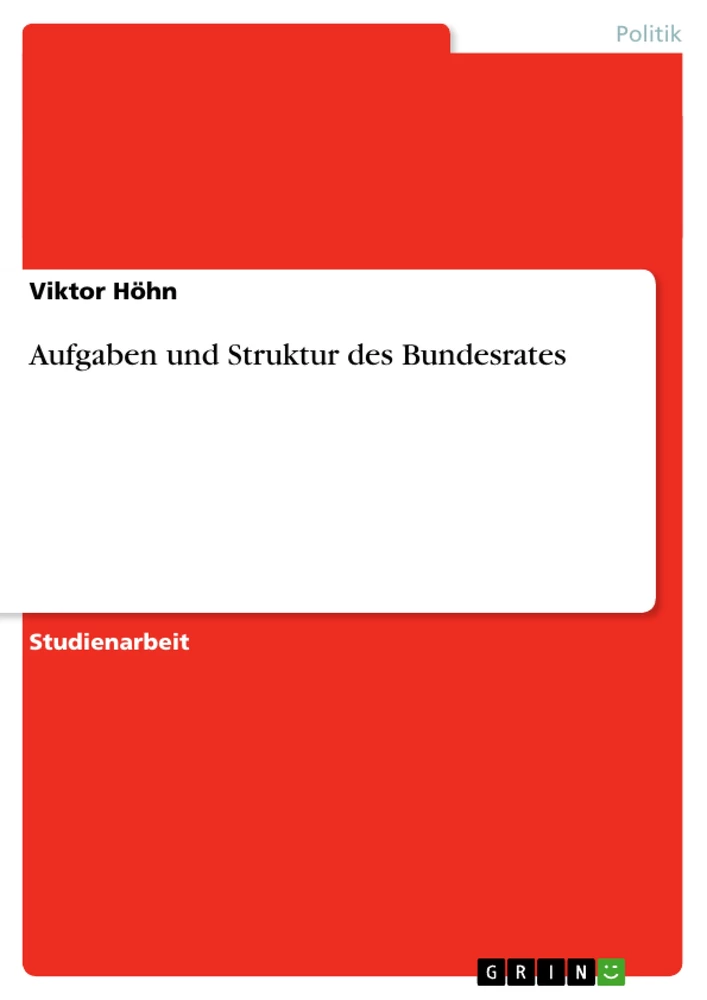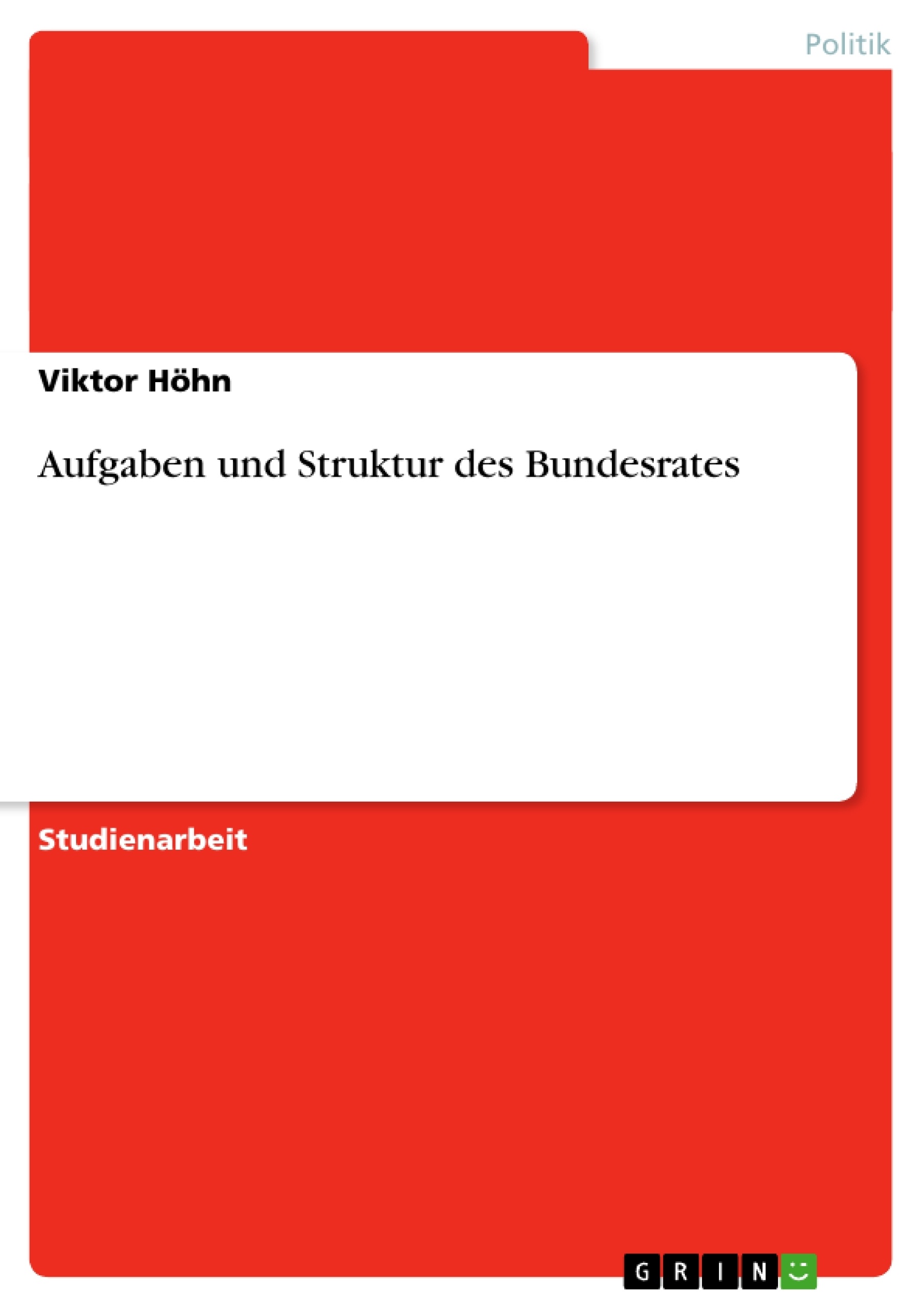In der aktuellen Diskussion besteht in weiten Teilen der deutschen Wirtschaft und Politik kein Zweifel darüber, dass der deutsche Föderalismus reformiert werden muss.1 Ob dies aber auch für den Deutschen Bundesrat zutrifft, ist weit umstrittener. In der Bewertung des Bundesrates finden sich im Verlauf der Zeit sehr unterschiedliche Ansichten. In den siebziger Jahren noch galt er aus konkordanzdemokratischer Sicht als wesentliches und durchaus effizientes Element eines Bund-Länder-Verwaltungssystems. In den neunziger Jahren kamen in der politischen Debatte Stimmen auf, die das „Verhandeln“ als Gegenpol zu effizienten Regieren z. B. nach dem Vorbild der Konkurrenzdemokratie Großbritanniens sahen. So argumentiert beispielsweise der Politikwissenschaftler Wilhelm Hennis: „Wenn wir eine Föderalismusdebatte führen wollen, dann doch bitte die richtige. Nicht über den Föderalismus überhaupt, sondern über die genauere Frage, ob nicht der Bundesrat – als Vertretung der Landesregierungen – ein Relikt des monarchischen Obrigkeitsstaats ist. Dieses Organ ist demokratisch kaum zu rechtfertigen und inzwischen das eigentliche Scharnier eines sich selbst blockierenden Parteienstaats“2. Aufgrund dieser aktuellen Debatte und der unterschiedlichen Positionen bzgl. des Bundesrates allgemein und seinen Aufgaben und Funktionen im speziellen, beschäftigt sich die folgende Abhandlung mit der Entstehung des Bundesrates, seiner Struktur und seinen Aufgaben. Es wird insbesondere auf die Frage eingegangen auf welchen verfassungsrechtlichen Grundlagen die Aufgaben und die Struktur des Bundesrates basieren und wie deren Ausgestaltung in der Verfassungswirklichkeit aussieht. Es steht in erster Linie jedoch nicht die vollständige Präsentation der formellen Struktur und Aufgaben des Bundesrates im Mittelpunkt, sondern vielmehr der Strukturmerkmale und Aufgabenbereiche, die in der Verfassungswirklichkeit bedeutsam sind. 1 Die folgende Darstellung stützt sich auf Sturm, Roland (2002): Vorbilder einer Bundesratsreform? Lehren aus den Erfahrungen der Verfassungspraxis Zweiter Kammern, in: ZParl 2002, S. 166-167. 2 Zit. n. Wilhelm Hennis (1998): Auf dem Weg in den Parteienstaat, Stuttgart, S. 159.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Relevanz des Themas und Problemaufriss
- 2. Thesen
- 3. Vorgehensweise
- II. Die Entstehungsgeschichte des Bundesrates
- 1. Die Modelle - Bundesratsmodell versus Senatsmodell
- 2. Die abgeschwächte Bundesratslösung
- III. Die Struktur des Bundesrates in Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit
- 1. Zusammensetzung und demokratische Legitimation
- 2. Organisation und Arbeitsweise
- IV. Die Aufgaben des Bundesrates in Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit
- 1. Aufgaben im Bereich der Gesetzgebung
- 2. Aufgaben im Bereich der Verwaltung
- 3. Weitere Aufgaben
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung, Struktur und Aufgaben des Bundesrates. Ziel ist es, die verfassungsrechtlichen Grundlagen seiner Aufgaben und Struktur zu beleuchten und deren Ausgestaltung in der Verfassungswirklichkeit zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf den in der Verfassungswirklichkeit bedeutsamen Strukturmerkmalen und Aufgabenbereichen, nicht auf einer vollständigen Präsentation der formalen Aspekte.
- Entstehungsgeschichte des Bundesrates und der Kompromiss der „abgeschwächten Bundesratslösung“
- Zusammensetzung und demokratische Legitimation des Bundesrates
- Aufgaben des Bundesrates in Gesetzgebung und Verwaltung
- Die Bedeutung des Bundesrates in der Verfassungswirklichkeit
- Bewertung der politischen Potenz des Bundesrates
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar, indem sie auf die aktuelle Debatte um die Reform des deutschen Föderalismus und die unterschiedlichen Bewertungen des Bundesrates eingeht. Sie präsentiert gegensätzliche Positionen, von der konkordanzdemokratischen Sichtweise bis hin zu kritischen Stimmen, die den Bundesrat als Blockadeinstrument sehen. Die Arbeit kündigt ihre Vorgehensweise an, die die Entstehungsgeschichte, Struktur und Aufgaben des Bundesrates beleuchtet und dabei den Fokus auf die Verfassungswirklichkeit legt. Zwei zentrale Thesen werden formuliert: die Bedeutung der Zustimmungsbefugnis des Bundesrates bei Gesetzen und seine Rolle als möglicher „Transmissionsriemen für die Unitarisierung der Bundesrepublik“.
II. Die Entstehungsgeschichte des Bundesrates: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des Bundesrates im Kontext der Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Es vergleicht das Senatsmodell mit dem Bundesratsmodell und erläutert die „abgeschwächte Bundesratslösung“ als Kompromiss zwischen beiden. Das Kapitel analysiert die verschiedenen Modelle, ihre Vor- und Nachteile und wie die Entscheidung für die abgeschwächte Lösung die Rolle des Bundesrates im föderalen System prägt. Der Kompromiss wird als ein Ergebnis politischer Verhandlungen dargestellt, nicht als Ergebnis staatsrechtlicher oder staatstheoretischer Überlegungen. Die unterschiedlichen Stimmgewichte der Länder im Bundesrat werden als Ergebnis dieses Kompromisses erklärt.
Schlüsselwörter
Bundesrat, Föderalismus, Gesetzgebung, Verwaltung, Verfassungswirklichkeit, Bundesstaat, Demokratie, Parlamentarischer Rat, abgeschwächte Bundesratslösung, Zustimmungspflicht, Unitarisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über den Bundesrat
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entstehung, Struktur und Aufgaben des deutschen Bundesrates. Sie untersucht die verfassungsrechtlichen Grundlagen und deren Ausgestaltung in der Verfassungswirklichkeit. Der Fokus liegt dabei auf den in der Praxis bedeutsamen Aspekten, nicht auf einer vollständigen Darstellung aller formalen Details.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Schwerpunkte: die Entstehungsgeschichte des Bundesrates einschließlich des Kompromisses der „abgeschwächten Bundesratslösung“, die Zusammensetzung und demokratische Legitimation des Bundesrates, seine Aufgaben in Gesetzgebung und Verwaltung, seine Bedeutung in der Verfassungswirklichkeit und eine Bewertung seiner politischen Macht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Entstehungsgeschichte des Bundesrates, Struktur des Bundesrates, Aufgaben des Bundesrates und Fazit. Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und formuliert zentrale Thesen. Die folgenden Kapitel behandeln die jeweiligen Themen im Detail. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Thesen werden in der Arbeit vertreten?
Die Arbeit formuliert zwei zentrale Thesen: Die Bedeutung der Zustimmungsbefugnis des Bundesrates bei Gesetzen und seine Rolle als möglicher „Transmissionsriemen für die Unitarisierung der Bundesrepublik“ werden untersucht und bewertet.
Wie wird die Entstehungsgeschichte des Bundesrates dargestellt?
Die Entstehungsgeschichte wird im Kontext der Gründung der Bundesrepublik Deutschland beleuchtet. Sie vergleicht das Senatsmodell mit dem Bundesratsmodell und erklärt den Kompromiss der „abgeschwächten Bundesratslösung“ als Ergebnis politischer Verhandlungen. Die unterschiedlichen Stimmgewichte der Länder werden als Folge dieses Kompromisses erläutert.
Welche Rolle spielt die Verfassungswirklichkeit in der Arbeit?
Die Verfassungswirklichkeit spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit analysiert nicht nur die formalen verfassungsrechtlichen Grundlagen, sondern auch deren praktische Umsetzung und Bedeutung im politischen Alltag. Der Fokus liegt auf der Analyse der tatsächlichen Macht und des Einflusses des Bundesrates.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bundesrat, Föderalismus, Gesetzgebung, Verwaltung, Verfassungswirklichkeit, Bundesstaat, Demokratie, Parlamentarischer Rat, abgeschwächte Bundesratslösung, Zustimmungspflicht, Unitarisierung.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen zu allen Kapiteln. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die behandelten Inhalte und die zentralen Ergebnisse jedes Kapitels. Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas und die Vorgehensweise dar, während die anderen Kapitelzusammenfassungen die jeweiligen Themenschwerpunkte zusammenfassen.
- Quote paper
- Viktor Höhn (Author), 2004, Aufgaben und Struktur des Bundesrates, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37178