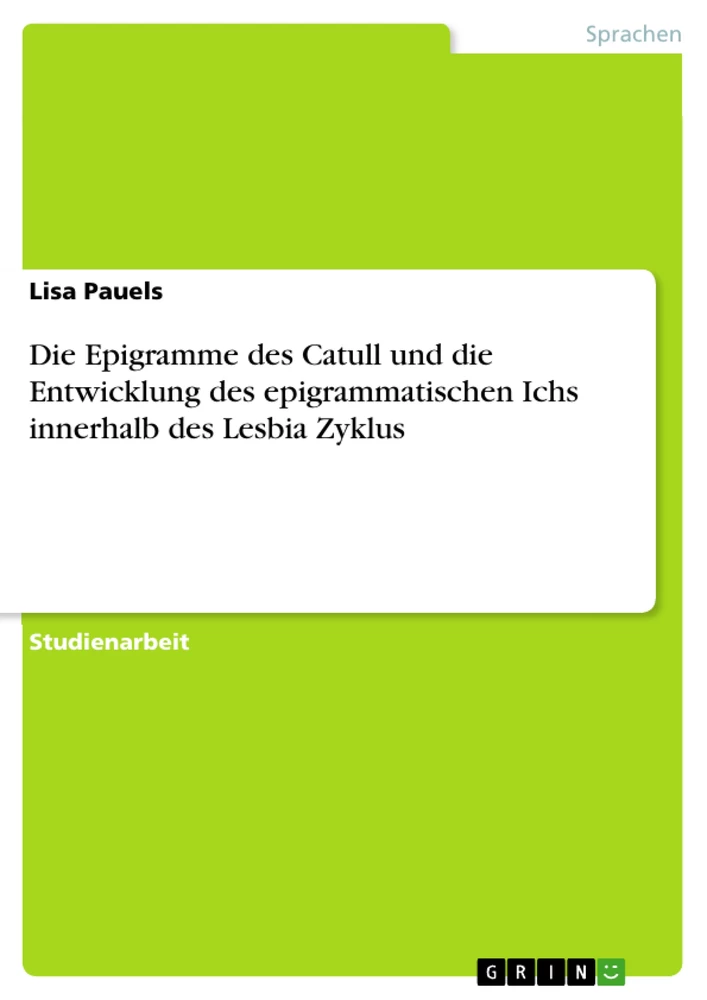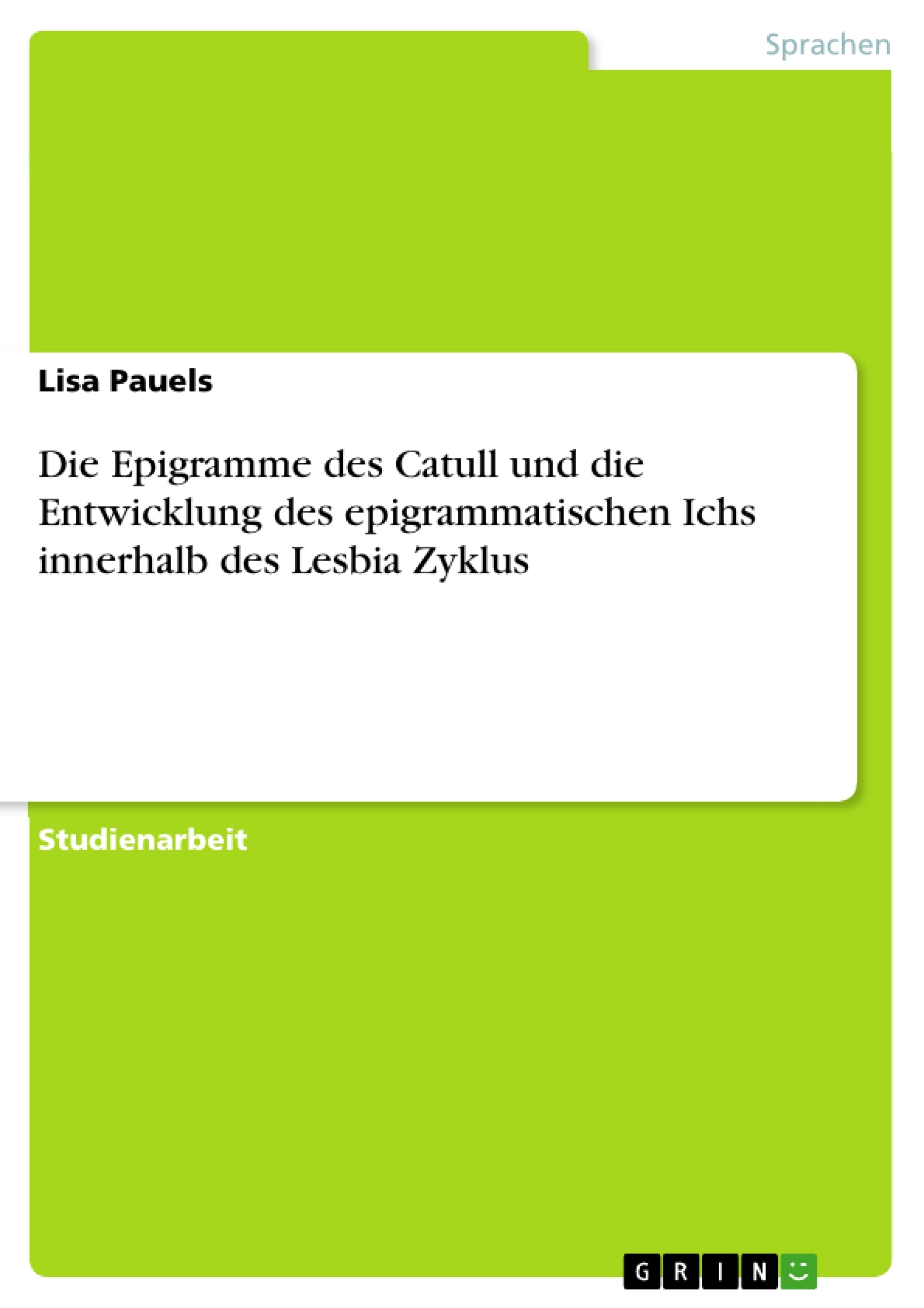In dieser Arbeit soll vor allem auf zwei Epigramme des Catull eingegangen werden, welche aufgrund ihrer Thematik als Einheit zu betrachten sind: c.83 und c.92. Dazu ist anzumerken, dass eine chronologische Reihung der Epigramme im Gesamtwerk des Catull nicht sicher belegbar ist. Verwandte Themen stehen zwar häufig eng beieinander (so z.B. auch c.86 u. c.87), dennoch bleibt dabei unklar, ob diese Reihenfolge schon von Catull selbst so gewählt wurde.
Die Datierung des 83. Gedichts scheint jedoch allgemein anerkannt zu sein, es muss vor dem Tod des Metellus 59 v.Chr. entstanden sein. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass es eines der frühesten Lesbia Epigramme darstellt und c.92 später entstanden ist. Es soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern sich eine Entwicklung der Gefühle des epigrammatischen Ichs aus den beiden Gedichten ablesen lässt, ob also c.83 tatsächliche eine Vorstufe zu c.92 bildet. Hierzu soll zunächst c.83 genau interpretiert, später dann in Beziehung zu c.92 gesetzt werden.
Gaius Valerius Catullus war ein bedeutender römischer Schriftsteller aus Verona und Wegbereiter der augusteischen Dichtung. Er schrieb neben zahlreichen anderen Gedichten auch Epigramme (c.69-116). Diese literarische Gattung ist vor allem durch ihre Kürze und Präzision charakterisiert, im Vermaß findet sich häufig das elegische Distichon. Catull schrieb bewusst über gleiche Themen in mehreren verschiedenen Epigrammen. So stellten die Lesbia-Gedichte einen Themenkomplex innerhalb seines literarischen Werks dar, welcher außerhalb des neoterischen Programms stand. Die Liebe zu Lesbia stellt innerhalb Catulls Gesamtwerk das bedeutendste Thema dar. Bei dieser Frau handelt es sich in Wirklichkeit sehr wahrscheinlich um die mit Quintus Caecilius Metellus Celer verheiratete Schwester des Publius Clodius Pulcher.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Textgrundlage
- Interpretation c.83
- Vergleich c.83 und c.92
- Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Gefühle des lyrischen Ichs in zwei Epigrammen Catulls (c.83 und c.92), die sich auf seine Beziehung zu Lesbia beziehen. Ziel ist es, herauszufinden, ob c.83 als Vorstufe zu c.92 betrachtet werden kann und inwiefern sich eine Entwicklung der Gefühle darin widerspiegelt.
- Analyse der Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und Lesbia
- Interpretation der sprachlichen Mittel und Bilder in den Epigrammen
- Vergleich der beiden Epigramme hinsichtlich ihrer Thematik und Intensität
- Untersuchung der möglichen autobiographischen Elemente
- Diskussion der Rolle des Ehemannes von Lesbia
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt Catull, seine Epigramme und insbesondere die Lesbia-Gedichte als zentralen Gegenstand der Arbeit vor. Sie skizziert die Forschungsfrage nach der Entwicklung der Gefühle des lyrischen Ichs in den Epigrammen c.83 und c.92 und gibt einen kurzen Überblick über den weiteren Aufbau der Arbeit. Die chronologische Reihenfolge der Epigramme wird als unsicher bezeichnet, jedoch wird angenommen, dass c.83 früher als c.92 entstanden ist.
Textgrundlage: Dieses Kapitel präsentiert den lateinischen Text von Catulls Epigrammen c.83 und c.92, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Es dient als Grundlage für die anschließende Interpretation und den Vergleich der beiden Gedichte. Der lateinische Text wird vollständig zitiert und bietet dem Leser die Möglichkeit, die Analyse im Detail zu verfolgen.
Interpretation c.83: Das 83. Gedicht wird detailliert interpretiert, wobei die Beziehung zwischen dem lyrischen Ich, Lesbia und ihrem Mann im Mittelpunkt steht. Die Interpretation analysiert die sprachliche Gestaltung, die Wortwahl und die implizierten Emotionen. Es wird untersucht, wie Lesbias Verhalten – das Schimpfen über das lyrische Ich in Anwesenheit ihres Mannes – von diesem interpretiert wird. Der Fokus liegt auf der Frage, ob diese Situation bereits eine emotionale Intensität zeigt und als Vorstufe zu den Gefühlen in c.92 verstanden werden kann. Die Diskussion umfasst auch verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten und deren Auswirkungen auf die Interpretation.
Schlüsselwörter
Catull, Lesbia, Epigramme, c.83, c.92, Liebeslyrik, römische Literatur, Interpretation, Vergleich, lyrisches Ich, Gefühlsentwicklung, Ehebruch, Pseudonym.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Catulls Epigrammen c.83 und c.92
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der Gefühle des lyrischen Ichs in zwei Epigrammen Catulls (c.83 und c.92), die sich auf seine Beziehung zu Lesbia beziehen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der beiden Gedichte und der Frage, ob c.83 als Vorstufe zu c.92 betrachtet werden kann.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Textgrundlage (lateinischer Text und deutsche Übersetzung von c.83 und c.92), eine Interpretation von c.83, einen Vergleich von c.83 und c.92 und eine Abschlussbetrachtung.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Beziehung zwischen dem lyrischen Ich und Lesbia zu analysieren, die sprachlichen Mittel und Bilder in den Epigrammen zu interpretieren, die beiden Epigramme hinsichtlich ihrer Thematik und Intensität zu vergleichen, mögliche autobiografische Elemente zu untersuchen und die Rolle des Ehemannes von Lesbia zu diskutieren.
Wie wird c.83 interpretiert?
Die Interpretation von c.83 konzentriert sich auf die Beziehung zwischen dem lyrischen Ich, Lesbia und ihrem Mann. Analysiert werden die sprachliche Gestaltung, die Wortwahl und die implizierten Emotionen. Es wird untersucht, ob die Situation in c.83 bereits eine emotionale Intensität zeigt, die als Vorstufe zu den Gefühlen in c.92 verstanden werden kann. Verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten und deren Auswirkungen auf die Interpretation werden ebenfalls diskutiert.
Wie werden c.83 und c.92 verglichen?
Der Vergleich von c.83 und c.92 ist ein zentrales Element der Arbeit. Es wird untersucht, inwiefern sich eine Entwicklung der Gefühle des lyrischen Ichs in den beiden Epigrammen widerspiegelt. Die Thematik und Intensität der beiden Gedichte werden gegenübergestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Catull, Lesbia, Epigramme, c.83, c.92, Liebeslyrik, römische Literatur, Interpretation, Vergleich, lyrisches Ich, Gefühlsentwicklung, Ehebruch, Pseudonym.
Wie wird die chronologische Reihenfolge der Epigramme bewertet?
Die chronologische Reihenfolge der Epigramme wird als unsicher bezeichnet. Die Arbeit geht jedoch von der Annahme aus, dass c.83 vor c.92 entstanden ist.
Welche Rolle spielt der Ehemann von Lesbia?
Die Rolle des Ehemannes von Lesbia wird in der Arbeit diskutiert, insbesondere im Kontext der Interpretation von c.83, wo sein Auftreten und Lesbias Verhalten in seiner Gegenwart zentrale Aspekte der Analyse bilden.
Welche Textgrundlage wird verwendet?
Die Arbeit verwendet den lateinischen Originaltext der Epigramme c.83 und c.92 von Catull, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Der lateinische Text dient als Basis für die Interpretation und den Vergleich.
- Quote paper
- Lisa Pauels (Author), 2013, Die Epigramme des Catull und die Entwicklung des epigrammatischen Ichs innerhalb des Lesbia Zyklus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371524