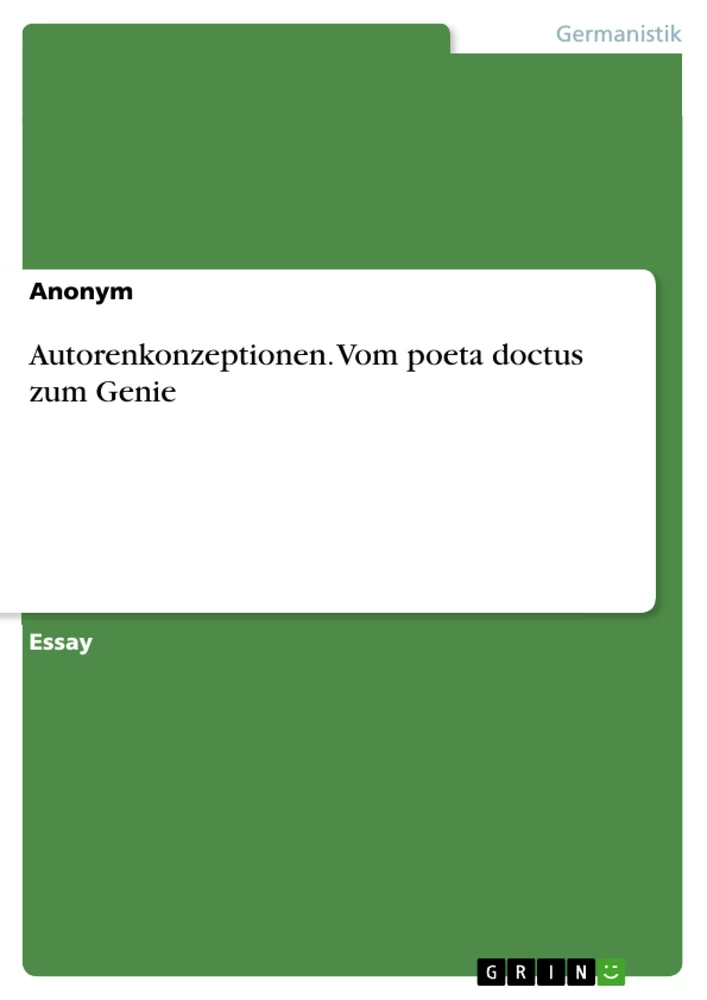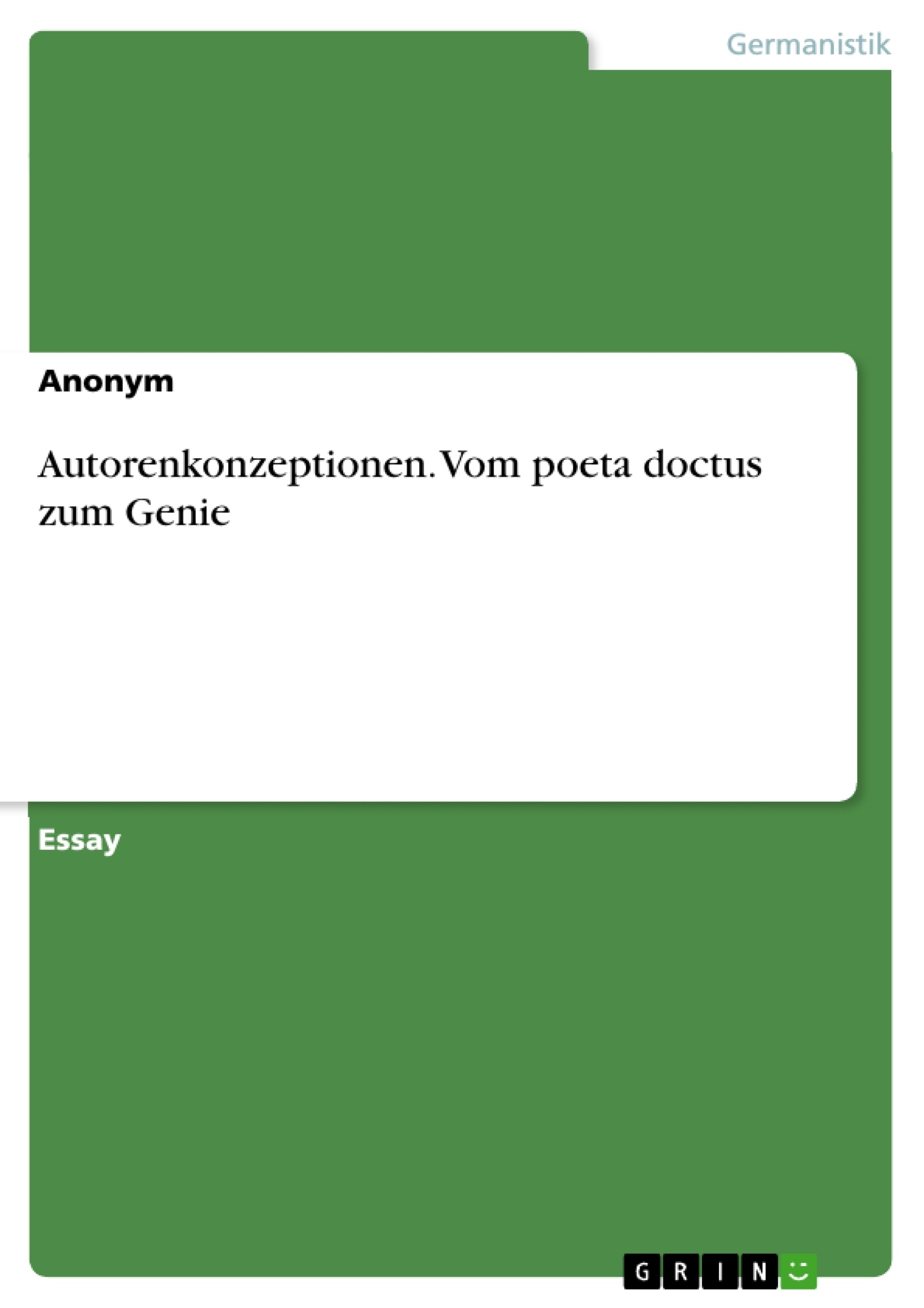Dieser Essay behandelt verschiedene Autorenkonzeptionen.
Die Auffassungen hinsichtlich Autoren und schriftstellerischem Schaffen machten im Laufe der Zeit einen Wandel durch. Während in der Barockzeit um 1700 die Einstellung bestand, Lyrik folge gewissen Regelmäßigkeiten und sei damit erlernbar, dominierte um 1800 der autonome, geniale Autor. Die Genieästhetik führte zu einem radikalen Einschnitt in der Regelpoetik.
Inhaltsverzeichnis
- Autorkonzeptionen: vom poeta doctus zum Genie
- Martin Opitz: Die Regelpoetik
- Johann Christoph Gottsched: Der poeta doctus
- Gotthold Ephraim Lessing: Die Genieästhetik
- Edward Young: Das Genie als Original
- Konsequenzen der Autorenkonzeptionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Entwicklung des Autorkonzepts von der Regelpoetik des 17. Jahrhunderts bis zur Genieästhetik des 18. Jahrhunderts. Er untersucht, wie sich die Auffassungen von Autoren und schriftstellerischem Schaffen im Laufe der Zeit wandelten und welche Konsequenzen diese Veränderungen für die Bewertung von Literatur hatten.
- Die Rolle von Regeln und Tradition in der Literatur
- Das Konzept des „poeta doctus“ und die Bedeutung von Bildung für das dichterische Schaffen
- Die Entstehung und Bedeutung des Geniebegriffs in der Literaturgeschichte
- Die Auswirkungen des Geniebegriffs auf die Interpretation von Texten und die Bewertung von Autoren
- Die Frage nach der Qualität von Literatur, die nach unterschiedlichen Kriterien bewertet wird
Zusammenfassung der Kapitel
Autorkonzeptionen: vom poeta doctus zum Genie
Die Einleitung beschreibt die Entwicklung des Autorkonzepts von der Regelpoetik des Barock bis zur Genieästhetik des 18. Jahrhunderts. Sie stellt die unterschiedlichen Auffassungen von Autoren und schriftstellerischem Schaffen in diesen Epochen gegenüber.
Martin Opitz: Die Regelpoetik
Dieses Kapitel widmet sich Martin Opitz' Werk „Buch von der Deutschen Poetery“ (1624) und analysiert seine Regelpoetik. Opitz' Werk prägte die deutsche Literatur des 17. Jahrhunderts und etablierte die Nachahmungspoetik als Grundlage für das dichterische Schaffen.
Johann Christoph Gottsched: Der poeta doctus
Gottsched, ein Vertreter der Regelpoetik, betonte die Bedeutung von Bildung und Gelehrsamkeit für das dichterische Schaffen. Er sah den Autor als „poeta doctus“, der durch Fleiß und Übung sein Talent entwickeln und seine literarische Bildung festigen sollte.
Gotthold Ephraim Lessing: Die Genieästhetik
Lessing, ein Vertreter der Genieästhetik, stellte den Dichter als Genie über den „poeta doctus“. Er argumentierte, dass das Genie von Natur aus mit Begabungen ausgestattet ist, die es unabhängig von Bildung und Regeln zu großartigen Werken befähigen.
Edward Young: Das Genie als Original
Young entwickelte in seinen „Gedanken über die Original-Werke“ (1759/60) den Geniebegriff weiter. Er sah das Genie als einen zweiten Schöpfer, der nicht der Natur nachahmt, sondern Neues und Originelles erschafft.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Regelpoetik, Genieästhetik, poeta doctus, Genie, Originalität, Nachahmung, Bildung, Talent, Interpretation, Literaturgeschichte.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Autorenkonzeptionen. Vom poeta doctus zum Genie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371245