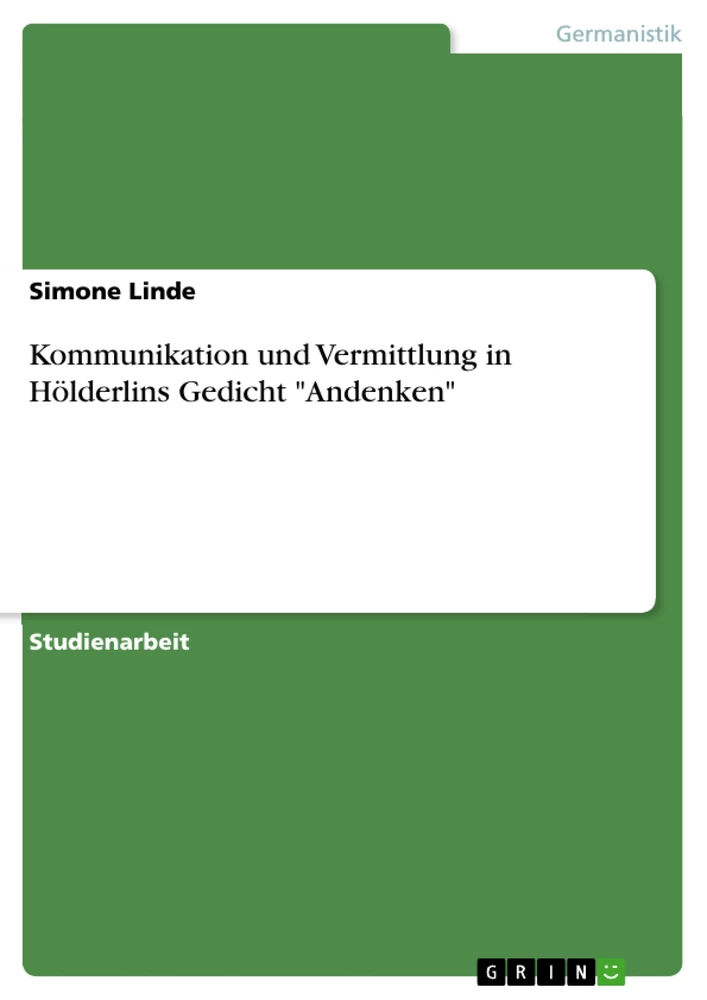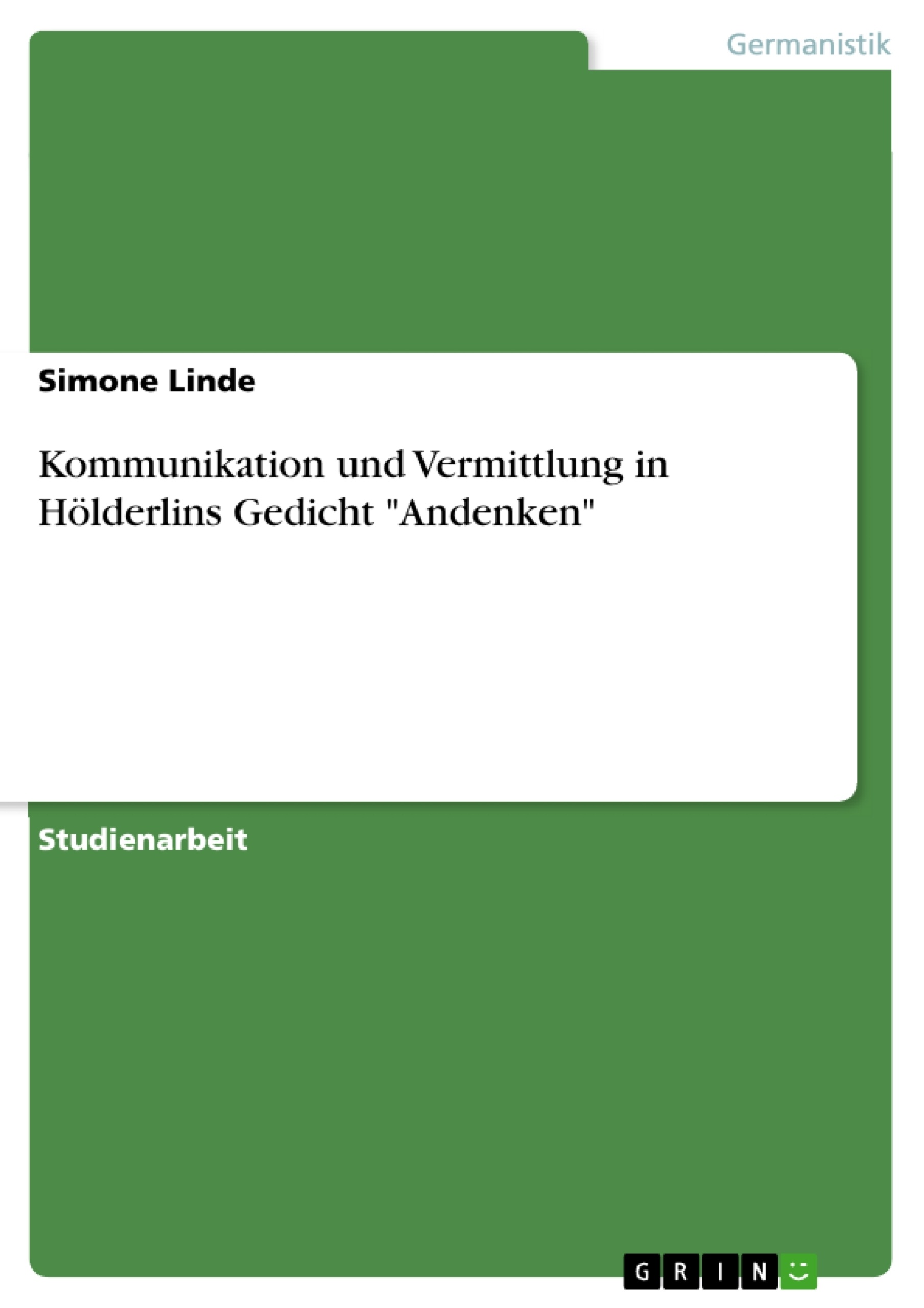Hölderlin gilt als ein Dichter mit einer sehr eigenen und schwer entschlüsselbaren Sprache, die sich durch ihre hohe Bildlichkeit auszeichnet. Sie ist nicht mehr die allegorische Sprache der klassischen Rhetorik, sondern die Wörter wirken stets aus ihrer eigenen Sinnlichkeit heraus und verwandeln die Natur in Zeichen. Die Form ist dem Inhalt überlegen; die Sprache soll nicht etwas bedeuten, sondern sie stellt die Reflexion dar, wobei ihr der Inhalt als Stoff dient.
Hölderlins Schaffen fällt in eine Zeit, in durch die erkenntniskritischen Lehren der Aufklärung eine neue, auf revolutionären Neuanfang und Freiheit zur Selbstbestimmung gerichtete Stimmung vorherrscht und sich eine Kultur des deutschen Geistes und der deutschen Sprache herausbildet. Zu Lebzeiten steht Hölderlin im Schatten von klassischen Dichtern wie Goethe und Schiller, so dass sein dichterisches Werk kaum gewürdigt wird. Erst ein Jahrhundert später entwickeln sich sprachkritische Theorien, die Hölderlins denkerische Welt zu würdigen wissen.
Im Gegensatz zu Schiller, dem es in seinem Werk um die Erkenntnis des moralischen Prinzips im Ästhetischen geht, verlangt Hölderlin für die Dichtung die Integration des praktischen Lebens, weswegen es in seiner Dichtung häufig um die Darstellung von Denkprozessen geht.
Das Gedicht „Andenken“ fällt in den Umkreis von Hölderlins später Hymnendichtung. Diese Hymnendichtung gilt als die am schwersten verständlichste. Sie ist – im Gegensatz zu den Oden und Elegien – geprägt durch sinnliche Darstellung, Fragmentarisierung, zunehmend unpersönliche Wendungen und gehäufte gegenrhythmische Unterbrechungen. Diese Dichtung hat als Hauptmoment die Erprobung der eigenen Möglichkeit als Dichtung und verweist dabei zunehmend auf das Offene, Unabschließbare der Vermittlung – deutlich dadurch, dass Hölderlin viele späte Gedichte tatsächlich nicht beendet hat.
Diese Arbeit untersucht, wie in „Andenken“ die Selbstentfaltung des (poetischen) Bewußtseins im Medium des Gesprächs erreicht wird. Nach grundsätzlichen Überlegungen zum Motiv des Gesprächs untersuche ich den Text „Verfahrensweise des poetischen Geistes“ hinsichtlich der einzelnen Schritte der dialektischen Vermittlung des poetischen Ichs. Dieser theoretische Text dient als Grundlage meiner nachfolgenden Analyse von „Andenken". Danach folgt die vierteilige Analyse des Gedichts – entsprechend den einzelnen Zuständen des poetischen Ichs, die Hölderlin in der „Verfahrensweise des poet. Geistes“ entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen des poetischen Gesprächs
- Die dreifache Natur des poetischen Ich in der "Verfahrensweise des poetischen Geistes"
- Kommunikation und Vermittlung in "Andenken"
- Zustand der Einheit mit der Welt
- Zäsur als Wechsel der Vorstellung
- Die erste Reflexion
- Die zweite Reflexion
- Die dritte Vollendung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Hölderlins Gedicht "Andenken" im Hinblick auf die Kommunikation und Vermittlung des poetischen Bewusstseins im Medium des Gesprächs. Sie untersucht, wie das lyrische Ich durch dialektische Reflexion und Selbstentfaltung im Dialog mit sich selbst und der Welt zu einer neuen Einheit gelangt.
- Das poetische Gespräch in Hölderlins Dichtung
- Die "Verfahrensweise des poetischen Geistes" als theoretische Grundlage für die Gedichtinterpretation
- Die dreifache Natur des poetischen Ichs in "Andenken"
- Die Rolle von Reflexion und Vermittlung in der Selbstfindung des lyrischen Ichs
- Die Bedeutung von Zäsur und Einheit in Hölderlins Gedankengang
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt Hölderlins besondere Sprache und sein dichterisches Werk in den Kontext der Aufklärungsepoche und der Entwicklung der deutschen Literatur.
Kapitel 2 beleuchtet die Grundlagen des poetischen Gesprächs in der Dichtung. Es setzt sich mit dem Motiv des Gesprächs und seiner Bedeutung für die Selbstfindung und Vermittlung des poetischen Bewusstseins auseinander.
Kapitel 3 analysiert den Text "Verfahrensweise des poetischen Geistes" von Hölderlin, um die einzelnen Schritte der dialektischen Vermittlung des poetischen Ichs zu erfassen. Dieser theoretische Text bildet die Grundlage für die Interpretation von "Andenken" in den folgenden Kapiteln.
Kapitel 4 widmet sich der Analyse von "Andenken" selbst. Es untersucht die einzelnen Phasen der Entwicklung des lyrischen Ichs, die durch die Begegnung mit der Welt, Reflexion und Vermittlung geprägt sind.
Schlüsselwörter
Hölderlin, "Andenken", poetisches Gespräch, "Verfahrensweise des poetischen Geistes", dialektische Vermittlung, Selbstentfaltung, Reflexion, Zäsur, Einheit, Kommunikation, Vermittlung, Lyrik, deutsche Literatur, Aufklärungsepoche.
- Quote paper
- Simone Linde (Author), 2001, Kommunikation und Vermittlung in Hölderlins Gedicht "Andenken", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3709