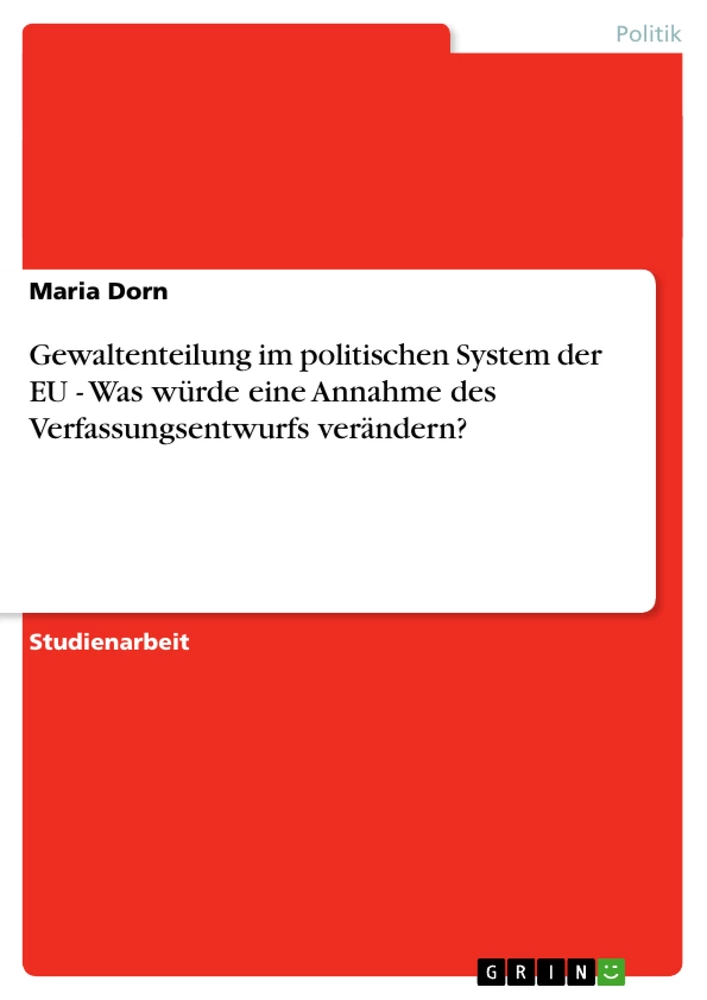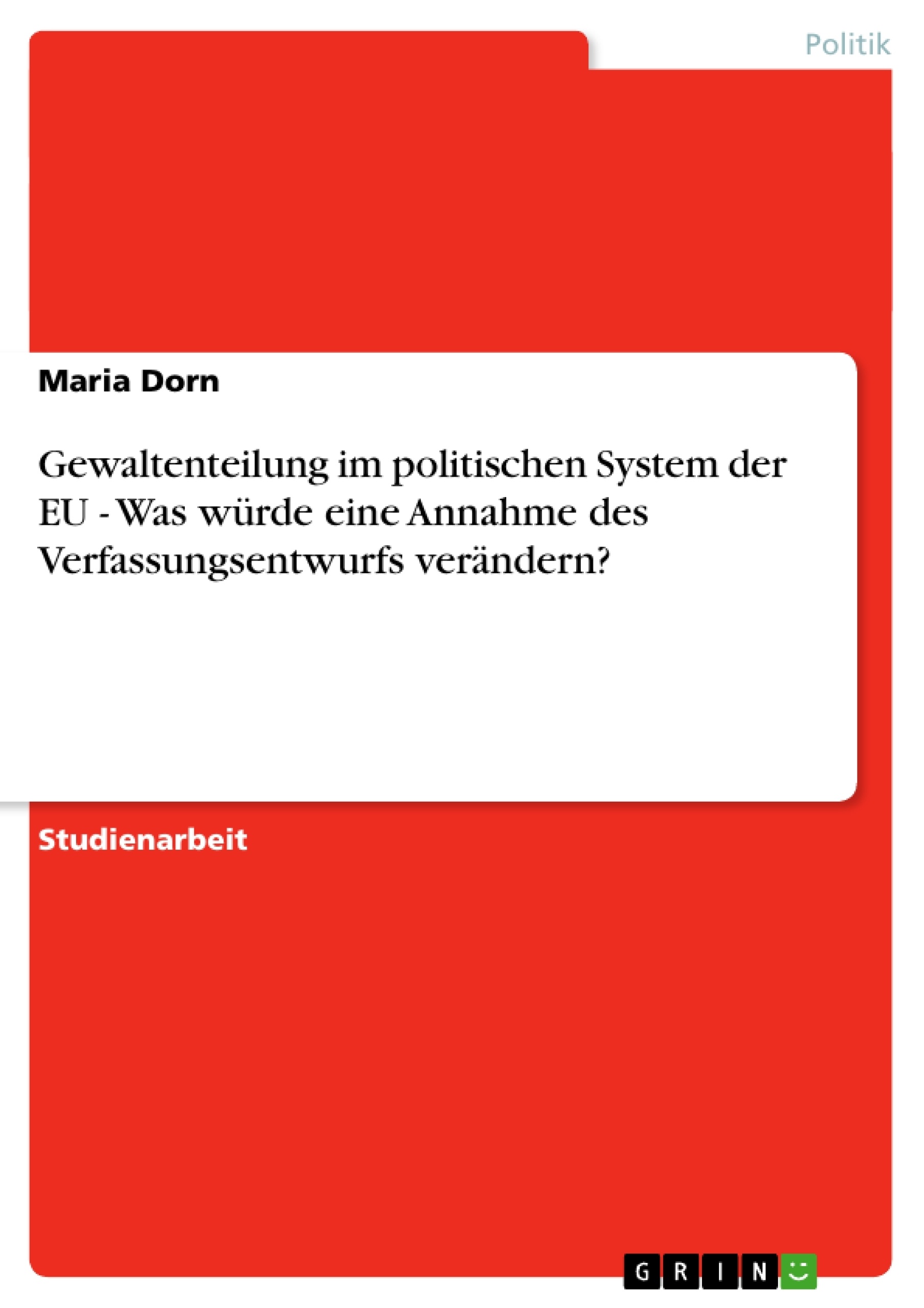„[Die EU ist] eine im Prozess fortschreitender Integration stehende Gemeinschaft eigener Art, auf die die Bundesrepublik Deutschland – wie die übrigen Mitgliedstaaten – bestimmte Hoheitsrechte `übertragen` hat, wodurch eine neue öffentliche Gewalt entstanden ist, die gegenüber der Staatsgewalt der Mitgliedstaaten unabhängig und selbstkritisch ist.“ BVerfGE 22: 293ff. Dieser Prozess der fortschreitenden Integration ist Ende des Jahres 2003 einmal mehr ins Stocken geraten. Die gescheiterte Regierungskonferenz in Brüssel zur Abstimmung über den Vorschlag des EU-Verfassungskonvents zeigt erneut die mühsame Entscheidungsfindung und teilweise unflexible Handlungsfähigkeit der Europäischen Union auf. Die Beseitigung dieser und anderer Defizite war eine der Haup taufgaben, die bei der Regierungskonferenz in Laeken an den Verfassungskonvent der Europäischen Union gestellt wurden. Ein künftiger Verfassungsvertrag der Europäischen Union soll die Aufgabengebiete der Union deutlicher von denen der Mitgliedsländer abgrenzen, die Zuständigkeiten der Organe und deren Abstimmungsmodalitäten neu definieren sowie das Gebilde der Gemeinschaft für die Bevölkerung Europas transparenter gestalten. Ausgehend von diesen Forderungen hat der Verfassungskonvent unter Vorsitz des ehemaligen Staatspräsidenten Frankreichs, Valerie Giscard d´Estaing, im Juni 2003 einen Entwurf für eine europäische Verfassung vorgelegt. Besonders nach der bevorstehenden Erweiterung der Union im Mai 2004 sollen die Änderungen des Entwurfs für größere Flexibilität und effektivere Handlungsfähigkeit im erweiterten Europa sorge tragen. Der Konventspräsident selbst betonte die Wichtigkeit der bereits genannten Ziele für die Zukunft Europas: „Wir müssen dafür sorgen, dass die politischen Entscheidungsträger und die Bürger ein - starkes und deutliches - Zugehörigkeitsgefühl zu Europa entwickeln und gleichzeitig die natürliche Verbundenheit mit ihrer nationalen Identität bewahren“ 1. Im Folgenden soll näher untersucht werden, welche Auswirkungen eine Annahme dieses Entwurfes auf die Organe und besonders die Gewaltenteilung innerhalb des politischen Systems der Europäischen Union hätte. Der Schwerpunkt dieser Betrachtung
liegt dabei im Bereich der Legislativorgane und dem Gesetzgebungsprozeß. 1 In: http://www.dgap.org/IP/ip0208/destaing260202.html, Abrufdatum: 15.01.2004.
Inhaltsverzeichnis
- I. Der Verfassungskonvent und seine Ziele
- II. Welche Auswirkungen hätte der Verfassungsentwurf auf die Legislativgewalt im politischen System der EU?
- 1. Der Gewaltenteilungsbegriff nach Steffani
- 2. Besonderheiten im politischen System der Europäischen Union
- 2.1 Die Legislativgewalt der EU
- 2.2 Das Gesetzgebungsverfahren innerhalb der EU
- 3. Der Verfassungsentwurf und seine Änderungen
- 3.1 Änderungen in Bezug auf Zusammensetzung und Größe der Kommission
- 3.2 Änderungen für das Europäische Parlament
- 3.3 Neuregelungen im Ministerrat und bei der Ermittlung der qualiizierten Mehrheit
- III. Zusammenfassung
- VI. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die möglichen Auswirkungen des Verfassungsentwurfs der Europäischen Union auf die Gewaltenteilung innerhalb des politischen Systems der EU. Der Fokus liegt dabei auf der Legislativgewalt und dem Gesetzgebungsprozess. Die Arbeit analysiert den Gewaltenteilungsbegriff nach Steffani im Kontext der EU und untersucht die Besonderheiten des politischen Systems der EU im Hinblick auf die Gesetzgebung.
- Der Gewaltenteilungsbegriff nach Steffani im Kontext der Europäischen Union
- Die Besonderheiten des politischen Systems der Europäischen Union
- Der Verfassungsentwurf und seine Auswirkungen auf die Legislativgewalt
- Die Rolle des Europäischen Parlaments und der Kommission im Gesetzgebungsprozess
- Die Bedeutung der Abstimmungsmodalitäten und der qualifizierten Mehrheit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Verfassungskonvent und seinen Zielen. Es erläutert die Hintergründe des Entwurfs für eine europäische Verfassung und die Bedeutung der vorgeschlagenen Änderungen für die Zukunft der EU. Im zweiten Kapitel wird der Gewaltenteilungsbegriff nach Steffani auf das System der EU übertragen. Die Besonderheiten des politischen Systems der EU werden beleuchtet und das aktuelle Abstimmungsverfahren sowie die Änderungsvorschläge des Verfassungsentwurfs werden erläutert.
Schlüsselwörter
Gewaltenteilung, Europäische Union, Verfassungsentwurf, Legislativgewalt, Gesetzgebungsverfahren, Steffani, Europäisches Parlament, Kommission, Ministerrat, qualifizierte Mehrheit, Integration, Intergovernmentalismus, Supranationalismus.
- Quote paper
- Dr. Maria Dorn (Author), 2003, Gewaltenteilung im politischen System der EU - Was würde eine Annahme des Verfassungsentwurfs verändern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37075