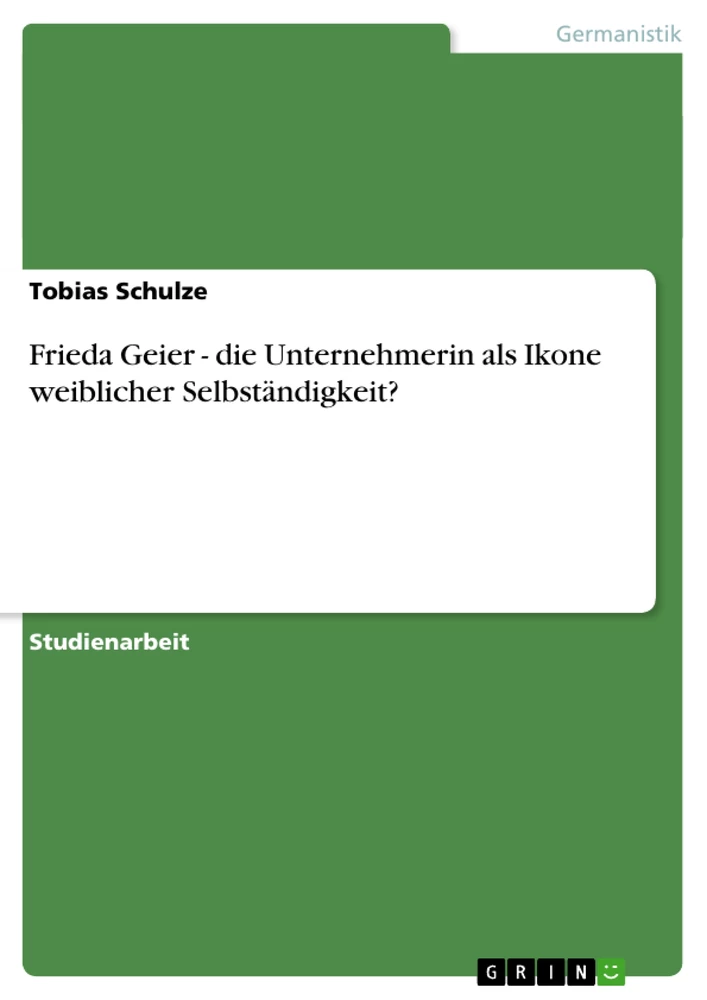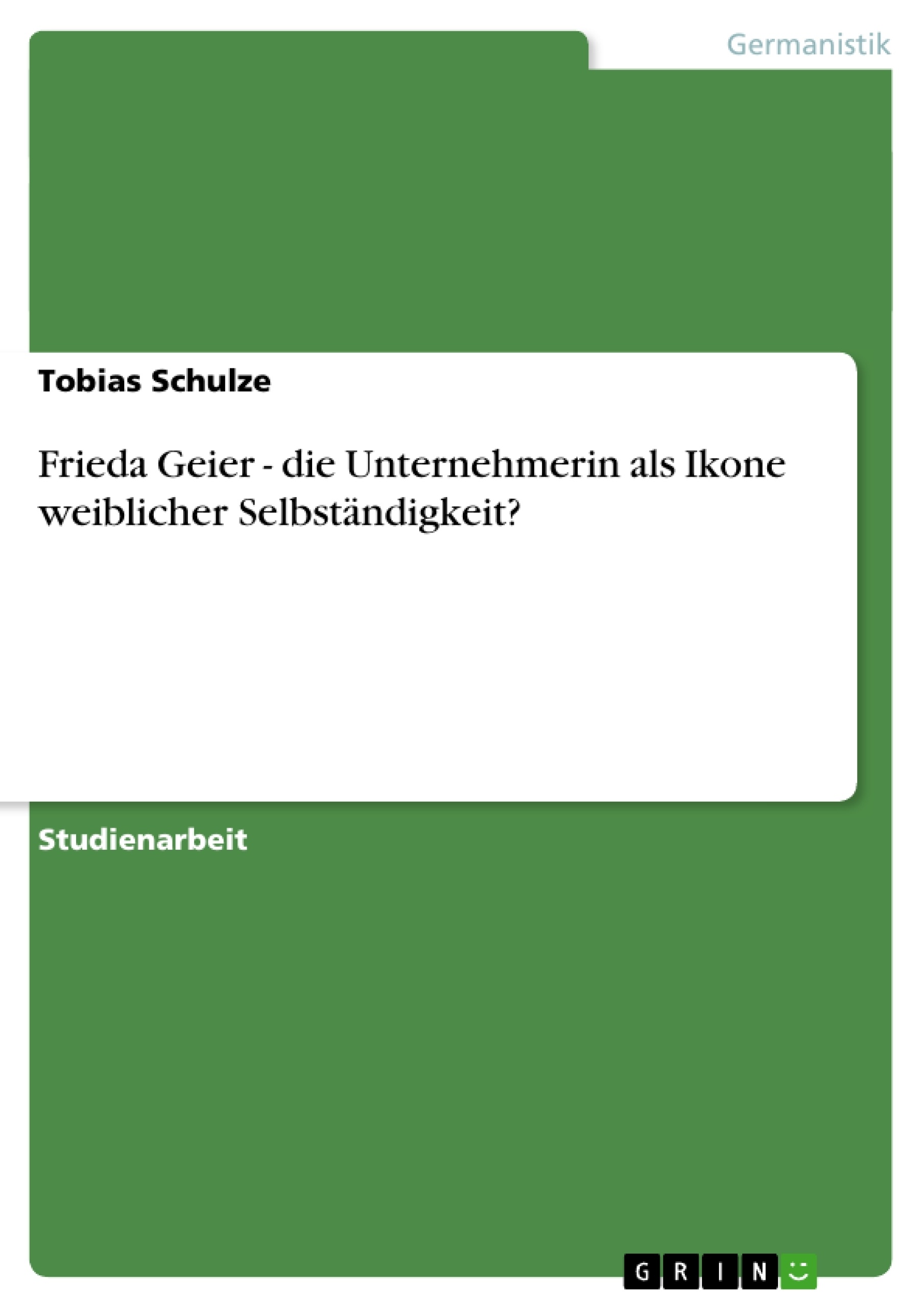1931 erschien Marieluise Fleißers Roman „Die Mehlreisende Frieda Geier“. Er war eine Auftragsarbeit für den Kiepenheuer-Verlag, von dem Fleißer eine geringe Rente erhielt. Der Roman verkaufte sich schlecht, wurde aber wohlwollend besprochen. Die Darstellung eines fortschrittlichen Frauentypus reihte sich ein in die Literatur der Weimarer Zeit von Vicki Baum über Irmgard Keun zu Veza Canetti und Anna Seghers. Fleißers „Frieda Geier“ unterscheidet sich bereits auf den ersten Blick in mehrfacher Hinsicht von Frauendarstellungen der oben genannten Autorinnen. Sie lebt nicht (mehr) in der Großstadt, sondern in der bayrischen Provinz und übt keinen besonders modischen, aber randständigen Beruf aus. Und sie ist keine Angestellte, sondern Ein-Frau-Unternehmerin. In dieser besonderen Eigenschaft der unternehmerisch Tätigen soll die Figur hier diskutiert werden. Nach Fleißers „Wiederentdeckung“ durch Fassbinder, Kroetz und andere überarbeitete die Autorin den Roman für die Werkausgabe. Er wurde nach seiner Wiederauflage nochmals breit rezipiert, meist mit einem recht eindeutigen Ansatz. Sowohl von feministischer wie von marxistischer Seite wurde Frieda Geier als Ikone weiblicher und proletarischer Unabhängigkeit und Selbständigkeit dargestellt. So schrieb etwa Karin Abt über die „optimistischste Frauenfigur Fleißers“: „Sie schafft es als eine der wenigen, sich aus den ‚Klauen’ der Männer zu befreien und ihren eigenen Weg zu gehen.“ 2 Und aus marxistischer Perspektive wird Frieda Geier so gelobt: „Frieda Geiers Geschichte ist auch eine Geschichte über den Versuch einer intellektuellen Agentin der roten Front, Aufklärung in die süddeutsche Kleinstadt zu tragen.“ Ich möchte zwei Seiten der Hauptprotagonistin in den Blick nehmen: ihre Unabhängigkeit und ihre Abhängigkeit als Unternehmerin. Meine der Untersuchung voranstehende These ist, dass eines ohne das andere nicht zu denken ist. Das würde bedeuten, dass die wirtschaftliche Selbständigkeit Frieda Geiers nicht vor allem Ausdruck ihrer Emanzipation, sondern ihrer Modernität ist. Der Begriff Emanzipation, im allgemeinen wie im feministischen Sinne, würde die Ausweitung von Handlungsspielräumen und Selbstbestimmung bedeuten. Ich möchte jedoch auch den Aspekt der Einengung von Selbstbestimmung durch die wirtschaftlichen
Existenzbedingungen, die „Zumutungen der Selbstrationalisierung“ deutlich machen. In diesem Sinne wäre die Unternehmertätigkeit nicht Teil der Emanzipation, sondern ihre drastischste Einschränkung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frieda Geier – marxistische und feministische Heldin?
- Zur Methode
- Die Unternehmerin Frieda Geier - Textanalyse
- Die ökonomische Konstitution der Unternehmerin
- Die psychosoziale Konstitution der Unternehmerin
- Alternativen?
- traditionelle Frauenrolle und kostenlose Arbeitskraft
- Figur ohne Ich – Frieda Geier als Konstruktion
- Eine moderne Frau?
- Eine emanzipierte Frau?
- Die Figur Frieda Geier als dialektische Darstellung von Zeitkonflikten
- Keine Ikone. Nirgends.
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Figur der Frieda Geier aus Marieluise Fleißers Roman „Die Mehlreisende Frieda Geier“ und analysiert die Unternehmerin in ihrem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext. Ziel ist es, die Ambivalenz zwischen Friedas wirtschaftlicher Selbständigkeit und ihrer möglichen Emanzipation zu beleuchten.
- Die ökonomische Konstitution der Unternehmerin Frieda Geier und ihre prekären Arbeitsbedingungen.
- Die psychosoziale Konstitution der Unternehmerin und ihre Positionierung im Spannungsfeld zwischen traditioneller Frauenrolle und moderner Selbständigkeit.
- Die Darstellung Frieda Geiers als Konstruktion und ihre Rolle im Kontext der Zeitkonflikte der Weimarer Republik.
- Die Frage, ob Frieda Geier als Ikone weiblicher und proletarischer Unabhängigkeit verstanden werden kann.
- Die Relevanz der Analyse von Frieda Geiers Figur für die heutige Zeit im Kontext von Prekarisierung und Flexibilisierung der Arbeitswelt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Figur der Frieda Geier sowie die Forschungsfrage nach ihrer Rolle als Unternehmerin im Kontext von Emanzipation und Modernität vor.
Das zweite Kapitel widmet sich der Textanalyse und beleuchtet die ökonomische und psychosoziale Konstitution der Unternehmerin. Es werden die prekären Arbeitsbedingungen, die gesellschaftliche Wahrnehmung ihrer Rolle und die Einschränkungen ihrer Selbstbestimmung durch den Kapitalismus analysiert.
Kapitel drei befasst sich mit der Figur Frieda Geier als Konstruktion. Es wird untersucht, inwieweit sie als moderne Frau, emanzipierte Frau oder als dialektische Darstellung von Zeitkonflikten verstanden werden kann.
Das vierte Kapitel kommt zu dem Schluss, dass Frieda Geier keine Ikone weiblicher oder proletarischer Selbständigkeit ist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Unternehmerin, Prekäre Arbeit, Emanzipation, Modernität, Geschlechterrollen, Kapitalismus, Weimarer Republik, Marieluise Fleißer, „Die Mehlreisende Frieda Geier“ und die Figur Frieda Geier als Konstruktion.
- Quote paper
- Tobias Schulze (Author), 2004, Frieda Geier - die Unternehmerin als Ikone weiblicher Selbständigkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37048