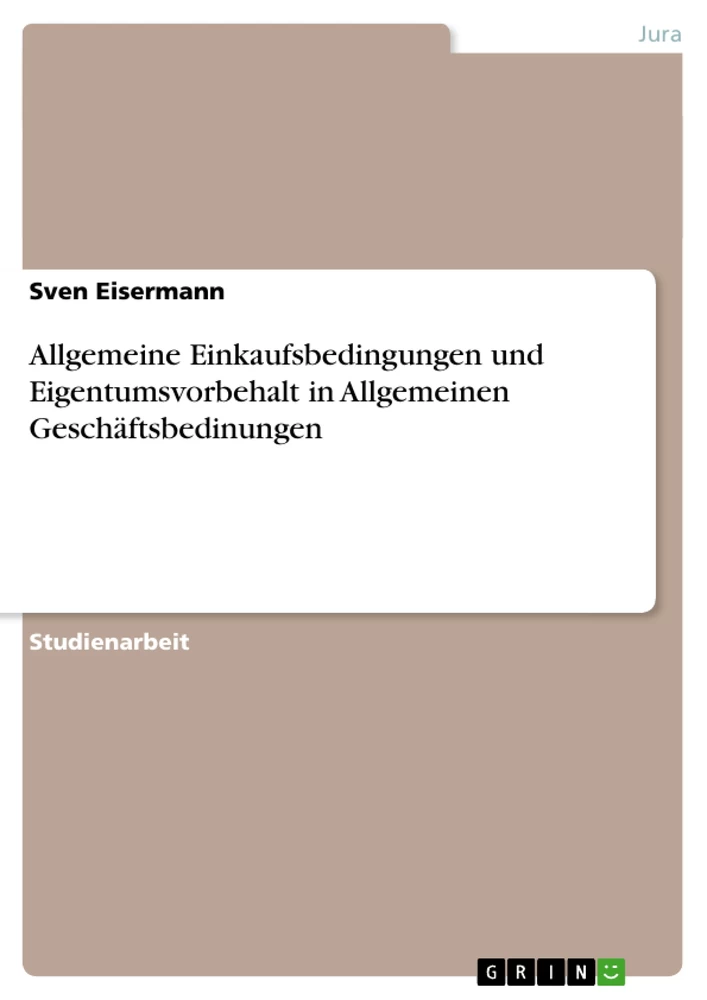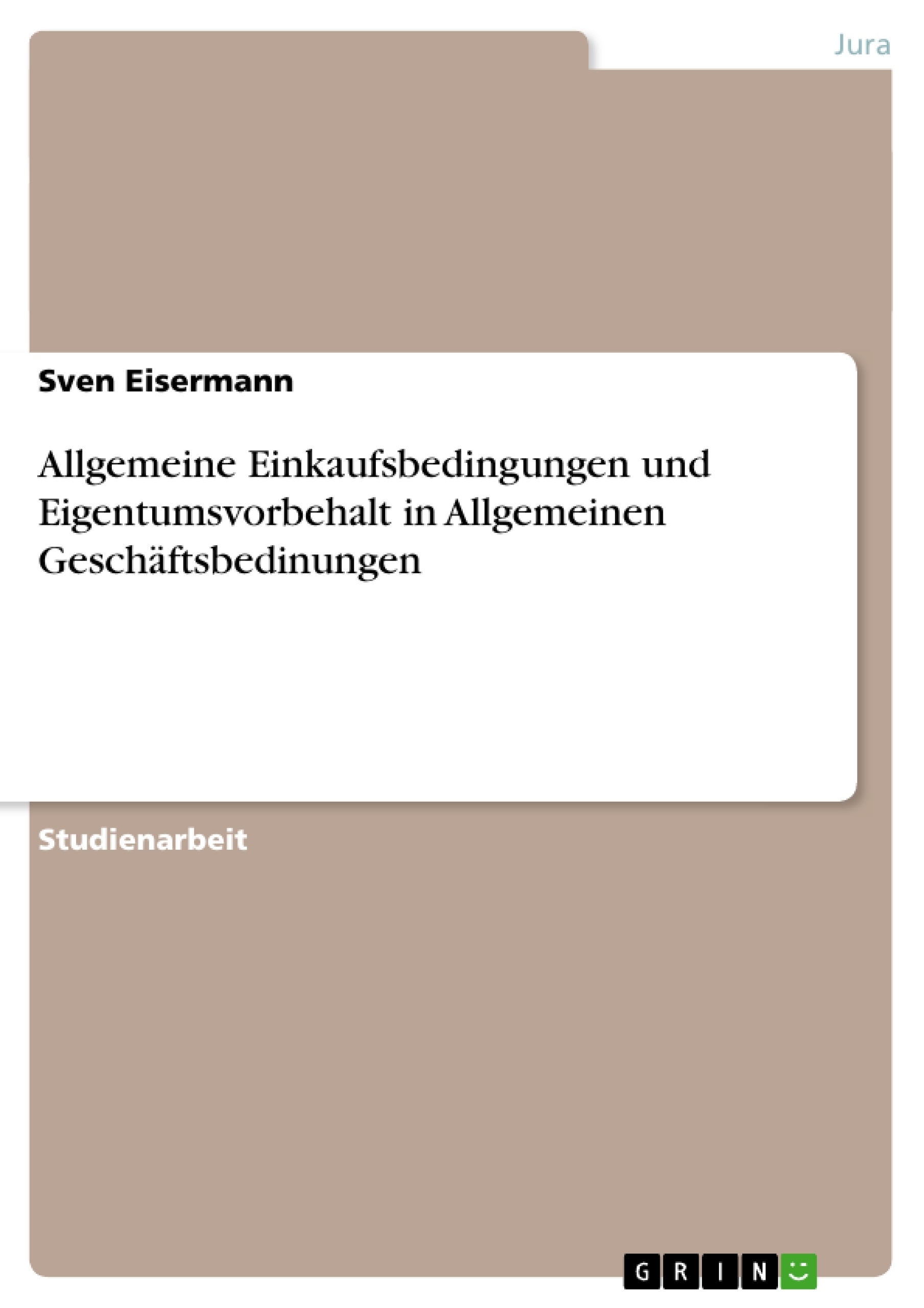Bei Einkaufsbedingungen (EB) handelt es sich um „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ im Sinne der §§ 305 ff. BGB. Jedoch unterscheiden sie sich in wesentlichen Punkten von „normalen“ AGB, die regelmäßig für Verkäufe im Sinne des Unternehmenszwecks gedacht sind, somit also für eine Vielzahl von Geschäften. Wenngleich Einkaufs- und Verkaufsbedingungen dem Geltungsbereich der AGBKotrolle unterliegen, so sind doch die Interessen beider Vertragspartner entgegengesetzt. Der Verkäufer will möglichst seine Gewährleistungspflicht reduzieren oder sogar ausschließen, möglichst lange Zugriff auf die Kaufsache haben, solange sie nicht bezahlt ist (s.a. Eigentumsvorbehalt) und vom Käufer eine Vorleistungspflicht verlangen. Dieser hingegen ist daran interessiert, möglichst lange Gewährleistungszeiten zu bekommen und möglichst schnell Eigentum an der Waren zu erlangen. Der besondere Bedarf an EB liegt insbesondere an vor, wenn ein Unternehmen (als Großabnehmer) auf die Zulieferung von Waren verschiedener Hersteller angewiesen ist. Hier erleichtert es dem Abnehmer, sich auf Rüge- und Gewährleistungsfristen etc. einzustellen, da diese aufgrund seiner von ihm gestellten EB bei allen Verträgen gleich sind. 1 Hinzu kommt, dass es sich der Beschaffung von Gütern um Geschäfte von größerem Umfang handelt, durch die Verwendung standardisierter Bedingungen erleichtert und überschaubarer werden.2 1 Locher in: MüVertragsHB, S. 1031. 2 Zwilling-Pinna in Rechtsfomularhandbuch, S. 309.
Inhaltsverzeichnis
- Einkaufsbedingungen
- Definition
- Anwendungsbereich
- Einbeziehung
- Wertung
- Inhalt von EB
- Skonto und Zahlungsfrist
- Gewährleistung und Beweislastumkehr
- Eigentumsvorbehalt
- Günstigkeitsklauseln
- Fixklauseln und Fristen
- Sonstige Klauseln
- Der Eigentumsvorbehalt in Allgemeinen Geschäftsbedingungen
- Allgemeines
- Zweck des EV
- Vereinbarung des EV
- EV im Rahmen von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
- Arten des EV
- Einfacher EV
- Verlängerter EV
- Erweiterter EV
- Weitergeleiteter EV
- Nachgeschalteter EV
- Kontokorrentvorbehalt
- Konzernvorbehalt
- Freigabeklausel
- Kombination verschiedener Eigentumsvorbehalte
- EV in AGB bei Insolvenz (Lieferantenpool)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Gestaltung zivilrechtlicher Verträge, insbesondere mit Allgemeinen Einkaufsbedingungen (EB) und dem Eigentumsvorbehalt in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Ziel ist es, die rechtlichen Aspekte dieser Vertragsbestandteile zu beleuchten und deren Bedeutung im kaufmännischen Geschäftsverkehr zu erläutern.
- Definition und Anwendungsbereich von Allgemeinen Einkaufsbedingungen
- Einbeziehung von Einkaufsbedingungen in Verträge
- Rechtliche Wertung von Klauseln in Einkaufsbedingungen
- Der Eigentumsvorbehalt als wichtiges Element in AGB
- Arten und rechtliche Ausgestaltung des Eigentumsvorbehalts
Zusammenfassung der Kapitel
Einkaufsbedingungen: Dieses Kapitel definiert Allgemeine Einkaufsbedingungen (EB) als AGB im Sinne der §§ 305 ff. BGB und hebt deren Unterschied zu normalen AGB hervor, die für Verkäufe im Sinne des Unternehmenszwecks gedacht sind. Es wird der Gegensatz der Interessen von Verkäufern und Käufern beleuchtet, wobei Verkäufer ihre Gewährleistungspflicht reduzieren wollen, während Käufer lange Gewährleistungszeiten und schnellen Eigentumserwerb anstreben. Die besondere Bedeutung von EB liegt im Umgang mit Großabnehmern, die Waren von verschiedenen Herstellern beziehen und durch standardisierte Bedingungen einen effizienteren Beschaffungsprozess gewährleisten. Der Anwendungsbereich wird ebenfalls eingegrenzt, wobei die Anwendung gegenüber Verbrauchern in der Praxis als nahezu ausgeschlossen dargestellt wird.
Der Eigentumsvorbehalt in Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Dieses Kapitel behandelt den Eigentumsvorbehalt (EV) im Kontext von AGB. Es erklärt den Zweck des EV, seine Vereinbarung und verschiedene Arten wie einfachen, verlängerten und erweiterten EV, inklusive weitergeleiteter, nachgeschalteter, Kontokorrent- und Konzernvorbehalte. Die Bedeutung des EV bei Insolvenz und die Kombination verschiedener Eigentumsvorbehalte werden ebenfalls diskutiert, wobei ein Schwerpunkt auf der rechtlichen Einordnung und den potenziellen Auswirkungen auf die Vertragsparteien liegt. Der Fokus liegt auf der Rolle des Eigentumsvorbehalts als Risikominimierungsinstrument für den Verkäufer im Rahmen des Vertragsabschlusses.
Schlüsselwörter
Allgemeine Einkaufsbedingungen (AGB), Eigentumsvorbehalt, Vertragsgestaltung, Zivilrecht, Kaufmännischer Geschäftsverkehr, Gewährleistung, Beweislastumkehr, AGB-Kontrolle, § 305 ff. BGB, Risikoverlagerung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Allgemeine Einkaufsbedingungen und Eigentumsvorbehalt
Was behandelt diese Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich mit der Gestaltung zivilrechtlicher Verträge, insbesondere mit Allgemeinen Einkaufsbedingungen (EB) und dem Eigentumsvorbehalt in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Sie beleuchtet die rechtlichen Aspekte dieser Vertragsbestandteile und deren Bedeutung im kaufmännischen Geschäftsverkehr.
Was sind Allgemeine Einkaufsbedingungen (EB)?
Allgemeine Einkaufsbedingungen (EB) werden als AGB im Sinne der §§ 305 ff. BGB definiert. Sie unterscheiden sich von normalen AGB, die für Verkäufe im Sinne des Unternehmenszwecks gedacht sind. EB werden vor allem von Großabnehmern verwendet, um einen effizienteren Beschaffungsprozess zu gewährleisten, indem sie standardisierte Bedingungen für die Beschaffung von Waren von verschiedenen Herstellern nutzen. Die Anwendung gegenüber Verbrauchern ist in der Praxis nahezu ausgeschlossen.
Was ist der Unterschied zwischen EB und AGB für Verkäufe?
Der Hauptunterschied liegt in den Interessen der Vertragsparteien. Verkäufer versuchen, ihre Gewährleistungspflicht zu reduzieren, während Käufer lange Gewährleistungszeiten und schnellen Eigentumserwerb anstreben. EB spiegeln die Interessen des Käufers wider, während AGB für Verkäufe die Interessen des Verkäufers priorisieren.
Was ist der Eigentumsvorbehalt (EV)?
Der Eigentumsvorbehalt (EV) ist ein wichtiges Element in AGB. Er dient als Risikominimierungsinstrument für den Verkäufer und regelt, dass das Eigentum an der gelieferten Ware erst nach vollständiger Zahlung beim Verkäufer verbleibt. Die Hausarbeit behandelt verschiedene Arten von EV, wie einfachen, verlängerten und erweiterten EV (inkl. weitergeleiteter, nachgeschalteter, Kontokorrent- und Konzernvorbehalte).
Welche Arten von Eigentumsvorbehalten werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt den einfachen, verlängerten und erweiterten Eigentumsvorbehalt. Der erweiterte Eigentumsvorbehalt beinhaltet wiederum den weitergeleiteten, nachgeschalteten, Kontokorrent- und Konzernvorbehalt.
Welche Bedeutung hat der EV bei Insolvenz?
Die Bedeutung des EV bei Insolvenz des Käufers wird diskutiert, insbesondere im Kontext eines Lieferantenpools. Der EV ermöglicht es dem Verkäufer, seine Ware im Insolvenzfall zurückzufordern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Hausarbeit?
Allgemeine Einkaufsbedingungen (AGB), Eigentumsvorbehalt, Vertragsgestaltung, Zivilrecht, Kaufmännischer Geschäftsverkehr, Gewährleistung, Beweislastumkehr, AGB-Kontrolle, § 305 ff. BGB, Risikoverlagerung.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Hausarbeit beinhaltet Kapitelzusammenfassungen zu den Einkaufsbedingungen und dem Eigentumsvorbehalt in AGB, die einen detaillierten Einblick in die jeweiligen Themen geben. Das Inhaltsverzeichnis bietet eine strukturierte Übersicht über die behandelten Themen.
- Quote paper
- Sven Eisermann (Author), 2005, Allgemeine Einkaufsbedingungen und Eigentumsvorbehalt in Allgemeinen Geschäftsbedinungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/36996